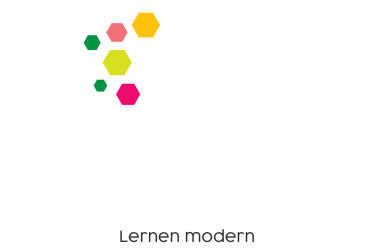„Carl Schmitt“ – Versionsunterschied
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
GS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Schmitts Begriff des [[Staat]]es setzt den Begriff des [[Politik|Politischen]] voraus. Schmitt formuliert also einen Primat der Politik, keinen Primat des Rechts. Der Rechtsordnung, der durch das Recht gestalteten und definierten Ordnung, gehe also immer eine andere, nämlich staatliche Ordnung voraus. Es ist für Schmitt diese vor-rechtliche Ordnung, die es dem Recht erst ermöglicht, konkrete Wirklichkeit zu werden. Mit anderen Worten: Das Politische folgt einer konstitutiven Logik, das Juristische einer regulativen. Die Ordnung wird bei Schmitt durch den entscheidenden [[Souverän]] hergestellt, der unter Umständen zu ihrer Sicherung einen Gegner zum [[Feind]] erklären kann, den es zu bekämpfen, womöglich zu vernichten gilt. Um dies zu tun, könne der Souverän die Schranken beseitigen, die mit der Idee des Rechts gegeben sind. |
Schmitts Begriff des [[Staat]]es setzt den Begriff des [[Politik|Politischen]] voraus. Schmitt formuliert also einen Primat der Politik, keinen Primat des Rechts. Der Rechtsordnung, der durch das Recht gestalteten und definierten Ordnung, gehe also immer eine andere, nämlich staatliche Ordnung voraus. Es ist für Schmitt diese vor-rechtliche Ordnung, die es dem Recht erst ermöglicht, konkrete Wirklichkeit zu werden. Mit anderen Worten: Das Politische folgt einer konstitutiven Logik, das Juristische einer regulativen. Die Ordnung wird bei Schmitt durch den entscheidenden [[Souverän]] hergestellt, der unter Umständen zu ihrer Sicherung einen Gegner zum [[Feind]] erklären kann, den es zu bekämpfen, womöglich zu vernichten gilt. Um dies zu tun, könne der Souverän die Schranken beseitigen, die mit der Idee des Rechts gegeben sind. |
||
Der [[Mensch]] ist für den Katholiken Schmitt nicht von Natur aus gut, sondern unbestimmt, fähig zum Guten wie zum Bösen. Damit wird er aber (zumindest potentiell) gefährlich und riskant. Weil der Mensch nicht vollkommen gut ist, kommt es zu Feindschaften. Politik ist für Schmitt dabei derjenige Bereich, in dem zwischen Freund und Feind unterschieden wird. Der Feind ist für ihn immer der öffentliche Feind (''hostis'' bzw. '' |
Der [[Mensch]] ist für den Katholiken Schmitt nicht von Natur aus gut, sondern unbestimmt, fähig zum Guten wie zum Bösen. Damit wird er aber (zumindest potentiell) gefährlich und riskant. Weil der Mensch nicht vollkommen gut ist, kommt es zu Feindschaften. Politik ist für Schmitt dabei derjenige Bereich, in dem zwischen Freund und Feind unterschieden wird. Der Feind ist für ihn immer der öffentliche Feind (''hostis'' bzw. ''πολέμιος''), nie der private Feind (''inimicus'' bzw. ''εχθρός''). Die Aufforderung „Liebet eure Feinde“ aus der Bergpredigt (nach der Vulgata: ''diligite inimicos vestros'', Matthäus 5,44 und Lukas 6,27) bezieht sich, wie Schmitt betont, auf den privaten Feind. In einem geordneten Staatswesen gibt es somit für ihn eigentlich keine Politik, sondern nur sekundäre Formen des Politischen (z. B. Polizei). |
||
Politik ist bei Schmitt ein ''Intensitätsgrad der Assoziation und Dissoziation von Menschen'' („''Die Unterscheidung von Freund und Feind hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen''“). Diese dynamische, nicht auf ein Sachgebiet begrenzte Definition eröffnete eine neue theoretische Fundierung politischer Phänomene. Für Schmitt war diese Auffassung der Politik eine Art Grundlage seiner Rechtsphilosophie: Nur wenn die Intensität unterhalb der Schwelle der offenen Freund-Feind-Unterscheidung gehalten wird, besteht eine Ordnung. Im anderen Falle drohen Krieg oder Bürgerkrieg. Im Kriegsfall hat man es für Schmitt mit zwei souveränen Akteuren zu tun; der Bürgerkrieg stellt dagegen die innere Ordnung als solche in Frage. Eine Ordnung existiert für Schmitt immer nur vor dem Horizont ihrer radikalen Infragestellung. Die Freund-Feind-Erklärung ist dabei ausdrücklich immer an den extremen Ausnahmefall gebunden (''extremis neccessitatis causa''). Als Kritik an Schmitt wird aber formuliert, dass er selbst keinerlei Kriterien angibt, unter welchen Umständen ein Gegenüber als Feind zu beurteilen ist. Der (öffentliche) Feind ist somit derjenige, der per autoritativer Setzung zum Feind erklärt wird (in diesem Sinne ist Schmitt Vordenker des sog. [[Feindstrafrecht]]s). |
Politik ist bei Schmitt ein ''Intensitätsgrad der Assoziation und Dissoziation von Menschen'' („''Die Unterscheidung von Freund und Feind hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen''“). Diese dynamische, nicht auf ein Sachgebiet begrenzte Definition eröffnete eine neue theoretische Fundierung politischer Phänomene. Für Schmitt war diese Auffassung der Politik eine Art Grundlage seiner Rechtsphilosophie: Nur wenn die Intensität unterhalb der Schwelle der offenen Freund-Feind-Unterscheidung gehalten wird, besteht eine Ordnung. Im anderen Falle drohen Krieg oder Bürgerkrieg. Im Kriegsfall hat man es für Schmitt mit zwei souveränen Akteuren zu tun; der Bürgerkrieg stellt dagegen die innere Ordnung als solche in Frage. Eine Ordnung existiert für Schmitt immer nur vor dem Horizont ihrer radikalen Infragestellung. Die Freund-Feind-Erklärung ist dabei ausdrücklich immer an den extremen Ausnahmefall gebunden (''extremis neccessitatis causa''). Als Kritik an Schmitt wird aber formuliert, dass er selbst keinerlei Kriterien angibt, unter welchen Umständen ein Gegenüber als Feind zu beurteilen ist. Der (öffentliche) Feind ist somit derjenige, der per autoritativer Setzung zum Feind erklärt wird (in diesem Sinne ist Schmitt Vordenker des sog. [[Feindstrafrecht]]s). |
||
Version vom 21. Dezember 2005, 12:53 Uhr
Carl Schmitt (* 11. Juli 1888 in Plettenberg, Westfalen; † 7. April 1985 in Plettenberg-Pasel) war ein deutscher Staatsrechtler und politischer Philosoph.
Der Jurist ist einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten deutschen Staats- und Völkerrechtler des 20. Jahrhunderts. Er hatte sich als „Kronjurist des Dritten Reiches“ (Waldemar Gurian) und als „geistiger Quartiermacher“ des Nationalsozialismus (Ernst Niekisch) schwer kompromittiert. Sein im katholischen Glauben verwurzeltes Denken kreiste um Fragen der Macht, der Gewalt und der Rechtsverwirklichung. Er gab Begriffen wie „Ausnahmezustand“, „Diktatur“, „Souveränität“ und „Großraum“ ihre definitorische Prägnanz und prägte Formeln wie „Politische Theologie“, „Hüter der Verfassung“, „dilatorischer Formelkompromiss“, „Verfassungswirklichkeit“ oder Unterscheidungen wie die zwischen „Legalität und Legitimität“, „Gesetz und Maßnahme“ oder „Freund und Feind“. Seine Arbeiten streiften neben dem Staats- und Verfassungsrecht zahlreiche weitere Disziplinen, u.a. Politologie, Soziologie, Geschichtswissenschaft, Theologie, Germanistik und Philosophie. Schmitt wird heute zwar als „furchtbarer Jurist“, umstrittener Theoretiker und Gegner der liberalen Demokratie gesehen, aber zugleich auch als „Klassiker des politischen Denkens“ bezeichnet (Herfried Münkler), nicht zuletzt aufgrund seiner Wirkung auf das Staatsrecht und die Rechtswissenschaft der frühen Bundesrepublik. Schmitt bezog die prägenden Einflüsse für sein Denken von politischen Philosophen und Staatsdenkern wie Thomas Hobbes, Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Louis de Bonald, Joseph de Maistre oder Georges Sorel, aber auch von Theoretikern der katholischen Gegenreformation wie Juan Donoso Cortés.
Leben
Kindheit und Jugend
Schmitt, Sohn eines Krankenkassenverwalters, entstammte einer katholisch-kleinbürgerlichen Familie, die aus Bausendorf/Eifel ins Sauerland gezogen war. Er war das zweite von fünf Kindern. Er wohnte im katholischen Konvikt in Attendorn und besuchte dort das staatliche Gymnasium. Nach dem Abitur wollte er zunächst Philologie studieren und begann nur auf dringendes Anraten eines Onkels hin das Jura-Studium. Nach dem Studium (ab 1907) in Berlin, München und Straßburg wurde Schmitt 1910 in Straßburg mit der strafrechtlichen Arbeit Über Schuld und Schuldarten von Fritz van Calker promoviert. Im Frühjahr 1915 absolvierte er das Assessor-Examen. 1916 diente Schmitt als Kriegsfreiwilliger in einem bayerischen Infanterie-Leibregiment in München und heiratete Pawla Dorotic, eine vermeintliche Gräfin aus Serbien, die sich später als Hochstaplerin entpuppte. 1924 wurde die Ehe vom Landgericht Bonn annulliert. Ein Jahr später heiratete er seine Studentin Duska Todorovic, obwohl seine vorige Ehe kirchlich nicht aufgehoben worden war. Daher war der Katholik bis zum Tode seiner zweiten Frau im Jahre 1950 exkommuniziert und somit von den Sakramenten ausgeschlossen. Aus dieser zweiten Ehe ging sein einziges Kind, die Tochter Anima, hervor.
Wissenschaftlicher Werdegang
Bereits früh zeigte sich bei dem jungen Schmitt eine literarisch-künstlerische Ader. So trat er mit eigenen literarischen Versuchen hervor (Der Spiegel, Die Buribunken, Schattenrisse, er soll sich sogar mit dem Gedanken an einen Gedichtzyklus mit dem Titel Die große Schlacht um Mitternacht getragen haben) und verfasste eine Studie über den bekannten zeitgenössischen Dichter Theodor Däubler (Theodor Däublers ‚Nordlicht’). Seine literarischen Arbeiten bezeichnete Schmitt später als „Dada avant-la-lettre“. Auch war er mit Hugo Ball und Franz Blei befreundet und bewunderte den mittlerweile vergessenen Dichter des politischen Katholizismus, Konrad Weiß. Gemeinsam mit Hugo Ball besuchte Schmitt den Dichter Hermann Hesse - ein Kontakt, der sich jedoch nicht aufrecht erhalten ließ. In Straßburg wurde Schmitt ein Jahr nach dem Assessor-Examen (1916) mit der Arbeit Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht und Staatstheorie habilitiert. Nach einer kurzen Lehrtätigkeit an der Handelshochschule in München folgte er 1921 in kurzen Abständen den Rufen nach Greifswald (1921), Bonn (1921), Berlin (Handelshochschule 1928), Köln (1933) und wieder Berlin (Friedrich-Wilhelms-Universität 1933 - 1945). Der Habilitation folgten in kurzem Abstand weitere Veröffentlichungen, etwa Politische Romantik (1919) oder Die Diktatur (1921).
In Bonn hatte Schmitt einige Kontakte zum Jungkatholizismus (er schrieb u.a. für Carl Muths Zeitschrift Hochland), die sich in einem verstärkten Interesse an kirchenrechtlichen Themen äußerten. Dieses Interesse schlug sich in Schriften wie Politische Theologie (1922) und Römischer Katholizismus und politische Form (1923, in zweiter Auflage mit kirchlichem Imprimatur) nieder. 1924 erschien Schmitts erste explizit politische Schrift mit dem Titel Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Im Jahre 1928 legte er sein bedeutendstes wissenschaftliches Werk vor, die Verfassungslehre, in der er die Weimarer Verfassung einer systematischen juristischen Analyse unterzog.
Im gleichen Jahr wechselte er an die Handelshochschule in Berlin, auch wenn das in Bezug auf seinen Status als Wissenschaftler einen Rückschritt bedeutete. Dafür konnte er im politischen Berlin zahlreiche Kontakte knüpfen, die bis in Regierungskreise hinein reichten. In Berlin entwickelte er gegen die herrschenden Ansichten die Theorie vom unantastbaren Wesenskern der Verfassung („Verfassungslehre“). Andererseits näherte er sich aber auch reaktionären Strömungen an, indem er Stellung gegen den Pluralismus und Parlamentarismus bezog und für einen „starken Staat“ eintrat. Dieser starke Staat solle auf einer „freien Wirtschaft“ basieren und sich im Sinne einer aktiven Entpolitisierung aus „nichtstaatlichen Sphären“ zurückziehen („Starker Staat und gesunde Wirtschaft. Ein Vortrag vor Wirtschaftsführern“, 1932). Hier traf sich Schmitts Vorstellung in vielen Punkten mit dem späteren Ordoliberalismus, zu deren Vorläufern Schmitt in dieser Zeit, vor allem in der Person Alexander Rüstows, Kontakte unterhielt. Als akademischer Hochschullehrer war Schmitt aufgrund seiner Kritik an der Weimarer Verfassung zunehmend umstritten. So wurde er etwa von Hans Kelsen und Hermann Heller scharf kritisiert. Die Weimarer Verfassung, so meinte Schmitt, schwäche den Staat durch einen „neutralisierenden“ Liberalismus und sei somit nicht fähig, die Probleme der aufkeimenden Massendemokratie zu lösen. Die Parlamentarische Demokratie hielt er für eine „veraltete bürgerliche Regierungsmethode“. In Berlin erschienen Der Begriff des Politischen (1928), Der Hüter der Verfassung (1931) und Legalität und Legitimität (1932). Die Kritik bürgerlicher Institutionen war es, die Schmitt in dieser Phase für junge sozialistische Juristen wie Ernst Fraenkel, Otto Kirchheimer und Franz L. Neumann interessant machte.
Ab 1930 plädierte Schmitt für eine autoritäre Präsidialdiktatur und pflegte enge Bekanntschaften zu politischen Kreisen, etwa dem späteren preußischen Finanzminister Johannes Popitz. Auch zur Reichsregierung selbst gewann er Kontakt, indem er enge Beziehungen zu Mittelsmännern des Generals, Ministers und späteren Kanzlers Kurt von Schleicher unterhielt. Schmitt stimmte sogar Publikationen und öffentliche Vorträge im Vorfeld mit den Mittelsmännern des Generals ab. Für die Regierungskreise waren einige seiner polisch-verfassungsrechtlichen Theoreme, etwa das des Reichspräsidenten als „Hüter der Verfassung“ (1931), von großem Interesse. Seine Schrift „Legalität und Legitimität“ wolle man, so der Schleicher-Vertraute Erich Marcks, „in kleiner Münze unters Volk bringen“. Trotz seiner Kritik an Pluralismus und Parlamentarischer Demokratie stand Schmitt vor der Machtergreifung 1933 den Umsturzbestrebungen von KPD und NSDAP gleichermaßen ablehnend gegenüber. Er unterstützte die Politik Schleichers, die darauf abzielte, das „Abenteuer Nationalsozialismus“ zu verhindern.
1932 war er auf einem vorläufigen Höhepunkt seiner politischen Ambitionen angelangt: Er vertrat die Reichsregierung unter Franz von Papen zusammen mit Carl Bilfinger und Erwin Jacobi in dem Prozess um den sogenannten Preußenschlag gegen die staatsstreichartig abgesetzte preußische Regierung Otto Braun vor dem Staatsgerichtshof.
Zeit des Nationalsozialismus
Nach dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 schwenkte Schmitt voll auf die Linie der neuen Machthaber um. Ob er dies aus Opportunismus oder Überzeugung tat, ist umstritten. Jedenfalls bezeichnete er das Ermächtigungsgesetz als „vorläufige Verfassung der deutschen Revolution“ und trat am 1. Mai 1933 als sog. „Märzgefallener“ in die NSDAP ein. 1933 wechselte er an die Universität Köln, wo sich binnen weniger Wochen die Wandlung in die Rolle eines Staatsrechtlers im Sinne der neuen nationalsozialistischen Herrschaft vollzog. Schmitt hatte bedeutenden Einfluss auf die Formulierung des Reichsstatthaltergesetzes und wurde zum Preußischen Staatsrat ernannt. Zudem wurde er Herausgeber der Deutschen Juristenzeitung (DJZ) und Mitglied der Akademie für Deutsches Recht. Er erhielt sowohl die Leitung der Gruppe der Universitätslehrer im NS-Juristenbund als auch die Fachgruppenleitung im NS-Rechtswahrerbund.
In seiner Schrift Staat, Bewegung, Volk: Die Dreigliederung der politischen Einheit (1933) betonte Schmitt die Legalität der „deutschen Revolution“: Die Machtübernahme Hitlers bewege sich „formal korrekt in Übereinstimmung mit der früheren Verfassung“, sie entstamme „Disziplin und deutschem Ordnungssinn.“ Außerdem betonte er, der Zentralbegriff des nationalsozialistischen Staatsrechts sei „Führertum“, unerlässliche Voraussetzung dafür rassische Gleichheit von Führer und Gefolge.
Der Führung der NSDAP stellte Schmitt eine rechtliche Legitimation aus, indem er die Rechtmäßigkeit der „nationalsozialistischen Revolution“ betonte. Aufgrund seines juristischen und verbalen Einsatzes für den Staat der NSDAP wurde er von Zeitgenossen, insbesondere von politischen Emigranten (Waldemar Gurian), als „Kronjurist“ des Dritten Reiches bezeichnet. Ob dies nicht eine Überschätzung seiner Rolle ist, wird in der Literatur allerdings kontrovers diskutiert.
Im Herbst 1933 wurde Schmitt aus „staatspolitischen Gründen“ an die Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin berufen und entwickelte dort die Lehre vom konkreten Ordnungsdenken. Damit konnte er seinen Ruf bei den neuen Machthabern weiter festigen.
In Reaktion auf die Morde des NS-Regimes vom 30. Juni 1934 im Zuge der Röhm-Affäre rechtfertigte Schmitt die Selbstermächtigung Hitlers mit den Worten: „Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft.“ Der wahre Führer sei immer auch Richter, aus dem Führertum fließe das Richtertum (Der Führer schützt das Recht, DJZ vom 1. August 1934, Heft 15, 39. Jahrgang, Spalten 945 - 950). Diese behauptete Konvergenz von „Führertum“ und „Richtertum“ gilt als Zeugnis einer tiefgreifenden Perversion des Rechtsdenkens. 1935 gesellte sich Schmitt endgültig öffentlich zu den Rassisten, als er die Nürnberger Rassengesetze von 1935 in selbst für nationalsozialistische Verhältnisse grotesken Stilisierung als „Verfassung der Freiheit“ bezeichnete (so der Titel eines Aufsatzes in der DJZ 40/1935). Mit dem „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“, das Beziehungen zwischen Juden und sogenannten Ariern unter Strafe stellte, begann für den Juristen eine neue Ära der Gesetzgebung: Es trete „ein neues weltanschauliches Prinzip in der Gesetzgebung“ auf. Diese „von dem Gedanken der Rasse getragene Gesetzgebung“ stoße auf die Gesetze anderer Länder, die ebenso grundsätzlich rassische Unterscheidungen nicht kennen oder sogar ablehnen würden (vgl. Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht, Bd. 3, 1936, S. 205). Dieses Aufeinandertreffen unterschiedlicher weltanschaulicher Prinzipien war für Schmitt Regelungsgegenstand des Völkerrechts. Höhepunkt der Schmittschen Parteipropaganda war die im Oktober 1936 unter seiner Leitung durchgeführte Tagung „Das Judentum in der Rechtswissenschaft“. Hier bekannte er sich ausdrücklich zum nationalsozialistischen Antisemitismus und forderte, jüdische Autoren in der juristischen Literatur nicht mehr zu zitieren oder jedenfalls als Juden zu kennzeichnen.
1936 wurde Schmitt seinerseits Ziel von Attacken aus dem der SS nahestehenden Parteiblatt Schwarzes Korps, das ihm seine frühere Unterstützung der Regierung Schleichers sowie Bekanntschaften zu Juden vorwarf. Es entstand ein Skandal, in dessen Folge Schmitt alle Ämter verlor. Er blieb jedoch bis zum Ende des Krieges Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin und behielt den Titel „Preußischer Staatsrat“ bei, der ihm viel bedeutete.
Bis zum Ende des Nationalsozialismus verlegte Schmitt den Schwerpunkt seiner Arbeiten auf das Völkerrecht, versuchte aber auch hier zum Stichwortgeber des Regimes zu avancieren. Das zeigt etwa sein 1939 entwickelter Begriff der „völkerrechtlichen Großraumordnung“, den er als deutsche Monroe-Doktrin verstand. Dies konnte als Versuch gewertet werden, die Expansionspolitik Hitlers völkerrechtlich zu fundieren.
Nach 1945
Nach der deutschen Kapitulation 1945 wurde Schmitt zeitweise verhaftet und in Nürnberg von Chef-Ankläger Robert M. W. Kempner verhört. Zu einer Anklage kam es jedoch nicht, weil eine Straftat im juristischen Sinne nicht festgestellt werden konnte: „Wegen was hätte ich den Mann anklagen können?“, begründete Kempner diesen Schritt später. „Er hat keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, keine Kriegsgefangenen getötet und keine Angriffskriege vorbereitet.“
Ende 1945 war Schmitt unter Wegfall jeglicher Versorgungsbezüge aus dem Staatsdienst entlassen worden und galt nun allgemein als unerwünschte Person. Um eine Professur bewarb er sich nicht mehr, dies wäre wohl auch aussichtslos gewesen. Stattdessen zog er sich nach Plettenberg zurück, wo er bereits weitere Veröffentlichungen, zunächst unter einem Pseudonym, vorzubereiten begann (etwa eine Rezension des Bonner Grundgesetzes als „Walter Haustein“, die in der Eisenbahnerzeitung erschien). Nach dem Kriege veröffentlichte Schmitt eine Reihe von Werken, u.a. Der Nomos der Erde, Theorie des Partisanen und Politische Theologie II, die aber nicht an seine Erfolge in der Weimarer Zeit anknüpfen konnten. 1952 konnte er sich eine Rente erstreiten, aus dem akademischen Leben blieb er aber ausgeschlossen. Eine Mitgliedschaft in der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer wurde ihm verwehrt.
Da Schmitt sich nie ausdrücklich von seinem Wirken im Dritten Reich distanzierte, blieb ihm zu Lebzeiten eine Rehabilitation, wie sie vielen anderen NS-Rechtstheoretikern zuteil wurde (zum Beispiel Karl Larenz, Theodor Maunz und Otto Koellreutter), versagt. Zwar litt er unter der Isolation, bemühte sich allerdings auch nie um eine Entnazifizierung. Zum Holocaust hatte er auch nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes nie ein Wort gefunden. Auch war er nach 1945 nicht von seinem Antisemitismus abgerückt, wie die postum publizierten Tagebuchaufzeichnungen (Glossarium) zeigen. Nicht zuletzt deshalb ließ die rabiate Unterstützung des Antisemitismus der NS-Ideologie erhebliche Zweifel an seiner intellektuellen Unbestechlichkeit aufkommen.
Denken
Probleme mit Schmitts Denken
Schmitt war nicht nur Antisemit und Nationalsozialist, er war auch ein Gegner des Pluralismus, Antiliberaler, Verächter des Parlamentarismus, Bewunderer des italienischen Faschismus, Gegner des Rechtsstaats und des Naturrechts und Neo-Absolutist im Gefolge eines Machiavelli und Thomas Hobbes. Seine Lehre lieferte Rechtfertigungen für nationalsozialistische Verbrechen. Für die Übernahme von Rassismus und nationalsozialistischer Blut-und-Boden-Mythologie musste er seine Theorie nur graduell modifizieren. Trotz problematischer Ideen wird Schmitt jedoch auch heutzutage ein originelles staatsphilosophisches Denken attestiert. Im Folgenden werden Konzepte des Schmittschen Denkens dargestellt, wobei die Verwendung durch den Nationalsozialismus in den Hintergrund rückt.
Schmitt als politischer Denker
Schmitts Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. Schmitt formuliert also einen Primat der Politik, keinen Primat des Rechts. Der Rechtsordnung, der durch das Recht gestalteten und definierten Ordnung, gehe also immer eine andere, nämlich staatliche Ordnung voraus. Es ist für Schmitt diese vor-rechtliche Ordnung, die es dem Recht erst ermöglicht, konkrete Wirklichkeit zu werden. Mit anderen Worten: Das Politische folgt einer konstitutiven Logik, das Juristische einer regulativen. Die Ordnung wird bei Schmitt durch den entscheidenden Souverän hergestellt, der unter Umständen zu ihrer Sicherung einen Gegner zum Feind erklären kann, den es zu bekämpfen, womöglich zu vernichten gilt. Um dies zu tun, könne der Souverän die Schranken beseitigen, die mit der Idee des Rechts gegeben sind.
Der Mensch ist für den Katholiken Schmitt nicht von Natur aus gut, sondern unbestimmt, fähig zum Guten wie zum Bösen. Damit wird er aber (zumindest potentiell) gefährlich und riskant. Weil der Mensch nicht vollkommen gut ist, kommt es zu Feindschaften. Politik ist für Schmitt dabei derjenige Bereich, in dem zwischen Freund und Feind unterschieden wird. Der Feind ist für ihn immer der öffentliche Feind (hostis bzw. πολέμιος), nie der private Feind (inimicus bzw. εχθρός). Die Aufforderung „Liebet eure Feinde“ aus der Bergpredigt (nach der Vulgata: diligite inimicos vestros, Matthäus 5,44 und Lukas 6,27) bezieht sich, wie Schmitt betont, auf den privaten Feind. In einem geordneten Staatswesen gibt es somit für ihn eigentlich keine Politik, sondern nur sekundäre Formen des Politischen (z. B. Polizei).
Politik ist bei Schmitt ein Intensitätsgrad der Assoziation und Dissoziation von Menschen („Die Unterscheidung von Freund und Feind hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen“). Diese dynamische, nicht auf ein Sachgebiet begrenzte Definition eröffnete eine neue theoretische Fundierung politischer Phänomene. Für Schmitt war diese Auffassung der Politik eine Art Grundlage seiner Rechtsphilosophie: Nur wenn die Intensität unterhalb der Schwelle der offenen Freund-Feind-Unterscheidung gehalten wird, besteht eine Ordnung. Im anderen Falle drohen Krieg oder Bürgerkrieg. Im Kriegsfall hat man es für Schmitt mit zwei souveränen Akteuren zu tun; der Bürgerkrieg stellt dagegen die innere Ordnung als solche in Frage. Eine Ordnung existiert für Schmitt immer nur vor dem Horizont ihrer radikalen Infragestellung. Die Freund-Feind-Erklärung ist dabei ausdrücklich immer an den extremen Ausnahmefall gebunden (extremis neccessitatis causa). Als Kritik an Schmitt wird aber formuliert, dass er selbst keinerlei Kriterien angibt, unter welchen Umständen ein Gegenüber als Feind zu beurteilen ist. Der (öffentliche) Feind ist somit derjenige, der per autoritativer Setzung zum Feind erklärt wird (in diesem Sinne ist Schmitt Vordenker des sog. Feindstrafrechts).
Dabei bewegt sich eine politische Daseinsform bei Schmitt ganz im Bereich des Existenziellen. Normative Urteile kann man über sie nicht fällen („Was als politische Größe existiert, ist, juristisch betrachtet, wert, dass es existiert“). Ein solcher Relativismus und Dezisionismus bindet eine politische Ordnung nicht an Werte wie Freiheit oder Gerechtigkeit, im Unterschied z.B. zu Montesquieu, sondern sieht den höchsten Wert axiomatisch im bloßen Vorhandensein dieser Ordnung selbst. Diese und weitere irrationalistische Ontologismen, etwa sein Glaube an einen Überlebenskampf zwischen den Völkern, machten Schmitt aufnahmefähig für die Begriffe und die Rhetorik der Nationalsozialisten. Hier wird die Grenze und Schwäche von Schmitts Begriffsbildung sichtbar.
Schmitts Rechtsphilosophie
Schmitt betonte selbst, er habe als Jurist eigentlich nur „zu Juristen und für Juristen“ geschrieben. Dabei legte er neben einer großen Zahl konkreter verfassungs- und völkerrechtlicher Gutachten auch eine Reihe systematischer Schriften vor, die jedoch immer sehr stark auf konkrete Situationen hin angelegt waren. Dennoch ist es möglich, aus der Vielzahl der Schriften und Aufsätze eine mehr oder weniger geschlossene Rechtsphilosophie herauszulesen. Dies ist erstmals von Norbert Campagna systematisch herausgearbeitet worden. Im Folgenden soll Schmitts Rechtsphilosophie am Beispiel des Öffentlichen Rechts und des Völkerrechts kurz dargestellt werden.
Schmitts rechtsphilosophisches Grundproblem ist das Denken des Rechts vor dem Hintergrund der Bedingungen seiner Möglichkeit. Das abstrakte Sollen setzt für Schmitt immer ein bestimmtes geordnetes Sein voraus, das ihm erst die Möglichkeit gibt, sich zu verwirklichen. Schmitt denkt also in genuin rechtssoziologischen Kategorien. Mit anderen Worten: Schmitt interessiert vor allem die immer gegebene Möglichkeit, dass Rechtsnormen und Rechtsverwirklichungsnormen auseinander fallen können. Es müssen also erst die Voraussetzungen geschaffen werden, die es den Rechtsgenossen ermöglichen, sich an die Rechtsnormen zu halten. Da die normale Situation aber für Schmitt immer fragil und gefährdet ist, kann die paradoxe Notwendigkeit eintreten, dass gegen Rechtsnormen verstoßen werden muss, um die Möglichkeit einer Geltung des Rechts (wieder) herzustellen. Damit erhebt sich für Schmitt die Frage, wie das Sollen sich im Sein ausdrücken kann, wie also aus dem gesollten Sein ein existierendes Sein werden kann.
Verfassung, Souveränität und Ausnahmezustand
Schmitt wirft den meisten Rechtsphilosophen, vor allem aber dem Liberalismus vor, das selbständige Problem der Rechtsverwirklichung zu ignorieren. Betrachte man die Rechtsverwirklichung als Grundproblem, stelle sich die Frage nach der Souveränität, nach dem Ausnahmezustand und nach dem Hüter der Verfassung. Souverän ist für Schmitt dabei diejenige staatliche Gewalt, die in letzter Instanz, also inappellabel entscheidet.
Schmitt entwickelt als erster nicht eine Staatslehre, sondern eine „Verfassungslehre“. Hier bezeichet er die Verfassung in ihrer positiven Substanz als „eine konkrete politische Entscheidung über Art und Form der politischen Existenz“. Diese grenzt er mit der Formel „Entscheidung aus dem normativen Nichts“ positivistisch gegen naturrechtliche Vorstellungen ab. Erst wenn der souveräne Verfassungsgeber bestimmte Inhalte als Kern der Verfassung hervorhebt, besitzt die Verfassung einen substanziellen Kern. Zum politischen Teil der modernen Verfassung gehören für Schmitt etwa die Entscheidung für die Republik, für die Demokratie, für die Bundesstaatlichkeit und für den Parlamentarismus, wohingegen die Entscheidung für die Grundrechte den juridischen Teil der Verfassung ausmacht. Der politische Teil konstituiert das Funktionieren des Staates, wohingegen der juristische Teil diesem Funktionieren Grenzen zieht. Eine Verfassung nach Schmitts Definition hat immer einen politischen Teil, nicht unbedingt aber einen juridischen. Damit Grundrechte überhaupt wirksam sein können, muss es für Schmitt zunächst einen Staat geben, dessen Macht sie begrenzen (womit Schmitt implizit den naturrechtlichen Gedanken universeller Menschenrechte, die jede Staatsform unabhängig von durch den Staat gesetztem Recht zu beachten hätte, verwirft). Damit setzt er sich einmal mehr in Widerpruch zum Liberalismus.
Durch die politische Verfassung, also die Entscheidung über Art und Form der Existenz, entsteht eine Ordnung, in der Normen wirksam werden können („Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre“). Im eigentlichen Sinne politisch ist eine Existenzform nur dann, wenn sie kollektiv ist, wenn also ein vom individuellen Gut eines jeden Mitglieds verschiedenes kollektives Gut im Vordergrund steht. In der Verfassung, so Schmitt, drückten sich immer bestimmte Werte aus, vor deren Hintergrund unbestimmte Rechtsbegriffe wie die „öffentliche Sicherheit“ erst ihren konkreten Inhalt erhielten. Die Normalität könne nur vor dem Hintergrund dieser Werte überhaupt definiert werden. Das wesentliche Element der Ordnung ist dabei für Schmitt die Homogenität als Übereinstimmung aller bezüglich der fundamentalen Entscheidung hinsichtlich des politischen Seins der Gemeinschaft. Dabei ist Schmitt bewusst, dass es illusorisch wäre, eine weitreichende gesellschaftliche Homogenität erreichen zu wollen. Er bezeichnet die absolute Homogenität daher als „idyllischen Fall“. Seit dem 19. Jahrhundert bestehe die Substanz der Gleichheit vor allem in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation. Da Homogenität in der modernen Demokratie aber nie völlig verwirklicht sei, also in den Worten Schmitts stets ein „Pluralismus“ partikularer Interessen vorliege, sei die Ordnung immer gefährdet. Die Kluft von Sein und Sollen könne jederzeit aufbrechen. Der für Schmitt zentrale Begriff der Homogenität ist also nicht originär ethnisch oder gar rassistisch gedacht, sondern vielmehr positivistisch: Die Nation verwirkliche sich in der Absicht, gemeinsam eine Ordnung zu bilden. Nach 1933 stellte Schmitt sein Konzept allerdings ausdrücklich auf den Begriff der Rasse ab.
Der Souverän schafft und garantiert in Schmitts Denken die Ordnung. Hierfür hat er das Monopol der letzten Entscheidung. Souveränität ist für Schmitt also juristisch von diesem Entscheidungsmonopol her zu definieren („Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“), nicht von einem Gewalt- oder Herrschaftsmonopol aus. Die im Ausnahmezustand getroffenen Entscheidungen (Verurteilungen, Notverordnungen etc.) ließen sich hinsichtlich ihrer Richtigkeit nicht anfechten („Dass es die zuständige Stelle war, die eine Entscheidung fällt, macht die Entscheidung […] unabhängig von der Richtigkeit ihres Inhaltes“). Souverän ist für Schmitt dabei immer derjenige, der den Bürgerkrieg vermeiden oder wirkungsvoll beenden kann.
Repräsentation, Demokratie und Homogenität
Der moderne Staat ist für Schmitt demokratisch legitimiert. Demokratie bedeutet für ihn dabei die Identität von Herrscher und Beherrschten, Regierenden und Regierten, Befehlenden und Gehorchenden. Zum Wesen der Demokratie gehört dabei die Gleichheit, die sich allerdings nur nach innen richtet und daher nicht die Bürger anderer Staaten umfasst. Innerhalb eines demokratischen Staatswesens sind alle Staatsangehörigen gleich. Demokratie als Staatsform setzt für Schmitt immer ein politisch geeintes Volk voraus. Die demokratische Gleichheit verweist für ihn damit auf eine Gleichartigkeit bzw. Homogenität (im Nationalsozialismus wurde diese Gleichartigkeit bei Schmitt zur Artgleichheit). Hinter den bloß partikularen Interessen muss es für Schmitt im Sinne Rousseaus eine volonté générale geben, also ein gemeinsames, von allen geteiltes Interesse. Diese Substanz der Einheit ist eher dem Gefühl als der Rationalität zugeordnet. Wo eine starke und bewusste Gleichartigkeit und damit die politische Aktionsfähigkeit fehlt, bedarf es für Schmitt der Repräsentation. Wo das Element der Repräsentation in einem Staat überwiege, nähere sich der Staat der Monarchie, wo das Element der Identität überwiege, nähere sich der Staat der Demokratie. In dem Moment, in dem in der Weimarer Republik der Bürgerkrieg als reale Gefahr am Horizont erschien, optierte Schmitt daher für einen souveränen Reichspräsidenten als Element der „echten Repräsentation“. Den Parlamentarismus bezeichnete Schmitt als „unechte Fassade“, der sich geistesgeschichtlich überholt habe. Das Parlament wurde für ihn zum Hort der Parteien und Partikularinteressen, wohingegen der demokratisch legitimierte Präsident die Einheit repräsentiert. Der Repräsentant der Einheit ist für Schmitt der Souverän und „Hüter der Verfassung“, also der Hüter der politischen Substanz der Einheit.
Diktatur, Legalität und Legitimität
Das Instrument, mit dem der Souverän die gestörte Ordnung wieder herstellt, ist für Schmitt die „Diktatur“, also – anders als im heutigen Sprachgebrauch – das Rechtsinstitut der Gefahrenabwehr. Eine solche Diktatur (verstanden in der altrömischen Grundbedeutung als Notstandsdiktatur zur Wiederherstellung der bedrohten Ordnung) ist für Schmitt zwar durch keine Rechtsnorm gebunden, trotzdem bildet das Recht immer ihren Horizont. Zwischen der Diktatur und der Rechtsidee besteht für Schmitt also nur ein relativer, kein absoluter Gegensatz. Die Diktatur, so Schmitt, sei ein bloßes Mittel, um einer gefährdeten Normalität wieder diejenige Stabilität zu verleihen, die für die Anwendung und die Wirksamkeit des Rechts erforderlich ist. Indem der Gegner sich nicht mehr an die Rechtsnorm hält, wird die Diktatur als reziproke Antwort erforderlich. Die Diktatur stellt somit die Verbindung zwischen Sein und Sollen (wieder) her, indem sie die Rechtsnorm vorübergehend suspendiert um die Rechtsverwirklichung zu ermöglichen. Damit fallen für Schmitt auch Legalität und Legitimität auseinander. Legal ist eine Handlung, wenn sie sich restlos unter eine allgemeine Norm des positiven Rechts subsumieren lässt. Die Legitimität hingegen ist für Schmitt nicht unbedingt an die Normen des positiven Rechts gebunden. Sie könne sich auch auf Prinzipien berufen, die dem positiven Recht übergeordnet sind (etwa das Lebensrecht des Staates oder die Staatsräson). Die Diktatur beruft sich somit auf die Legitimität. Sie ist nicht an positive Normierungen gebunden, sondern nur an die Substanz der Verfassung, also ihre Grundentscheidung über Art und Form der politischen Existenz. Damit muss sich die Diktatur für Schmitt selbst überflüssig machen, d.h. sie muss die Wirklichkeit so gestalten, dass der Rückgriff auf eine außerordentliche Gewalt überflüssig wird. Die Diktatur ist bei Vorliegen einer Verfassung also notwendig kommissarisch, da sie keinen anderen Zweck verfolgen kann, als die Verfassung wieder in Gültigkeit zu bringen. Der Diktator ist somit eine konstituierte Gewalt (pouvoir constitué), der sich nicht über den Willen der konstituierenden Gewalt (pouvoir constituant) hinwegsetzen kann. In Abgrenzung davon gibt es für Schmitt aber auch eine souveräne Diktatur, bei der der Diktator erst eine Situation herstellt, die sich aus seiner Sicht zu bewahren lohnt. Hier hatte Schmitt vor allem den souveränen Fürsten vor Augen. Dabei gilt aber: Souveräne Diktatur und Verfassung schließen sich aus.
Krieg, Feindschaft, Völkerrecht
Homogenität, die für Schmitt zum Wesenskern der Demokratie gehört, setzt auf einer höheren Ebene immer Heterogenität voraus. Einheit besteht immer nur in Abgrenzung zu einer Vielheit. Jedes sich demokratisch organisierende Volk kann dies folglich nur im Gegensatz zu einem anderen Volk vollziehen. Es existiert für dieses Denken also immer ein „Pluriversum“ verschiedener Völker und Staaten. Wie das staatliche Recht, so setzt für Schmitt auch das internationale Recht („Völkerrecht“) eine konkrete Ordnung voraus. Diese konkrete Ordnung war seit dem Westfälischen Frieden von 1648 die internationale Staatenordnung. Diese Ordnung garantierte eine bestimmte internationale Rechtsordnung. Da Schmitt den Untergang dieser Staatenordnung konstatiert, stellt sich für ihn jedoch die Frage nach einem neuen konkreten Sein internationaler Rechtssubjekte, das eine seinswirkliche Grundlage für eine internationale Rechtsordnung garantieren könne.
Historisch wurde laut Schmitt eine solche Ordnung immer durch Kriege souveräner Staaten hergestellt, die ihre politische Idee als Ordnungsfaktor im Kampf gegen andere durchsetzen wollten. Erst wenn die Ordnungsansprüche an eine Grenze gestoßen sind, etabliere sich in einem Friedensschluss ein stabiles Pluriversum, also eine internationale Ordnung („Sinn jedes nicht sinnlosen Krieges besteht darin, zu einem Friedensschluss zu führen“). Es muss erst eine als normal angesehene Teilung des Raumes gegeben sein, damit es zu einer wirksamen internationalen Rechtsordnung kommen kann.
Durch ihre politische Andersartigkeit sind die pluralen Gemeinwesen füreinander immer potentielle Feinde, solange keine globale Ordnung hergestellt îst. Wichtig ist für Schmitt jedoch, dass hier an einem eingeschränkten Feindbegriff festgehalten wird, der noch Platz für die Idee des Rechts lässt. Denn nur mit einem Gegenüber, der als (potentieller) Gegner und nicht als absoluter Feind betrachtet wird, sei ein Friedensschluss möglich. Hier stellt sich die Frage nach der „Hegung des Krieges“. Das ethische Minimum der Rechtsidee ist für Schmitt dabei das Prinzip der Gegenseitigkeit. Dieses Element dürfe in einem Krieg niemals wegfallen, das heißt, es müssten auch dem Feind im Krieg immer dieselben Rechte zuerkannt werden, die man für sich selbst in Anspruch nimmt.
Schmitt unterscheidet hier folgende Formen der Feindschaft: konventionelle Feindschaft, wirkliche Feindschaft und absolute Feindschaft. Zur absoluten Feindschaft komme es paradoxerweise etwa dann, wenn sich eine Partei den Kampf für den Humanismus auf ihre Fahne geschrieben habe. Denn wer zum Wohle oder gar zur Rettung der gesamten Menschheit kämpfe, müsse seinen Gegner als Feind dieser gesamten Menschheit betrachten und damit zum Unmenschen deklarieren (daher sagt Schmitt in Abwandlung von Proudhon: „Wer Menschheit sagt, will betrügen“).
Der konventionelle Krieg ist für Schmitt ein gehegter Krieg (ius in bello). Hier führen Staaten und ihre regulären Armeen Krieg, sonst niemand. Auf diesem Prinzip basieren für Schmitt auch die nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossenen vier Genfer Konventionen, da sie eine souveräne Staatlichkeit zugrunde legen. Schmitt würdigt diese Konventionen als „Werk der Humanität“, stellt aber zugleich fest, dass sie von einer Wirklichkeit ausgingen, die als solche nicht mehr existiere. Daher könnten sie ihre eigentliche Funktion, eine wirksame Hegung des Krieges zu ermöglichen, nicht mehr erfüllen. Denn mit dem Verschwinden des zugrundeliegenden Seins habe auch das Sollen keine Grundlage mehr.
Den Gedanken, dass Frieden nur durch Krieg möglich ist, da nur der echte Friedensschluss nach einem Krieg eine konkrete Ordnung herbeiführen kann, formulierte Schmitt zuerst im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit dem Ausgang des Ersten Weltkrieges. Nur auf der Grundlage dieses Gedankens wird auch verständlich, wie Schmitt die provozierende Alternative: „Frieden oder Pazifismus“ proklamieren konnte. Als Beispiel für einen Friedensschluss, der keine neue Ordnung im Sinne eines Friedensschlusses brachte, betrachtete Schmitt nämlich den Versailler Vertrag und den Genfer Völkerbund von 1920. Der Völkerbund führte für Schmitt nur die Situation des Krieges fort und erschien ihm wie eine Fortsetzung dieses Krieges mit anderen Mitteln: „In Wahrheit hat die Genfer Kombination den Namen eines Bundes, einer Sozietät oder Liga im Sinne einer politischen Vereinigung nur insofern verdient, als sie den Versuch machte, die Weltkriegskoalition fortzusetzen und darin auch die im Weltkrieg neutralen Staaten einzubeziehen.“ („Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar - Genf - Versailles“, 1940, S. 240). Konkret stand Schmitt, der zu der Zeit in Bonn lehrte, die Besetzung der Rheinlande durch französische und belgische Truppen im Januar 1923 vor Augen, als beide Länder auf einen Streit um die Höhe der deutschen Reparationen mit einer Besetzung reagierten, sich damit eine Schlüsselstellung in Bezug auf die noch unbesetzten Teile des Ruhrgebiets sowie die wichtigsten Handelszentren verschafften und dies mit der Sicherung der „Heiligkeit der Verträge“ begründeten. Dies erschien Schmitt als die ideologische Verschleierung handfester Interessenpolitik. Eine solche Juridifizierung der Politik, die nur die Machtansprüche der starken Staaten bemäntelt, sah er als Hauptgefahr für den Frieden an. In seinen Augen führte sie zu einer Art verdeckter Fortsetzung des Krieges, die durch den gewollten Mangel an Sichtbarkeit des Feindes zu einer Steigerung der Feindschaft im Sinne des absoluten Feindbegriffs und letztlich zu einem diskriminierenden Kriegsbegriff führen würde. Eine konkrete Ordnung werde durch einen solchen „unechten“ Frieden jedenfalls nicht geschaffen. Statt einer Ordnung entsteht die Fassade einer Ordnung, hinter der die politischen Ziele changieren: „Im übrigen fehlt [dem Völkerbund] jeder konstruktive Gedanke, jede Gemeinschaftssubstanz, daher auch jede politische Folgerichtigkeit und jede Identität und Kontinuität im rechtlichen Sinne. Der politische Inhalt des Genfer Völkerbundes hat oft gewechselt, und die unter Beibehaltung derselben Etikette weitergeführte Genfer Veranstaltung hat sich [bis 1936] mindestens sechsmal in ein politisches und daher auch völkerrechtliches aliud verwandelt.“ (Ebd.)
Auflösung der internationalen Ordnung: Großraum und Partisan
Schmitt diagnostiziert ein Ende der Staatlichkeit („Die Epoche der Staatlichkeit geht zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu verlieren“). Das Verschwinden der Ordnung souveräner Staatlichkeit sieht Schmitt in folgenden Faktoren: Erstens lösten sich die Staaten auf, es entstünden neuartige Subjekte internationalen Rechts; zweitens sei der Krieg ubiquitär - also allgegenwärtig und allverfügbar - geworden und habe damit seinen konventionellen und gehegten Charakter verloren.
An die Stelle des Staates treten für Schmitt mit der Monroe-Doktrin 1823 neuartige „Großräume“ mit einem Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Hier habe man es mit neuen Rechtssubjekten zu tun: Die USA zum Beispiel seien seit der Monroe-Doktrin kein gewöhnlicher Staat mehr, sondern eine führende und tragende Macht, deren politische Idee in ihren Großraum, nämlich die westliche Hemisphäre ausstrahle. Damit ergebe sich eine Einteilung der Erde in mehrere durch ihre geschichtliche, wirtschaftliche und kulturelle Substanz erfüllte Großräume. Den seit 1938 entwickelten Begriff des Großraums füllte Schmitt 1941 nationalsozialistisch; die politische Idee des deutschen Reiches sei die Idee der „Achtung jedes Volkes als einer durch Art und Ursprung, Blut und Boden bestimmte Lebenswirklichkeit“. An die Stelle eines Pluriversums von Staaten tritt für Schmitt also ein Pluriversum von Großräumen.
Gleichzeitig geht den Staaten, so Schmitts Analyse, das Monopol der Kriegsführung (ius ad bellum) verloren. Es träten neue, nichtstaatliche Kombattanten hervor, die als kriegsführende Parteien aufträten. Im Zentrum dieser neuen Art von Kriegsführung sieht Schmitt Menschen, die sich total mit dem Ziel ihrer Gruppe identifizieren und daher keine einhegenden Grenzen für die Verwirklichung dieser Ziele kennen. Sie sind bereit Unbeteiligte, Unschuldige, ja sogar sich selbst zu opfern. Hier werde die Sphäre der Totalität betreten und damit auch der Boden der absoluten Feindschaft. Hier hat man es mit dem Partisanen zu tun, der sich für Schmitt durch vier Merkmale auszeichnet: Irregularität, starkes politisches Engagement, Mobilität und „tellurischer Charakter“ (womit Schmitt Ortsgebundenheit meint). Der Partisan sei nicht mehr als regulärer Kombattant erkennbar, er trage keine Uniform, er verwische bewusst den Unterschied zwischen Kämpfern und Zivilisten, der für das Kriegsrecht konstitutiv sei. Durch sein starkes politisches Engagement unterscheide sich der Partisan vom Piraten. Dem Partisan gehe es in erster Linie darum, für politische Ziele zu kämpfen, mit denen er sich restlos identifiziere. Der lateinische Ursprung des Wortes Partisan sei, was oft vergessen werde, „Anhänger einer Partei“.
Der Partisan sei durch seine Irregularität hochgradig mobil. Anders als stehende Heere könne er rasch und unerwartet zuschlagen und sich ebenso schnell zurückziehen. Er agiere nicht hierarchisch und zentral, sondern dezentral und in Netzwerken. Sein tellurischer Charakter, also seine Ortsgebundenheit zeige sich darin, dass der Partisan sich an einen konkreten Ort gebunden fühle, den er verteidige. Der verortete oder ortsgebundene Partisan führe primär einen Verteidigungskrieg. Dieses letzte Merkmal beginnt der Partisan für Schmitt aber zu verlieren. Der Partisan (oder, wie man heute vielleicht eher sagen würde, der Terrorist) werde zu einem „Werkzeug einer mächtigen Weltpolitik treibenden Zentrale, die ihn im offenen oder im unsichtbaren Krieg einsetzt und nach Lage der Dinge wieder abschaltet“.
Während der konventionelle Feind im Sinne des gehegten Krieges einen bestimmten Aspekt innerhalb eines von allen Seiten akzeptierten Rahmens in Frage stellt, stelle der wirkliche Feind den Rahmen als solchen in Frage. Der nicht mehr ortsgebundene Partisan stelle die Form der absoluten Feindschaft dar und markiere somit auch den Übergang zu einem totalen Krieg. Für Schmitt erfolgte der Übergang vom autochthonen zum weltaggressiven Partisan historisch mit Lenin. Es gehe in den neuen Kriegen, die von der absoluten Feindschaft der Partisanen geprägt seien, nicht mehr darum, neue Gebiete zu erobern, sondern eine Existenzform wegen ihrer angeblichen Unwertigkeit zu vernichten. Aus einer kontingent definierten Feindschaft werde eine ontologisch oder intrinsisch bestimmte. Mit einem solchen Feind sei kein gehegter Krieg und auch kein Friedensschluss mehr möglich. Schmitt nennt das im Unterschied zum paritätisch geführten Krieg den diskriminierend geführten Krieg. Der diskriminierende Kriegsbegriff bricht mit der Reziprozität und beurteilt den Feind in Kategorien des Gerechten und Ungerechten. Werde der Feindbegriff in einem solchen Sinne total, werde die Sphäre des Politischen verlassen und die des Theologischen betreten, also die Sphäre der letzten, nicht mehr verhandelbaren Unterscheidung. Der Feindbegriff des Politischen ist für Schmitt ein durch die Idee des Rechts begrenzter Begriff. Es sei aber gerade die Abwesenheit einer ethischen Bestimmung des Kriegsziels, die eine Hegung des Krieges erst ermögliche, weil ethische Postulate, da sie grundsätzlich nicht verhandelbar sind, zur „theologischen Sphäre“ gehörten.
Der Nomos der Erde
Nach dem Wegfall der Ordnung des Westfälischen Friedens stellt sich für Schmitt die Frage nach einer neuen seinsmäßigen Ordnung, die das Fundament eines abstrakten Sollens werden kann. Für ihn ist dabei klar, dass es keine „One World Order“ geben kann. Die Entstaatlichung der internationalen Ordnung dürfe nicht in einen Universalismus münden. Für Schmitt ist allein eine Welt der Großräume mit Interventionsverbot für andere Großmächte in der Lage, die durch die Westfälische Ordnung garantierte Hegung des Krieges zu ersetzen.
Er konstruiert einen „Nomos der Erde“, der - analog zur souveränen Entscheidung - erst die Bedingungen der Normalität schafft, die für die Verwirklichung des Rechts notwendig sind. Somit ist dieser Nomos der Erde für Schmitt die Grundlage für jede völkerrechtliche Legalität. Für ihn wird ein wirksames Völkerrecht immer durch eine solche konkrete Ordnung begründet, niemals durch bloße Verträge. Sobald auch nur ein Element der Gesamtordnung diese Ordnung in Frage stelle, sei die Ordnung als solche in Gefahr.
Der erste Nomos war für Schmitt lokal, er betraf nur den europäischen Kontinent. Nach der Entdeckung Amerikas sei der Nomos global geworden, da er sich nun auf die ganze Welt ausgedehnt habe. Für den neuen Nomos der Erde, der sich für Schmitt noch nicht herausgebildet hat, sieht die Schmittsche Theorie drei prinzipielle Möglichkeiten: a) eine alles beherrschende Macht unterwirft sich alle Mächte, b) der Nomos, in dem sich souveräne Staaten gegenseitig akzeptieren, wird wiederbelebt, c) der Raum wird zu einem neuartigen Pluriversum von Großmächten.
Die zweite Variante hält Schmitt zumindest für unwahrscheinlich. Die erste Variante lehnt er entschieden ab („Recht durch Frieden ist sinnvoll und anständig; Friede durch Recht ist imperialistischer Herrschaftsanspruch“). Für ihn darf es nicht sein, dass „egoistische Mächte“, womit er vor allem die Vereinigten Staaten im Blick hat, die Welt unter ihre Machtinteressen stellen. Das Ius belli dürfe nicht zum Vorrecht einer einzigen Macht werden, sonst höre das Völkerrecht auf, paritätisch und universell zu sein. Somit bleibt für Schmitt nur das Pluriversum einiger weniger Großräume. Dazu ist allerdings in der Konsequenz des Schmittschen Denkens ein globaler Krieg die Voraussetzung, der den neuen Nomos der Erde begründet.
Wirkung
Nach 1945 war Schmitt wegen seines Engagements für das „Dritte Reich“ akademisch und publizistisch isoliert. Er wurde neben Ernst Jünger, Arnold Gehlen, Hans Freyer und Martin Heidegger als zentrale intellektuelle Stütze des NS-Regimes gesehen. Dennoch hatte er zahlreiche Schüler, die das juristische Denken der frühen Bundesrepublik mitprägten, obwohl sie teilweise selbst belastet waren. Dazu gehören u.a. Ernst Rudolf Huber, Ernst Forsthoff, Werner Weber, Roman Schnur, Ernst Friesenhahn, aber auch der als Kanzlerberater bekannt gewordene politische Publizist Rüdiger Altmann oder der einflussreiche Journalist Johannes Gross. Auch jüngere Verfassungsjuristen wie Ernst-Wolfgang Böckenförde oder Josef Isensee wurden nachhaltig von Carl Schmitt beeinflusst.
Heute erlebt sein Werk in der politischen Wissenschaft und Publizistik teilweise eine Renaissance, etwa wenn über seinen Einfluss auf die amerikanischen Neokonservativen diskutiert oder der bewaffnete Terrorismus als „Partisanenstrategie“ analysiert wird. Zuletzt wurde auch das Werk Giorgio Agambens kontrovers diskutiert, das sich neben Michel Foucault und Walter Benjamin in zentralen Elementen auf Carl Schmitt und dessen Theorie des Ausnahmezustands stützt. Weitere Beispiele sind etwa der teilweise ähnlich wie Schmitt argumentierende Samuel P. Huntington („Clash of Civilizations“) oder die Globalisierungskritiker Michael Hardt und Antonio Negri, deren Empire – Die neue Weltordnung entscheidend von Schmittschen Analysewerkzeugen profitiert. Auch die neuesten Theorien Herfried Münklers zu „asymmetrischen Kriegen“ und zum „Imperium“ knüpfen an Thesen von Carl Schmitt an. Ein weiteres Beispiel wäre Agambens Guantanamo-Kritik, in der er betont, die Gefangenen würden als „irreguläre Kombattanten“ „außerhalb der internationalen Ordnung der zivilisierten Welt gestellt“ (hors la loi, wie Schmitt sagen würde).
Die Verwendung von Schmittschen Kategorien durch marxistische Theoretiker wie Hardt und Negri ist daher nur auf den ersten Blick überraschend, knüpft sie doch an die frühe Rezeption Schmitts durch linke Theoretiker wie Benjamin, Fraenkel und Kirchheimer an. Vor allem die Interventionspolitik der Vereinigten Staaten (siehe etwa Irak-Krieg) oder die Rolle der Vereinten Nationen als eine Art „Weltregierung“ werden häufig unter Rückgriff auf Schmittsche Theoreme kritisiert. Teilweise wird Schmitts Kritik am Völkerbund auf die USA übertragen und den Vereinigten Staaten eine ökonomische Interessenpolitik unter dem Schleier demokratischer Ziele unterstellt. Andererseits kann sich auch die Kritik an mit Natur- oder Menschenrechten begründeten Interventionen auf Schmitt berufen, indem "absolute Feindschaft" bzw. "Tyrannei der Werte" im Sinne Schmitts konstatiert wird, die das Prinzip der Gegenseitigkeit im Völkerrecht aufhebt.
Die Demaskierung bürgerlicher Strukturen als (ökonomische) Interessenpolitik ist ein Punkt, der auch für Rechte interessant ist. Dazu kommen Schmitts Optionen für den Ausnahmezustand und die Diktatur zur Wahrung der politischen Ordnung, auch unter Verletzung des positiven Rechts. Daher stoßen Schmitts Werke auch heute noch auf ein reges Interesse in rechtskonservativen und neurechten Kreisen (ebenso bei der Nouvelle Droite in Frankreich).
Einige der von Schmitt geprägten Termini ("Verfassungswirklichkeit", "Formelkompromiss") sind in den allgemeinen politischen Sprachgebrauch übergegangen, ohne dass noch direkt auf Schmitt Bezug genommen würde. Die Übernahme ist wohl begründet durch Schmitts Orientierung an der Rechtsverwirklichung, aber auch durch seine große Bedeutung für die Staatsrechtler der frühen Bundesrepublik.
Werke
Gesamtes Werkverzeichnis:
- Alain de Benoist: Carl Schmitt. Bibliographie seiner Schriften und Korrespondenzen, Berlin 2003, ISBN 3-0500-3839-X
Literatur
Biographie
- Paul Noack: Carl Schmitt. Eine Biographie, Berlin 1993, ISBN 3-54835581-1
- Hans-Christof Kraus: Carl Schmitt (1988-1985), in: Michael Fröhlich (Hg.): Die Weimarer Republik. Porträt einer Epoche in Biographien, Darmstadt 2002, ISBN 3-89678441-2, S. 326-337
- Gopal Balakrishnan: The Enemy. An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, New York 2002, ISBN 185984359-X
- Hasso Hofmann: Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, 4. Aufl. Berlin 2002, ISBN 3-42810386-6
- Helmut Quaritsch (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, ISBN 3-42806378-3
Werk
- Norbert Campagna: Carl Schmitt. Eine Einführung, Berlin 2004, ISBN 3-93726200-8
- Reinhard Mehring: Carl Schmitt zur Einführung, Hamburg 2001, ISBN 3-88506332-8
- Helmut Quaritsch: Positionen und Begriffe Carl Schmitts, Berlin 1995, ISBN 3-42808257-5
Einzelne Aspekte
Politische Theorie
- Reinhard Mehring (Hrsg.): Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen. Ein kooperativer Kommentar, Berlin 2003, ISBN 3-05003687-7
- Heinrich Meier: Carl Schmitt, Leo Strauss und 'Der Begriff des Politischen'. Zu einem Dialog unter Abwesenden, 2. Aufl. Stuttgart 1998, ISBN 3-47601602-1
- David Dyzenhaus: Law As Politics. Carl Schmitt's Critique of Liberalism, Durham & London 1998, ISBN 0-82232244-7
- Heinrich Meier: Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie, 2. Aufl. Stuttgart/Weimar 2004, ISBN 3-47602052-5
Weimarer Republik
- David Dyzenhaus: Legality and Legitimacy. Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar, Oxford 2000, ISBN 0-19829846-3
- Ellen Kennedy: Constitutional Failure. Carl Schmitt in Weimar, Durham 2004, ISBN 0-82233243-4
- Lutz Berthold: Carl Schmitt und der Staatsnotstandsplan am Ende der Weimarer Republik, Berlin 1999, ISBN 3-42809988-5
- Gabriel Seiberth: Anwalt des Reiches. Carl Schmitt und der Prozess 'Preußen contra Reich' vor dem Staatsgerichtshof, Berlin 2001, ISBN 3-42810444-7
Drittes Reich
- Joseph W. Bendersky: Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton, New Jersey 1983, ISBN 0-69105380-4
- Andreas Koenen: Der Fall Carl Schmitt, Darmstadt 1995, ISBN 3-53412302-6
- Dirk Blasius: Carl Schmitt. Preußischer Staatsrat in Hitlers Reich, Göttingen 2001, ISBN 3-525-36248-X
- Bernd Rüthers: Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, München 1988, ISBN 3-40632999-3
- Bernd Rüthers, Carl Schmitt im Dritten Reich, 2. Aufl., München 1990
- Felix Blindow: Carl Schmitts Reichsordnung, Berlin 1999, ISBN 3-05003405-X
- Helmut Quaritsch: Carl Schmitt. Antworten in Nürnberg, Berlin 2000, ISBN 3-42810075-1
- Raphael Gross: Carl Schmitt und die Juden, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-51829354-0
Bundesrepublik
- Dirk van Laak: Gespräche in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin 1993, ISBN 3-05003744-X
- Jan-Werner Müller: A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven 2003, ISBN 0-300-09932-0
Weblinks
- Vorlage:PND
- Winfried Gebhardt: Carl Schmitt, Staatsrechtslehrer. Geschichte, Biografie & Werk, 1995. Aus: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
- Albrecht v. Arnswaldt, Carl Schmitt (Biographie), 2001 (PDF)
- Prof. Dr. Hermann Avenarius, Carl Schmitt - Leben und Werk, 2004
- Biografie beim LeMO
- Alexander Proelß: Nationalsozialistische Baupläne für das europäische Haus? John Laughland's "The Tainted Source" vor dem Hintergrund der Großraumtheorie Carl Schmitts, in Forum historiae iuris, Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte 2003
- Hugo Velarde, Die Grenzen des Ausnahmezustands, Freitag, Nr. 26, 1.7.2005
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Schmitt, Carl |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Staatsrechtler und Philosoph |
| GEBURTSDATUM | 11. Juli 1888 |
| GEBURTSORT | Plettenberg, Westfalen, Deutschland |
| STERBEDATUM | 7. April 1985 |
| STERBEORT | Plettenberg-Pasel, Westfalen, Deutschland |