Wikipedia:Auskunft
Du konntest eine Information in Wikipedia trotz Benutzung der Suchfunktion der Wikipedia, einer Suchmaschine und des Archivs dieser Seite (Suchfeld unten) nicht finden? Dann beantworten Wikipedianer auf dieser Seite allgemeine Wissensfragen.
Bedenke dabei bitte:
- So manche Antwort auf eine Frage ist im Internet per Suchmaschine schneller gefunden, als die Frage hier gestellt und beantwortet werden kann.
- Die Auskunft ist kein Diskussionsforum. Daher ist auch nicht die Ausbreitung von Meinungen oder eigenen Theorien das Ziel, sondern die Verbreitung von belegbarem Wissen.
Für viele Anliegen gibt es spezielle Seiten:
- Café für Diskussionen über beliebige Themen.
- Fragen von Neulingen für Fragen zur Mitarbeit in der Wikipedia.
- Fragen zur Wikipedia für Fragen zur Bedienung der Wikipedia.
- Die Kurzanleitung erklärt, wie du eine Frage stellst.
- Die Fragen werden ausschließlich auf dieser Seite beantwortet, nicht per E-Mail usw. Daher bitte keine persönlichen Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, Mail) hinterlassen.
- Wenn deine Frage ausreichend beantwortet wurde oder du eine Lösung gefunden hast, lass es uns wissen.
- Für alle entsprechenden Fragen gelten die Hinweise zu Gesundheitsthemen, Rechtsthemen und Rechtsauskunft sowie zum Pilzesammeln.
- Du weißt die Antwort oder kennst wenigstens Hinweise darauf? Dann antworte so kurz wie möglich, so lang wie nötig, mit Links auf Wikipedia-Artikel oder andere Quellen, die zum Verständnis beitragen.
- Wenn die Antwort noch nicht in der Wikipedia steht und relevant ist, vervollständige bitte die Artikel zum Thema und verlinke hier auf die entsprechenden Passagen. Sollte eine Ergänzung nicht ohne Weiteres möglich sein (z. B. weil entsprechende Belege fehlen oder es sich bei dem Geäußerten hauptsächlich um persönliche Ansichten der Autoren handelt), setze bitte einen entsprechenden Hinweis auf die Diskussionsseite der betreffenden Artikel. Die Auskunft soll nämlich auch helfen, die Artikel der Wikipedia zu verbessern.
- Bitte rücke deine Antwort mit Doppelpunkt(en) am Zeilenanfang passend ein!
Abschnitte, die älter als 3 Tage oder seit einem Tag mit dem Baustein {{Erledigt|1=~~~~}} gekennzeichnet sind, werden automatisch archiviert. Möglicherweise findest du auch im Archiv die Antwort auf deine Frage. (Gesamtarchiv • letzte Woche). Eine Sammlung von häufig gestellten Fragen findest du auf der FAQ-Unterseite.
Fehler bei Vorlage (Vorlage:Autoarchiv-Erledigt): Bei "Zeigen=Nein" können die Parameter Übersicht, aktuelles Archiv und Icon nicht angegeben werden.
23. Dezember 2015
Klimawandel?
Angenommen ich bin Republikaner und kenn mich in Europa/Deutschland zu dieser Jahreszeit gut aus: hätte ich eine Chance mir das aktuelle Wetter als "kommt hin und wieder so vor" zu erklären?
Oder anders: ist das nicht scheiße warm für diese Jahreszeit und war das in den letzten Jahren jemals so krass? Und was ist mit dem versiegenden Golfstrom? --Amtiss, SNAFU ? 09:16, 23. Dez. 2015 (CET)
- google:wärmster+dezember+deutschland. --195.36.120.126 09:29, 23. Dez. 2015 (CET)
- Am 24.Dezember 1977 (!) hatte es in Berlin 16°C. Zu Zeiten der Römer wurde im heutigen GB nicht nur Wein angebaut sondern sogar Oliven!. Vor 15.000 Jahren war die Erwärmung viel heftiger. Das Klima ist ein Auf und Ab im 600-Jahres-Rhythmus. Kein Grund zur Panik. Allerdings lieben die Medien leider Superlative. --Heletz (Diskussion) 09:38, 23. Dez. 2015 (CET)
- Nahezu 100% der Klimatologen sehen das anders als du (die Minderheit besteht aus Freier-Markt-Ideologen). Aber du hast dafür sicher auch eine Ausrede, also tu ruhig so, als wär nix. --Hob (Diskussion) 09:46, 23. Dez. 2015 (CET)
- Leider habe ich nicht verstanden, was mein VP meint. --Heletz (Diskussion) 09:48, 23. Dez. 2015 (CET)
- Aus dem Kontext schließe ich, dass mit VP ich gemeint sein könnte, auch wenn ich nicht dein Vizepräsident bin.
- Was du schreibst - Herauspicken eines einzelnen Datenpunktes (ein Tag, eine Stadt) als Gegenargument zu monatlichen kontinentalen Mittelwerten; war schon mal schlimmer; 600-Jahre-Rhythmus; kein Grund zur Panik; Medien lieben Superlative - ist alles Standard-Rhetorik der Klimawandelleugner. Und die stehen in krassen Gegensatz zu dem, was die echten Klimatologen sagen. --Hob (Diskussion) 10:03, 23. Dez. 2015 (CET)
- In dem oben verlinkten Artikel der "Welt" ist ein Bild des Neumagener Weinschiffs mit der Bildunterschrift "Bis in die nördlichen Provinzen des Imperiums wurde Wein angebaut und mit ihm Handel getrieben". Als würde Neumagen in England liegen. --Berthold Werner (Diskussion) 10:10, 23. Dez. 2015 (CET)
- Dann solltest du dich mal über die Geschichte der Weinherstellung in England informieren. ;) War nicht ganz so erfolgreich, aber zum Teil hats geklappt. --2A02:2028:830:501:6420:6450:A9AF:6055 10:29, 23. Dez. 2015 (CET)
- Das wollte ich auch nicht in Zweifel ziehen, aber das Bild passt nicht! --Berthold Werner (Diskussion) 11:13, 23. Dez. 2015 (CET)
- Dann solltest du dich mal über die Geschichte der Weinherstellung in England informieren. ;) War nicht ganz so erfolgreich, aber zum Teil hats geklappt. --2A02:2028:830:501:6420:6450:A9AF:6055 10:29, 23. Dez. 2015 (CET)
- Leider habe ich nicht verstanden, was mein VP meint. --Heletz (Diskussion) 09:48, 23. Dez. 2015 (CET)
- Nahezu 100% der Klimatologen sehen das anders als du (die Minderheit besteht aus Freier-Markt-Ideologen). Aber du hast dafür sicher auch eine Ausrede, also tu ruhig so, als wär nix. --Hob (Diskussion) 09:46, 23. Dez. 2015 (CET)
- Am 24.Dezember 1977 (!) hatte es in Berlin 16°C. Zu Zeiten der Römer wurde im heutigen GB nicht nur Wein angebaut sondern sogar Oliven!. Vor 15.000 Jahren war die Erwärmung viel heftiger. Das Klima ist ein Auf und Ab im 600-Jahres-Rhythmus. Kein Grund zur Panik. Allerdings lieben die Medien leider Superlative. --Heletz (Diskussion) 09:38, 23. Dez. 2015 (CET)
- @IP: Mittlerweile sind wir wieder so weit: Sogar im Yorkshire gibt es mittlerweile einen Weinberg – und das obwohl es heute viel einfacher und billiger ist Wein aus südlicheren Gefilden zu importieren als vor 2000 Jahren, als man wohl oder übel bestrebt war die Dinge des täglichen Bedarfs möglichst vor der eigenen Haustür zu erzeugen. // Martin K. (Diskussion) 11:58, 23. Dez. 2015 (CET)
- Das mit der heftigeren Erwärmung vor 15.000 Jahren ist ebenfalls falsch. Damals waren es 5°... aber in 5000 Jahren, nicht mehrere Grad in einem Jahrhundert. [1] --Eike (Diskussion) 10:57, 23. Dez. 2015 (CET)
Aus dem Artikel der Welt geht klar hervor, daß eine Erwärmung in 50 Jahren um 10°C vor 11.000 Jahren kein Problem war. --Heletz (Diskussion) 11:00, 23. Dez. 2015 (CET)
- Du hast jetzt gesehen, dass deine Behauptung, "Vor 15.000 Jahren war die Erwärmung viel heftiger.", Unsinn war?
- Und wie ging es eigentlich den Menschen in Thailand, Kambodscha, Pakistan, Tuvalu, ... mit der Erwärmung vor 11.000 Jahren, die deines Erachtens "kein Problem war"?
- --Eike (Diskussion) 11:30, 23. Dez. 2015 (CET)
- (BK) In der Qeulle steht nichts von "kein Problem". Da steht auch nicht, wo diese Zahlen 50, 10 und 11.000 herkommen. Ich informiere mich jedenfalls lieber bei den Klimatologen selber, zum Beispiel in Eikes Link oben, als aus zweiter oder dritter Hand bei konservativen Blättern, wo die Zahlen vom Himmel fallen. --Hob (Diskussion) 11:33, 23. Dez. 2015 (CET)
Danke, viele meiner Fragen haben sich damit geklärt. Das hier habe ich auch noch gefunden: Zeitreihe der Lufttemperatur in Deutschland.--Amtiss, SNAFU ? 11:03, 23. Dez. 2015 (CET)
Für das Leben auf der Erde an sich besteht keine Gefahr, siehe auch Paläozän/Eozän Thermales Maximum. Aber natürlich besteht die Gefahr des Aussterbens für viele aktuell lebende Arten, und für uns würden die ganzen Küstenstädte und einige Inselstaaten untergehen. Außerdem leugnen die Klimawandel-Skeptiker/Leugner nicht die Tatsache eines Klimawandels, sondern oft die Tatsache, dass er anthropogen ist, also salopp: dass wir schuld sind.
Dass Klimawandel "kein Problem" sei, wurde nie behauptet. Es ist aber dennoch keine Panikmache derart angebracht, dass bei einem (auch heftigen) Klimawandel das Leben auf der Erde gefährdet wäre. Wir wollen halt alles so erhalten, wie es ist, und deswegen wird vermutlich oft mehr Panikmache betrieben als angebracht ist. --ObersterGenosse (Diskussion) 11:55, 23. Dez. 2015 (CET)
- mit Hinblick auf "das Leben" hast Du sicher Recht, die Änderungen, die zu den großen Aussterbewellen der Geschichte führten, waren sicher deutlich gravierender, und das Leben an sich hat es offensichtlich überlebt. In Hinblick auf menschliches Leben, gar auf einem Lebensstandard der Industriestaaten wäre ich mir da nicht so sicher: ich sehe die Diskussion eher anders rum: aus der Prämisse "Wir dürfen keinen Klimawandel haben, der ein Problem darstellt" --> folglich lege ich mir die Fakten so zurecht wie sie mir selber passen und stelle dass dann als Tatsachen hin. - andy_king50 (Diskussion) 12:05, 23. Dez. 2015 (CET)
- Vielleicht sollte man an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir als Menschheit leider nicht mehr in der glücklichen Lage sind, uns einfach aussuchen zu können, wo wir auf diesem Planeten leben wollen. Die Weltbevölkerung besteht nicht mehr aus ein paar hundert Millionen Menschen (wie noch im Mittelalter) sondern aus über sieben Milliarden! Während man früher bei klimatischen Problemen einfach seine sieben Sachen packen und wo anders sein Glück suchen konnte (was natürlich auch nicht ohne Verwerfungen abging), leben heute wo anders eben auch schon viele Menschen. Wir haben unseren Planeten mittlerweile resoursenmäßig so ausgereizt, dass wir ein echtes Problem bekommen, wenn klimabedingt auch nur Teile davon wegbrechen. Der Klimawandel ist also in erster Linien ein Problem für uns selbst – dem Planeten als solchem ist das egal, der hat schon ganz anderes mitgemacht und wird auch noch ganz anderes mitmachen. // Martin K. (Diskussion) 12:15, 23. Dez. 2015 (CET)
Die Sache mit den Oliven in England hat mich jetzt mal interessiert. Das geht wohl auf Tacitus zurueck, Agricola 12. Latein heisst es da: Solum praeter oleam vitemque et cetera calidioribus terris oriri sueta patiens frugum pecudumque fecundum (Deutsche und englische Uebersetzung). Demnach gibt der englische Boden das gerade nicht her, siehe auch hier. Dieser Autor (S. 178) gesteht die grundsaetzliche Moeglichkeit zu, dass Oliven in England wachsen koennen, aber ansatzweise auch zu Zeit der Verfassung des Buches (1902!). Es ist halt nie so einfach, wie man es gern haette. --Wrongfilter ... 12:01, 23. Dez. 2015 (CET)
- Niemals, Never. Kein Anbau nördlich der Poebene. vgl. doi:10.1016/j.ecolmodel.2008.06.024 doi:10.1111/geb.12061 Nach den Daten wäre das atlantische Westfrankreich bei weiterer Erwärmung denkbar, England bei ca +4,5 °C zu heute.--Meloe (Diskussion) 00:06, 24. Dez. 2015 (CET)
Der aktuelle Winter ist allerdings nicht wegen des Klimawandels so warm. Tatsächlich, Anzeichen für Klimawandel wäre eher ein zu kalter Winter, zumindest den geläufigen Modellen zufolge, die in unseren Breiten "heißere Sommer, kältere Winter, und regnerischere Frühlinge" voraussagen. Zu warm im Winter (im Sinne von "kalte Jahreszeit") wird es hingegen um die beiden Pole herum.--Alexmagnus Fragen? 12:07, 23. Dez. 2015 (CET)
- @Heletz Die Frage ist nur, wie glaubwürdig der Welt-Artikel ist. So behauptet der Autor etwa: "Aus Nürnberg wurde im Jahr 1022 berichtet: " ... dass viel Leut umb Nürnberg auff den Strassen vor großer Hitz verschmachtet und ersticket, auch sein viel Brunen vor großer Hitz versieget." Das kann aber m. E. nicht im Jahre 1022 geschrieben worden sein, da das allenfalls aus frühneuhochdeutscher Zeit stammt. Lustigerweise findet sich das gerade als Beleg in dem Buch "Der Klimaschwindel: Erderwärmung, Treibhauseffekt, Klimawandel - die Fakten" von Kurt Blüchel, auch hier wird natürlich das Jahr 1022 angegeben. Als Quelle stößt man dann auf Rüdiger Glaser, Klimageschichte Mitteleuropas, 2001; S. 61, angeblich ist diese Aussage im Stadtarchiv Nürnberg zu finden. Wenn, dann kann das aber nur eine spätere Aufzeichnung sein. Oder wir haben es mit einem sensationellen Fund zu tun, da hier bereits die neuhochdeutsche Diphthongierung vollständig graphisch realisiert ist (um nur ein Beispiel herauszugreifen): "Leut", "auff" (laut Paul, Mhd. Gr., § 42, S. 68 setzt solch eine Schreibung - natürlich noch unvollständig - erst um 1100 in südbairischen Schriften ein (Südtirol, Kärnten), in Ostfranken [also das Sprachgebiet, in dem Nürnberg liegt] sei sie erst ab dem 13. Jh. zu finden, "seit Anfang des 15 Jhs. vollständig", vgl. auch die Karte in Hartweg/Wegera, Frühneuhochdeutsch, S. 135, wo 14. Jh. für Nürnberg angegeben wird). Um das mal zu illustrieren, zitiere ich das Memento mori von Noker von Zwiefalten, entstanden um 1070 (also 50 Jahre nach dieser angeblichen Aufzeichnung): "Nu denchent, wib unde man,|war ir sulint werdan. ir minnont tisa brodemi|unde wanint iemer hie sin." Selbst das Ezzolied, von Günther von Bamberg in Auftrag gegeben, der ja in der Nähe von Nürnberg lebte, weicht noch erstaunlich deutlich von dem angeblichen Nürnberger Eintrag ab, obwohl das Lied um 1100 entstanden ist: "Der guote biscoph Guntere vone Babenberch, / der hiez machen ein vil guot werch: / er hiez die sine phaphen / ein guot liet machen. / eines liedes si begunden, / want si di buoch chunden. / Ezzo begunde scriben, / Wille vant die wise. / duo er die wise duo gewan, / duo ilten si sich alle munechen. / von ewen zuo den ewen / got gnade ir aller sele." Interessanterweise finden sich in beiden Überlieferungen noch gar keine Diphthonge (tuiveles, uf, Hus), die uns der Nürnberger Eintrag hier präsentiert (ganz abgesehen von anderen Phänomenen, die quasi die Sprachgeschichte umkrempeln, z. B. der Konsonantendoppelung in "auff", die Schreibung "viel" - also ein Dehnungs-e, das sich im Oberdeutschen erst im 17. Jh. durchsetzt [Hartweg/Wegera, Frühneuhochdeutsch, S. 128], die Schreibung <sch> in "verschmachtet" setzt erst im 13./14. Jh. im Alemanischen ein [Hartweg/Wegera, Frühneuhochdeutsch, S. 144], mhd. wäre das versmaht, und die Apokope in "Leut" - früheste Zeugnisse für das Ostfränkische laut Paul, Mhd. Gr., S. 80, § 53, um 1300).
- Kurz: Ich bezweifele sehr stark, daß es sich hier um eine Quelle aus dem 11. Jh. handelt. Da stellt sich dann mithin die Frage, wie gründlich der Autor alle anderen Fakten recherchiert hat.--IP-Los (Diskussion) 12:15, 23. Dez. 2015 (CET)
- Entweder handelt es sich bei der Wiedergabe des Zitates um eine graduelle Angleichung an neuere Schreibweisen, oder um einen nachträglichen Bericht aus späterer Zeit. Laut der von Rüdiger Glaser initiierten Datenbank https://www.tambora.org/index.php?r=research/search/index stammt der Eintrag zu 1022 aus einem Schriftstück Kalte und warme Winter und Sommer auch Jahrszeiten zu Neroberg; Ungewitter und Erdbebungen zu Neroberg ab dem Jahr 34 mit der Signatur "Hiss 187", die vermutlich zum Staatsarchiv Nürnberg gehört, Rosenkohl (Diskussion) 21:31, 23. Dez. 2015 (CET)
- Kein vernünftiger Mensch bezweifelt den Klimawandel. allerdings ist bisher noch völlig unklar, wie hoch der menschliche Anteil daran sein soll. Da reicht die Spanne von0% bis 100%. Und 100% schließe ich schonmal aus, da auch Ronald D. gerste in seinem Buche - wie auch der Artikel der Welt und andere - einen klimawandel hin zu wärmeren zeit als einen unter mehreren Gründen für die Expansion des Imperium Romanum benennt. --Heletz (Diskussion) 15:43, 23. Dez. 2015 (CET)
- Nun ja klar wissen wir nicht genau wieviel Anteil der Mensch an der aktuellen Klimaerwährung hat. Aber er hat Anteil, dass ist der Punkt um den es hier eigtlicgh gehen sollte. Denn es ist der einzige Punkt denn der Mensch selber beeinflusssen kann. Die Verstärkung der Sonnenaktivität und was sonst noch als Klima erwährmend ins Feld geführt wird, kann er nicht beeinflusse. Wir Wissen das es Triebhausgasse gibt, und das wir selber welche Produzieren (Und zwar nicht gerade wenig). Also Unwissenheit wird uns eine zukünftige Generation zimlich sicher nicht abnehmen. Ich möchte aber gerne, dass diese zumindest sagen kann „sie habens versucht“ und nicht „sie wussten es, und haben nichts gemacht“. So gesehen ist es sowas von egal, ob der menschliche Anteil jetzt 20% oder 50% oder 80% der akteullen Klimaerwährung ist. Wir solten denn Anteil den wir beeiflussen können beobachten, und danach so handeln das dieser Anteil einen möglichst kleine Erwährmung auslösst. Und uns nicht auf denn Anteil konzetrieren, bei dem wir das nicht können. --Bobo11 (Diskussion) 16:24, 23. Dez. 2015 (CET)
- Kein vernünftiger Mensch bezweifelt den Klimawandel. allerdings ist bisher noch völlig unklar, wie hoch der menschliche Anteil daran sein soll. Da reicht die Spanne von0% bis 100%. Und 100% schließe ich schonmal aus, da auch Ronald D. gerste in seinem Buche - wie auch der Artikel der Welt und andere - einen klimawandel hin zu wärmeren zeit als einen unter mehreren Gründen für die Expansion des Imperium Romanum benennt. --Heletz (Diskussion) 15:43, 23. Dez. 2015 (CET)
- Mittelalterlicher Weinbau in England ist belegt, Oliven wären schon heftig. Bei der Mittelalterlichen Warmperiode wie auch der regionalen Klimageschichte hier sind die grundlegenden Arbeiten von Alfred Thomas Grove und seine Frau Jean regelrecht ignoriert worden, leider. Erwärmung war und ist für Europa auf jeden Fall besser als Abkühlung. Beim hiesigen Weinbau - Folgen der globalen Erwärmung für den Weinbau ist die KLimaveränderung schon deutlich zu spüren. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 16:38, 23. Dez. 2015 (CET)
Communis opinio dürfte inzwischen die Erleichterung der Ausbreitung des Imperium Romanum durch eine Warmzeit sein, wie auch in diesem Beispiel zu lesen ist. --Heletz (Diskussion) 17:29, 23. Dez. 2015 (CET)
Wenn "das aktuelle Wetter" (Zitat aus der Frage) gerade wieder einmal - wie so oft - genau anders herum wäre ("Es ist dies doch der kälteste Monat X seit Y Jahren, wie passt das denn bitteschön zum angeblichen Klimawandel..."), dann wäre zu Recht schon längst der übliche Hinweis gekommen auf den Unterschied zwischen Wetter und Klima. --Heldenzeuger (Diskussion) 20:38, 23. Dez. 2015 (CET)
- "kommt hin und wieder so vor" ist sicher immer richtig und genauso nichtssagend, denn da ist keine Aussage dahinter "wie oft" es so kommt. 2006/2007 ist mir als letzter sehr warmer Winter in Erinnerung (bei mir in Bayern).--Antemister (Diskussion) 22:01, 23. Dez. 2015 (CET)
- @Rosenkohl Eine graduelle Angleichung würde ich ausschließen, da das auch die Grammatik betreffen müßte. Dann würde man außerdem nicht "auff" schreiben (<ff> deutet auf 15. - 18. Jh., wäre also weder im 11. Jh. zeitgemäß gewesen noch wäre es das heute). Vorstellbar wäre allenfalls eine Übersetzung z. B. eines lateinischen Textes. Nur wäre das dann schon aus zweiter Hand. Schaut man sich das ganze Zitat an, dann scheint es aus dem 17./18. Jh. zu stammen (siehe z. B. die Großschreibung). Dann stellte sich die Frage, wie das Original lautet.--IP-Los (Diskussion) 22:10, 23. Dez. 2015 (CET)
- In den 70er Jahren fürchtete man eine Eiszeit und fragte sich, ob es gelingen würde, genügend CO2 zu produzieren um das zu verhindern. --Heletz (Diskussion) 23:49, 23. Dez. 2015 (CET)
- @Rosenkohl Eine graduelle Angleichung würde ich ausschließen, da das auch die Grammatik betreffen müßte. Dann würde man außerdem nicht "auff" schreiben (<ff> deutet auf 15. - 18. Jh., wäre also weder im 11. Jh. zeitgemäß gewesen noch wäre es das heute). Vorstellbar wäre allenfalls eine Übersetzung z. B. eines lateinischen Textes. Nur wäre das dann schon aus zweiter Hand. Schaut man sich das ganze Zitat an, dann scheint es aus dem 17./18. Jh. zu stammen (siehe z. B. die Großschreibung). Dann stellte sich die Frage, wie das Original lautet.--IP-Los (Diskussion) 22:10, 23. Dez. 2015 (CET)
- Gore-Effekt macht alles klar. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 00:14, 24. Dez. 2015 (CET)
- Der Golfstrom ändert immer mal wieder seine Strömung, erreicht er mal die Nordsee nicht, vereist Skandinavien und dies führte in der Spätantike zu Völkerwanderungen. Als Wikinger um die Jahrtausendwende ihr Heimat verließen und in Grönland (Grünland) siedelten, wird dort der Golfstrom vorbei geströmt sein und für das milde Klima gesorgt haben. Schon nach relativ kurzer Zeit änderte der Strom wieder seine Richtung und die Grönlandwikinger siedelten sich dann auf dem nun ergrünten Island (Eisland) an, was sie zuvor wegen der Vereisung bei der Siedlungssuche links liegen gelassen haben. Der nächste Winter kommt bestimmt!--Markoz (Diskussion) 00:36, 24. Dez. 2015 (CET)
- Hm, also, der letzte Satz stimmt. Für die anderen Sätze ruhig mal unter Island#Geschichte oder Grönland#Geschichte nachgucken.--Optimum (Diskussion) 02:10, 24. Dez. 2015 (CET)
Die Behauptung, der Klimawandel habe mit der Industrialisierung ab 1850 zu tun, kann nicht stimmen, die Mittelalterliche Warmzeit sollte inzwischen jedem bekannt sein.--Heletz (Diskussion) 10:05, 24. Dez. 2015 (CET)
- Was inzwischen bekannt sein sollte, iist die aktuelle, seriöse Klimaforschung. Ich schlage vor, da etwas nachzulesen, bevor hier solche sich selbst disqualifizierenden Einwürfe kommen.--Meloe (Diskussion) 11:00, 24. Dez. 2015 (CET)
- Die Eingangsfrage hat natürlich nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern ist eine temporäre Erscheinung, bekannt unter dem Namen Weihnachtstauwetter (was bekanntlich mit dem Wendekreis der Sonne resp. mit dem Monsun zu tun hat, wie man im Schulfach Erdkunde gelernt haben sollte). Grüne Weihnachten überwiegen mit 70%, auch in Bayern, wie man hier nachlesen kann. --Heletz (Diskussion) 11:08, 24. Dez. 2015 (CET)
- kommt drauf an: Das ist eben der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Jede ungewöhnliche Wetterlage kann jede Menge Gründe haben, natürliche und menschengemachte und jede Kombination der beiden. Aber: Die Statistik macht´s. Je mehr sich das Wetter längerfristig ändert, umso mehr deutet es auf eine auch langfristige Verschiebung, d.h. Klimawandel, hin. Jedes dieser Ereignisse, für sich betrachtet, hat unbekannte Ursachen, aber, dass die in der Häufung rein zufällig wären, wird mit jedem von ihnen ein wenig unwahrscheinlicher. Woher das Klima kommt, kann man an mechanistischen Modellen recht brauchbar simulieren (d.h. , man gibt oben die Daten zur solaren Einstrahlung, Atmosphärenchemie usw. ein und bekommt unten die Klimaprognose raus. Stimmt diese mit dem tatsächlichen Klima überein, stimmt´s wohl). Woher das Wetter kommt, kann niemand modellieren und länger als ca. 3 Tage vorhersagen. Das ist wie mit Rauchen und Lungenkrebs. Der Zusammenhang ist statistisch bombenfest, aber: jeder einzelne Krebs könnte natürlich auch andere Ursachen gehabt haben.--Meloe (Diskussion) 11:53, 24. Dez. 2015 (CET)
- Ich hatte das Ehepaar Grove schon erwähnt, dessen Forschung zur regionalen Klimata in der Frühzeit des IPCC Berichte regelrecht weggedrückt wurde. Jean Mary Clark Grove starb 2001, was den Hansens und Co auch gelegen kam. Es gibt nicht nur einen Unterschied zwischen Wetter und Klima, der Vorrang des globalen Klimas (und der zugehörige Begriff) ist vergleichsweise neu und hat mit dem durch Satelliten und Raumfahrt bedingten Blick auf die Blue Marble, unseren PLaneten als Ganzes zu tun. Vorher waren Klimaklassifikationen betont regional. Sprich ich widerspreche Meloe keineswegs, was den aktuellen Stand des Forschungmainstreams angeht - der blendet aber regionale Klimaaspekte aus, sprich den Bereich der politisch ist. Das ist der wesentliche Grund wieso der IPCC politisch so wenig Durchschlagskraft hat. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 13:52, 24. Dez. 2015 (CET)
Menschen leben in Regionen in denen es -40 bis +40 Grad hat. Ein, zwei Grad inner halb von einigen Jahrzehnten irgendwo mehr? Für unsere Spezies komplett irrelevant. Wir passen uns an so was problemlos an. (Nicht das bei ein zwei Grad mehr große Anpassungen erforderlich wären) Für eventuelle sonstige Umweltauswirkungen die damit einher gehen gibt es ein Zeug das nennt sich "Technologie". Damit können wir sogar temporär auf dem Mond oder ein paar tausend Meter tief im Ozean überleben. Sollte es tatsächlich irgendwo ein Volk auf dem Planeten geben das 200 Jahre lang traurig den sehr sehr langsam steigenden Meeresspiegel anglotzt ohne auf die Idee kommen einen oder zwei Meter Damm aufzuschütten und deshalb untergeht dann können wir das unter natürlicher Selektion verbuchen. --2003:66:8932:2DB:F17C:54B1:68D8:118E 12:25, 24. Dez. 2015 (CET)
Die alltagswissensmäßige Einschätzung der IP gibts auch als Doi: Scientific predictions that the average temperature may rise two to three degrees Celsius over the course of the next 50 years do not appear overly threatening to North Americans who often experience far larger swings in temperature over the course of a single day. Das sollte erklären, wieso der Republikaner, auch derjenige, der wie ich Donald Trump für das Äquivalent von Dieter Bohlen als Kanzlerkandidat hält, mit der großen Klimawandelpanik nicht gar so viel anfangen kann oder muss. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 14:05, 24. Dez. 2015 (CET)
- Die These, der Klimawandel sei nicht von den Menschen erzeugt und zu verantworten ist eine Erfindung der US-Ölkonzerne, um ihre Absatzmärkte zu verteidigen und einen Paradigmenwechsel in der Energieproduktion hin zu umweltgerechten erneuerbaren Energien zu unterlaufen. Dazu haben sie Politiker, Wissenschaftler und Journalisten gekauft und dem Prozess, dem Klimawandel entgegenzusteuern, wertvolle Jahrzehnte gestohlen. Das ist eigentlich schon alles. Wenn sich (bis auf die republikanischen Dumpfbacken) fast alle einig sind (weil es mittlerweile eben auch unübersehbar ist), dass es einen Klimawandel mit katastrophalen Folgen gibt, spielt die Frage, wer es war, nur eine Rolle hinsichtlich des „Weiter-so“, sprich ob wir nicht weiterhin CO2 rauszuhauen sollten wie die Blöden, weil wir es ja nicht sind sondern die böse böse Natur. Unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln wird das alles egal sein. Sie werden uns insgesamt hassen, wenn sie in den alten Filmen sehen, wie wir (und mit was für hirnrissigen Behauptungen) ihre Zukunft zugrunde gerichtet haben. Ich bin alt und spüre als Aktivist meine persönlichen Schranken immer deutlicher, aber Westeuropa ist (noch) reich und bis ich in 10 oder 15 Jahren den Löffel abgebe kann mir das Ganze eigentlich recht gleichgültig sein und die Zipperlein des Alters werden mich mehr beschäftigen. Ich wünsche normalerweise niemand was Schlechtes, aber beim Thema Klimawandel hoffe ich nur (gerade auch, weil es mich so anwidert), dass die Verharmloser und verantwortungslosen Kleinredner, die entpolitisierten Indifferenten und Sich-selbst-in-die eigene-Tasche-Lügner noch möglichst jung sind und den ganzen Mist knüppelhart abbekommen, den sie mitzuverantworten haben. Dass es nicht so bleibt wie es ist und auch nicht besser werden wird steht jetzt schon fest. --2003:45:4640:6300:5D3:4E18:27BC:8D3D 21:42, 24. Dez. 2015 (CET)
- Für was kämpft man eigentlich so als Aktivist, wenn die komplette Regierung sowie die komplette Presse auf der eigenen Seite steht? Verdoppelung der Windmühlenanzahl? Gesamtbedeckung der Landfläche mit Photovoltaik Anlagen? Oder Komplettrodung des Urwaldes zur Biodieselproduktion? (Ich vermute übrigens das auf jeder Klimakonferenz mehrere Scharfschützen auf der Lauer liegen, die den Befehl haben sofort denjenigen zu erlegen der die nahe liegenste Komplettlösung des Problems erwähnt) --2003:66:8932:2DB:F17C:54B1:68D8:118E 23:04, 24. Dez. 2015 (CET)
- Aha, ein getroffener Hund. Dein Wort oben von der „natürlichen Selektion“ charakterisiert deine Geisteshaltung ja überdeutlich. --2003:45:4640:6300:5D3:4E18:27BC:8D3D 23:29, 24. Dez. 2015 (CET)
- Meine Geisteshaltung nennt sich Realismus :) Während der Grüne an sich einer Weltuntergangsreligion mit wechselnden Parametern sowie Wetterzauberei anhängt. Hatten wir schon beim Waldsterben und all den anderen Weltuntergangsszenarien die dann irgendwie doch nicht eingetroffen und am Ende durch "kollektives Schweigen der Medien zu dem Blödsinn den Sie vorher verbreitet haben" gelöst wurden. --2003:66:8932:2DB:ACB4:C438:CA1F:12DD 09:27, 25. Dez. 2015 (CET)
- Deine Geisteshaltung erkennt man daran, wie unbedacht du mit dem Wort Selektion umgehst. In einem Szenario, in dem du ein ganzes Volk umkommen läßt, weil sie nicht "einen oder zwei Meter Damm" aufschütten. Ich sehe das nicht als Realismus sondern als zynische Unmenschlichkeit. Abgesehen davon, dass der Anstieg des Meeresspiegels nur eines von vielen Problemen ist, die aus der Klimaerwärmung resultieren. Allen voran die Erwärmung der Meere, die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Nahrungsmittelproduktion, das Auftauen des Permafrosts und die Erosion des Gesteins in den Hochgebirgen (vgl. auch hier). --2003:45:463C:B800:F127:4C7A:3F10:D3F1 14:52, 25. Dez. 2015 (CET)
- Tja das ist doch immer die Argumentation? Die armen Wilden ersaufen wenn wir keine Windmühlen bauen. Wenn der Meeresspiegel pro Jahr um einen Zentimeter steigt, dann geht der heere Naturschützer doch offensichtlich davon aus das die Wilden so kreuzdämlich sind das Sie es nicht mal schaffen pro Jahr einen einzigen Zentimeter Damm aufzuschütten. Und die "Erosion des Gesteins in den Hochgebirgen". Auch das sollte nicht über Nacht passieren. Sind jetzt also auch noch die Bergbewohner zu blöde über Jahrzehnte hinweg einen Lawinenschutz zu bauen? Wir bauen also Windmühlen weil wir annehmen das außer uns einfach zu furchtbar dämlich sind um von selbst eine Erwärmung von zwei Grad zu überleben. Da ist doch mal wirklich offensichtlich wer hier die fragwürdige Geisteshaltung hat. :) --2003:66:8932:2DB:BC7B:8C7F:E2CD:C013 17:45, 25. Dez. 2015 (CET)
- Du gehst von der Annahme aus, dass Meeressspiegel auch lokal kontinuierlich steigen und nicht um einen Mittelwert herum schwanken, der wiederum kontinuierlich ansteigt. Diese Annahme ist falsch. Klimawandelleugner haben ja generell ein Verständnisproblem, was den Unterschied zwischen aktuellen Werten und langfristigen Mittelwerten angeht, und verwenden die Temperatur eines bestimmten Tages an einem bestimmten Ort als Argument gegen eine langfristige Erwärmung.
- Natürlich kann sich ein Anstieg des Meeresspiegels darin äußern, dass Sturmfluten weiter ins Landesinnere eindringen, vor allem wenn ein Land so flach ist wie Bangladesh. Und dann ersaufen Leute, die viele Kilometer von der Küste entfernt leben, nicht weil sie "zu blöd sind, Dämme zu bauen", sondern weil die westlichen Regierungen so blöd sind, dass sie auf Leute wie dich hören. --Hob (Diskussion) 09:01, 26. Dez. 2015 (CET)
- Was redest du denn da für ein seltsames Zeug. Es gibt inzwischen keinen Platz mehr in Deutschland von dem aus man weniger als 10 Windmühlen im Blick hat. Welche Regierung hört denn genau auf "Leute wie mich"??? Würde die Regierung auf "Leute wie mich" hören würde der Strom nur ein Drittel kosten und wir hätten anstatt 40 tausend neuer Windmühlen vier neue moderne Atomkraftwerke. Du brauchst nur zum Fenster raus sehen um zu erkennen das du mit der Ansicht das "westlichen Regierungen so blöd sind, dass sie auf Leute wie dich hören" vollkommen halluzinierst. --2003:66:894A:3C93:870:D2A1:A595:5C6A 10:57, 27. Dez. 2015 (CET)
- Es gab etliche heftige Klimawandelleugner unter den westlichen Regierungschefs, die sich bei vernünftigen Maßnahmen quergelegt haben. Da das Klima auf Maßnahmen nicht sofort reagiert, sind natürlich auch in der Zukunft noch die Haltungen von Leugnern wie George W. Bush, Stephen Harper und Tony Abbott relevant. --Hob (Diskussion) 14:45, 27. Dez. 2015 (CET)
- Was redest du denn da für ein seltsames Zeug. Es gibt inzwischen keinen Platz mehr in Deutschland von dem aus man weniger als 10 Windmühlen im Blick hat. Welche Regierung hört denn genau auf "Leute wie mich"??? Würde die Regierung auf "Leute wie mich" hören würde der Strom nur ein Drittel kosten und wir hätten anstatt 40 tausend neuer Windmühlen vier neue moderne Atomkraftwerke. Du brauchst nur zum Fenster raus sehen um zu erkennen das du mit der Ansicht das "westlichen Regierungen so blöd sind, dass sie auf Leute wie dich hören" vollkommen halluzinierst. --2003:66:894A:3C93:870:D2A1:A595:5C6A 10:57, 27. Dez. 2015 (CET)
- Tja das ist doch immer die Argumentation? Die armen Wilden ersaufen wenn wir keine Windmühlen bauen. Wenn der Meeresspiegel pro Jahr um einen Zentimeter steigt, dann geht der heere Naturschützer doch offensichtlich davon aus das die Wilden so kreuzdämlich sind das Sie es nicht mal schaffen pro Jahr einen einzigen Zentimeter Damm aufzuschütten. Und die "Erosion des Gesteins in den Hochgebirgen". Auch das sollte nicht über Nacht passieren. Sind jetzt also auch noch die Bergbewohner zu blöde über Jahrzehnte hinweg einen Lawinenschutz zu bauen? Wir bauen also Windmühlen weil wir annehmen das außer uns einfach zu furchtbar dämlich sind um von selbst eine Erwärmung von zwei Grad zu überleben. Da ist doch mal wirklich offensichtlich wer hier die fragwürdige Geisteshaltung hat. :) --2003:66:8932:2DB:BC7B:8C7F:E2CD:C013 17:45, 25. Dez. 2015 (CET)
- Deine Geisteshaltung erkennt man daran, wie unbedacht du mit dem Wort Selektion umgehst. In einem Szenario, in dem du ein ganzes Volk umkommen läßt, weil sie nicht "einen oder zwei Meter Damm" aufschütten. Ich sehe das nicht als Realismus sondern als zynische Unmenschlichkeit. Abgesehen davon, dass der Anstieg des Meeresspiegels nur eines von vielen Problemen ist, die aus der Klimaerwärmung resultieren. Allen voran die Erwärmung der Meere, die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Nahrungsmittelproduktion, das Auftauen des Permafrosts und die Erosion des Gesteins in den Hochgebirgen (vgl. auch hier). --2003:45:463C:B800:F127:4C7A:3F10:D3F1 14:52, 25. Dez. 2015 (CET)
- Meine Geisteshaltung nennt sich Realismus :) Während der Grüne an sich einer Weltuntergangsreligion mit wechselnden Parametern sowie Wetterzauberei anhängt. Hatten wir schon beim Waldsterben und all den anderen Weltuntergangsszenarien die dann irgendwie doch nicht eingetroffen und am Ende durch "kollektives Schweigen der Medien zu dem Blödsinn den Sie vorher verbreitet haben" gelöst wurden. --2003:66:8932:2DB:ACB4:C438:CA1F:12DD 09:27, 25. Dez. 2015 (CET)
- Aha, ein getroffener Hund. Dein Wort oben von der „natürlichen Selektion“ charakterisiert deine Geisteshaltung ja überdeutlich. --2003:45:4640:6300:5D3:4E18:27BC:8D3D 23:29, 24. Dez. 2015 (CET)
- Für was kämpft man eigentlich so als Aktivist, wenn die komplette Regierung sowie die komplette Presse auf der eigenen Seite steht? Verdoppelung der Windmühlenanzahl? Gesamtbedeckung der Landfläche mit Photovoltaik Anlagen? Oder Komplettrodung des Urwaldes zur Biodieselproduktion? (Ich vermute übrigens das auf jeder Klimakonferenz mehrere Scharfschützen auf der Lauer liegen, die den Befehl haben sofort denjenigen zu erlegen der die nahe liegenste Komplettlösung des Problems erwähnt) --2003:66:8932:2DB:F17C:54B1:68D8:118E 23:04, 24. Dez. 2015 (CET)
Tatsache ist: Zu wieviel Prozent menschliche Aktivitäten am Klimawandel beteiligt sein sollen, ist derzeit nicht belegt oder bewiesen. --Heletz (Diskussion) 09:33, 25. Dez. 2015 (CET)
- Stimmt schon, aber Tatsache ist auch er ist daran beteiligt! Das bestreitet keine Wissenschaftler, der sich auch eien solcher schimpfen darf. Wir haben in den letzen 150 Jahren mit der Luftverschmutzung die Zusammensetzung der Athmosphäre verändert. Das bestreitet eigentlich niemand, wie auch eigentlich niemand bestreitet, dass dies Veränderung auch Auswirkung auf die Klimamodelle hat. Im einzige Punkt wo sie sich nicht einig sind ist, zu wievielen Prozent Anteil diese menschgemachte Veränderung auf die akteull messbaren Klimaveränderungen mitschuldig ist. Das mit dem „belegt oder bewiesen“ ist immer so ein Knackpunkt wenn du nur ein Modell zum Belegen hast. Wir haben keine 2. Erde ohne Luftverschmutzung womit man Gegenmessen können. „Wir wissen nicht zu wievielen Prozent wir mitschuldig sind, also machen wir nichts“ wie das einige Politiker fordern, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. --Bobo11 (Diskussion) 10:05, 25. Dez. 2015 (CET)
- Dass "der Repubikaner" mit Wissenschaft allgemein (oder klarem Denken allgemein) nicht viel anfangen kann, zeigt sich nicht nur daran, dass er gern den menschengemachten Klimawandel leugnet, sondern auch Evolution und andere eindeutig existierende Dinge (Obamas Geburtsurkunde...). Kluge Leute orientieren sich aber nicht an Republikanern, sondern an den Experten. Kluge Leute plappern nicht das nach, was Wall Street Journal und Fox News Channel über wissenschaftliche Fragen wie Klimawandel sagen, weil das nur rhetorische Rohrkrepierer sind. Auch was hier von der Leugner-Fraktion kommt, fällt unter diese Sparte. Der menschengemachte Klimawandel ist Konsens unter Experten, das ist einfach so. Was ein paar Energie-Unternehmer, Politiker, Wissenschaftlerdarsteller, Journalistendarsteller und WP-Benutzer sagen, zählt da einfach nicht. --Hob (Diskussion) 12:14, 25. Dez. 2015 (CET)
- Klar, die Technokratische Bewegung würde das im Handumdrehen lösen, die Welt wäre viel einfacher, wenn nur diese Experten das Sagen hätten, und nicht die Politik. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 13:11, 25. Dez. 2015 (CET)
- Wie die Politik das Sagen hat haben wir ja prima an der Bankenkrise gesehen... --2003:45:463C:B800:F127:4C7A:3F10:D3F1 13:45, 25. Dez. 2015 (CET)
- Klar, die Technokratische Bewegung würde das im Handumdrehen lösen, die Welt wäre viel einfacher, wenn nur diese Experten das Sagen hätten, und nicht die Politik. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 13:11, 25. Dez. 2015 (CET)
- Kann man auch umgekehrt sehen - wenn auch bei dem Desaster statt der Politik nur die Experten (in Finanzsachen) das sagen hatten, sollten die beim Klima schön fein außen vor bleiben. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 14:10, 25. Dez. 2015 (CET)
- Ja, die Experten in Finanzsachen sollten beim Klima auf jeden Fall schön fein außen vor bleiben. --Hob (Diskussion) 14:14, 25. Dez. 2015 (CET)
- Kann man auch umgekehrt sehen - wenn auch bei dem Desaster statt der Politik nur die Experten (in Finanzsachen) das sagen hatten, sollten die beim Klima schön fein außen vor bleiben. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 14:10, 25. Dez. 2015 (CET)
- Bei der sogenannten Finanzkrise hatten nicht "die Experten (in Finanzsachen)" das Sagen sondern die Eigentümer der Banken. --2003:45:463C:B800:F127:4C7A:3F10:D3F1 15:15, 25. Dez. 2015 (CET)
- Hmm, ohne die könnte der IPCC keinen einzigen Bericht mehr herausbringen, weil die ganz wesentlich auch auf wiwi und sozialwissenschaftlicher Expertise basieren. Politische Entscheidungen sind ohne Einigung zu den regionalen Verteilungskonflikten und wirtschaftlichen Auswirkungen nicht möglich, schon gar nicht global. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 14:38, 25. Dez. 2015 (CET)
- (Meine vorherige Antwort dazu scheint beim Editieren verloren gegangen zu sein) Wenn du bei der Frage, wer was zu sagen hat, was zu sagen hättest, müsstest du dich entscheiden, ob diese Experten bei dem Thema was zu sagen haben sollen (deine Aussage um 14:38) oder nicht (deine Aussage um 14:10)... zum Glück entscheiden das aber andere. --Hob (Diskussion) 19:03, 26. Dez. 2015 (CET)
- Hmm, ohne die könnte der IPCC keinen einzigen Bericht mehr herausbringen, weil die ganz wesentlich auch auf wiwi und sozialwissenschaftlicher Expertise basieren. Politische Entscheidungen sind ohne Einigung zu den regionalen Verteilungskonflikten und wirtschaftlichen Auswirkungen nicht möglich, schon gar nicht global. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 14:38, 25. Dez. 2015 (CET)
In einem Nature Geoscience-Artikel von 2011 heißt es:
- "Our results show that it is extremely likely that at least 74% (±12%, 1σ) of the observed warming since 1950 was caused by radiative forcings, and less than 26% (±12%) by unforced internal variability. Of the forced signal during that particular period, 102% (90–116%) is due to anthropogenic and 1% (−10 to 13%) due to natural forcing." [2] (pdf)
Daraus folgt m.E., daß der Strahlungsantrieb ("radiative forcing") fast vollständig ("102%") auf menschlichem Antrieb ("anthropogenic forcing") beruht, und daß mit 95%er-Wahrscheinlichkeit ("extremely likely") mindestens ca. 74% der seit 1950 beobachteten Erwärmung auf diesen vom Menschen verursachten Strahlungsantrieb zurückzuführen sind, Rosenkohl (Diskussion) 13:59, 25. Dez. 2015 (CET)
- Das löst das Problem der regional unterschiedlichen Klimata wie unterschiedlichen Klimaveränderungen nicht. Eine deutliche Erwärmung findet seit 1850 statt und vestärkt seit 1900, bis 1910-1945 fand 40% der Erwärmung statt, aber da wurden aber nur 10% des seit 1900 emittierten CO2 ausgestoßen. 1945 bis 1975 gab es wieder eine leichte Abkühlungstendenz, die Industrialisierung schritt weltweit heftig fort. Seit 1998 geht es mit der Erwärmung deutlich langsamer voran als das angesichts der seitdem ausgestoßenen 25% Emissionen hätte sein müssen. Sprich man ist mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, was die extreme Sicherheit angeht. Womöglich - das ist wissenschaftlich auch gut belegt, müssen wir uns auf Klimaveränderungen einstellen, die mit weniger CO2 Ausstoß auch kommen. Ein Teil der bei Nature Geoscience aufs Co2 gebuchten Anteile geht womöglich auf Landnutzungsänderungen und andere menschliche Faktoren zurück. Das ist nicht von BP gekauft ;) Dann wären aber Bürgermeister und Deichbauer in der Bütt, die Verantwortung wäre beim kommunalen und regionalen Level und die internationalen Weltenretter wären weniger gefragt. Die schimpfen weiterhin auf die Ölindustrie und Donald Trump und machen sich die Welt damit etwas zu einfach. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 14:38, 25. Dez. 2015 (CET)
- Nicht alles dreht sich immer im Reigen um Bakulan. Der Nature Geoscience-Artikel widerlegt obige Tatsachenbehauptung von Heletz 09:33, 25. Dez. 2015 (CET) und Bobo11 10:05, 25. Dez. 2015 (CET), daß nicht belegt oder bewiesen sei zu wieviel Prozent menschliche Aktivitäten am Klimawandel beteiligt sind.
- Zwischen 1945 und 1975 gab es keine signifikante Abkühlung, sonder eine Stagnation, die zum größten Teil auf vom Menschen erzeugte Aerosolo zurückzuführen ist, en:Global_cooling#Aerosols.
- Seit 1998 geht es mit der Erwärmung keineswegs langsamer voran, "A July 2015 paper on the updated NOAA dataset cast doubt on the existence of this supposed hiatus, and found no indication of a slowdown (...) A review of scientific literature by Bristol University in November 2015 found "no substantive evidence" of a pause in global warming" en:Global warming hiatus
- Der Nature Geoscience-Artikel betrachtet menschlichen Einfluß auf den Strahlungsantrieb, sowohl beschleunigend durch Treibhausgase wie CO2 als auch verlangsamend durch Aerosole.
- Die Veränderung des Albedo kann eine Rolle bei lokalen Klimaveränderungen spielen, aber hat kaum Einfluß auf globale Erwärmung: "The impacts of land use change on climate are expected to be locally significant in some regions, but are small at the global scale in comparison with greenhouse gas warming" [3]
Rosenkohl (Diskussion) 15:13, 25. Dez. 2015 (CET)
- [BK]"Seit 1998 geht es mit der Erwärmung deutlich langsamer voran" - das ist die angebliche Globale Erwärmungspause, die tatsächlich nur Kaffeesatzleserei von seiten der Leugner-Industrie ist. Genausogut könnte man "die Abkühlung 1991-93" zum Ding machen oder "die Stagnation 1981 bis 1987" - einfach aus der Kurve die Daten isolieren, die, wenn man sie isoliert, des Gegenteil der Realität zeigen, sie sich aus der Gesamtkurve ergibt. Es ist schon wichtig, auf solche Tatsachenverdrehungen hinzuweisen, damit man entscheiden kann, wer bei den Entscheidungen auf keinen Fall mitreden darf. Das sind nicht nur "Trump und die Ölindustrie", sondern auch die Denkfabriken und Journalisten, die denen, die mit Verbrennen von CO2 ihr Geld verdienen, jahrzehntelang nach dem Mund geredet haben. Also du zum Beispiel. --Hob (Diskussion) 15:20, 25. Dez. 2015 (CET)
- Meine Aussage ist in guter Übereinstimmung mit dem kürzlichen Statement von Judith Curry bein einer Anhörung des amerikanischen Senats, Titel Data or Dogma? Promoting Open Inquiry in the Debate Over the Magnitude of the Human Impact on Earth’s Climate. Ich habs als guter Protestant nicht so mit Dogmen, die Daten sind mit den IPCC Berichten konsistent. Der eingangs angeführte Republikaner ist da womöglich besser informiert als manch einer hier annimmt. Die grad vorgeschlagene Abschaffung der Demokratie hüben wie drüben ist nicht ganz in unserem Sinne. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 19:33, 25. Dez. 2015 (CET)
- Jaja, deine Aussage ist in guter Übereinstimmung mit die winzigen Minderheit der Klimatologen, deren Aussagen in guter Übereinstimmung mit dir sind. Und wenn jemand deine Meinung für falsch hält, weil es keine guten Argumente dafür gibt, und vorschlägt, Leute, die gewohnheitsmäßig Meinungen vertreten, für die es keine guten Argumente gibt, nicht ernstzunehmen, dann heißt das nicht, dass die Demokratie abgeschafft wird. --Hob (Diskussion) 09:01, 26. Dez. 2015 (CET)
- Meine Aussage ist in guter Übereinstimmung mit dem kürzlichen Statement von Judith Curry bein einer Anhörung des amerikanischen Senats, Titel Data or Dogma? Promoting Open Inquiry in the Debate Over the Magnitude of the Human Impact on Earth’s Climate. Ich habs als guter Protestant nicht so mit Dogmen, die Daten sind mit den IPCC Berichten konsistent. Der eingangs angeführte Republikaner ist da womöglich besser informiert als manch einer hier annimmt. Die grad vorgeschlagene Abschaffung der Demokratie hüben wie drüben ist nicht ganz in unserem Sinne. Polentarion DiskTebbiskala : Kritik 19:33, 25. Dez. 2015 (CET)
Das Jahr 1573 war bekanntlich für die bayerische Landwirtschaft ein Katastrophenjahr. Andauernde Kälte und Regen vernichteten jede Ernte, die Bevölkerung hungerte. Die Kleine Eiszeit machte es möglich. Allerdings war und blieb es nicht mit einem Schlag kalt. Noch 1611 berichtete der Kastner von Traunstein am Herzog Maximilian I. Von Bayern über Weinanbau in und um Traunstein (also kurz vor dem Gebirge). Die Qualität scheint nicht mehr so gut gewesen zu sein wie früher, aber immerhin. Soweit ersichtlich, gibt es heute immer noch keinen Weinanbau in dieser Gegend trotz Klimaerwärmung. Es ist also noch immer nicht so warm wie 1611 (Weinanbau muß in längeren Perioden geschehen, sagt also etwas über das Langzeitklima aus. Erst nach 1611 verschwand der Weinanbau aus der Gegend um Traunstein. Im 15. und 16. Jhd. deckte der Münchner Herzogshof noch über 80% des Weinbedarfs aus „Bayerwein“. Schon deshalb glaube ich nicht an eine menschengemachte Klimaerwärmung ab 1850. --Heletz (Diskussion) 10:39, 26. Dez. 2015 (CET)
- Das heißt, du orientierst dich nicht direkt an den tatsächlichen duchschnittlichen globalen Temperaturen, wie die Klimatologen es tun, sondern an etwas, was von den lokalen Temperaturen in einer bestimmten Landschaft abhängt. Das ist genau das, was ich oben gesagt habe: Herauspicken einzelner genehmer Datenpunkte statt Betrachtung der Gesamtheit. So wie jemand, der glaubt, Rauchen sei gesund, weil Helmut Schmidt so alt geworden ist. Ich weiß ja nicht, wie das in deiner Disziplin behandelt wird, aber in meiner Disziplin gilt solches Rosinenpicken als unseriös. --Hob (Diskussion) 12:03, 26. Dez. 2015 (CET)
- Wie sehr bei dem Thema gelogen wird, kann man in diesem Artikel nachlesen. Temperaturen im 16.Jahrundert wurden natürlich nicht gemessen. Sondern erschlossen. Gleichungen mit 4 Unbekannten sind schon schwierig. Klima"berechnungen" haben hunderte von Unbekannten. Schon 2012 mußten da Leute zurückrudern, was die errechneten Werte angeht. Das Wichtigste scheint zu sein, daß gezahlt wird. Wer zahlt, der darf. Das kommt einem vor wie Tetzels Ablaßhandel. Dazu gibt es eine weitere Parallele: Den Glauben, der Klimawandel sei menschengemacht. der menschliche Anteil daran müßte allerdings erst noch festgestellt werden. Blöd, wenn dabei 0% rauskommt. --Heletz (Diskussion) 14:26, 27. Dez. 2015 (CET)
- Ich wiederhole meine Aussage von oben: "Du hast dafür sicher auch eine Ausrede, also tu ruhig so, als wär nix." Deine Ausrede ist jetzt "da wird gelogen". Puh, nochmal Glück gehabt, falscher Alarm, wir können ignorieren, was die Klimatologen sagen, denn da hat mal jemand gelogen.
- Nein, der Anteil ist nicht 0%. Aber davon wird dich niemand überzeugen können. --Hob (Diskussion) 14:45, 27. Dez. 2015 (CET)
- Wie sehr bei dem Thema gelogen wird, kann man in diesem Artikel nachlesen. Temperaturen im 16.Jahrundert wurden natürlich nicht gemessen. Sondern erschlossen. Gleichungen mit 4 Unbekannten sind schon schwierig. Klima"berechnungen" haben hunderte von Unbekannten. Schon 2012 mußten da Leute zurückrudern, was die errechneten Werte angeht. Das Wichtigste scheint zu sein, daß gezahlt wird. Wer zahlt, der darf. Das kommt einem vor wie Tetzels Ablaßhandel. Dazu gibt es eine weitere Parallele: Den Glauben, der Klimawandel sei menschengemacht. der menschliche Anteil daran müßte allerdings erst noch festgestellt werden. Blöd, wenn dabei 0% rauskommt. --Heletz (Diskussion) 14:26, 27. Dez. 2015 (CET)
- Wie eben gerade eben erwähnt liegt der menschliche Anteil mit 95%er-Wahrscheinlichkeit bei mindestens ca. 74%. Aus der gerade eben ebenfalls erwähnten NOAA-Studie geht hervor: "Lange wurde von Schiffen aus per Holzeimer das Wasser gemessen, dann vermehrt in Plastikgefäßen, heute meist automatisch am Rumpf - die Daten waren der neuen Studie zufolge aber teils falsch bewertet worden. Jüngst hatten Forscher zum Beispiel entdeckt, dass länger mit Holzeimer gemessen wurde als angenommen. Zudem hätten Bojen unter der Meeresoberfläche zu kaltes Wasser vorgetäuscht. Auch Messungen abgelegener Regionen an Land hätten in jüngster Zeit korrigiert werden müssen (...) Von 2000 bis 2014 stieg die globale Durchschnittstemperatur demnach um 0,116 Grad pro Jahrzehnt - und damit sogar etwas schneller als zwischen 1950 bis 1999", Spiegel Online, 5. Juni 2015, Rosenkohl (Diskussion) 17:43, 27. Dez. 2015 (CET)
- Eben, es ist nicht ganz klar ob es 74% sind, ich wäre sogar sekptischer wenn jemand da einen klaren Wert rausgeben würde. Bei „ca. 3/4 davon ist menschgemacht“ liegt einfach die Schnittmenge der meisten Berechungen, und selbst die, die wirklich vom Wert 74% abweichen, erwischen den Wert noch mit einer Ecke ihrer eigenen Bandbreite. Aber selbst die wirtschaftsfreundlichsten Berrechungen kommen zum Schluss, dass es über 50% der aktuellen Klimaerwährung sind, die auf das Konto des Menschen gehen müssen. Und mir ist keine einzige bekannt, bei der dieser Wert für „menschgemacht“ unter 50% wären geschweige den bei 0%. Das es lokal Gebiete gibt, in dennen bei einer globalen Erwärmung zu einer Themperaturabsenkung kommen kann, streitet auch kein Wissenschaftler ab. Und es ist eigentlich egal wie hoch dieser Anteil ist, denn die nachfogenden Generationen werden uns vor allem Fragen, ob wir es wussten und ob wir was dagegen getan hätten. Das ist hier die Grettchenfrage nicht die nach der Höhe dieses Faktors. Denn der Punkt ist ja der, wir Wissen das es ein menschlichen Faktor bei der Klimaerwährung gibt. Und wir Wissen auch, dass wir diesen -wenn wir wollten- verkleinern könnten. Also stellt sich nur diese eine Frage; „Warum verminderen wir diesen Faktor dann nicht?“. Und ich schrieb es ja schon oben, ich persönlich möchte da gerne zumindest mit; „Wir habens ja versucht“ antworten können. --Bobo11 (Diskussion) 18:21, 27. Dez. 2015 (CET)
- Wie eben gerade eben erwähnt liegt der menschliche Anteil mit 95%er-Wahrscheinlichkeit bei mindestens ca. 74%. Aus der gerade eben ebenfalls erwähnten NOAA-Studie geht hervor: "Lange wurde von Schiffen aus per Holzeimer das Wasser gemessen, dann vermehrt in Plastikgefäßen, heute meist automatisch am Rumpf - die Daten waren der neuen Studie zufolge aber teils falsch bewertet worden. Jüngst hatten Forscher zum Beispiel entdeckt, dass länger mit Holzeimer gemessen wurde als angenommen. Zudem hätten Bojen unter der Meeresoberfläche zu kaltes Wasser vorgetäuscht. Auch Messungen abgelegener Regionen an Land hätten in jüngster Zeit korrigiert werden müssen (...) Von 2000 bis 2014 stieg die globale Durchschnittstemperatur demnach um 0,116 Grad pro Jahrzehnt - und damit sogar etwas schneller als zwischen 1950 bis 1999", Spiegel Online, 5. Juni 2015, Rosenkohl (Diskussion) 17:43, 27. Dez. 2015 (CET)
Aus der zitierten schweizer Studie folgt, daß mit 95%-er Wahrscheinlichkeit mindestens ca. 74% menschgemacht sind, nicht etwa daß es nur ca. 74% seien.
Ich keine keine anderen Berechnungen, die behaupten würden daß nur ca. 3/4 menschgemacht seien.
Es treten in der empirischen Statistik keine absolut zutreffenden "Bandbreiten" mit "Ecken" auf, sondern Konfidenzintervalle ("Bandbreiten"), die nur mit einer vorgegebenen Fehlerwahrscheinlichkeit zutreffen.
In der Zusammenfassung Summary for Policymakers (32 Seiten pdf) des Fünfter Sachstandsbericht des IPCC heißt es
- "The evidence for human influence on the climate system has grown since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4). It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in GHG concentrations and other anthropogenic forcings together. The best estimate of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period (Figure SPM.3)." (S. 5)
Dabei bedeutet hier "extremely likely 95%-100%" (S. 2)
Somit sind laut IPCC mit 95%er Wahrscheinlichkeit ein Anteil von mindestens 50% des Temperaturanstiegs seit 1951 von Menschen verursacht, wobei die beste Schätzung für den Anteil bei 100% ("similar to the observed") liegt, Rosenkohl (Diskussion) 20:53, 27. Dez. 2015 (CET)
- <ohrenzuhalt> Aber da die Wissenschaftler alle lügen, zählt das alles nicht, da kann man noch so viel untersuchen und noch so oft dieses Ergebnis herausbekommen, alles irrelevant! Am soundsovielten war es dortunddort kälter als vorher, und dieses Argument ist stärker. Man sollte die Experten gar nicht erst fragen, sondern die Freier-Markt-Ideologen in den neoliberalen Denkfabriken sagen uns, wie es wirklich ist... lalalala! lalalala! </ohrenzuhalt> --Hob (Diskussion) 21:04, 27. Dez. 2015 (CET)
Hinter Klimaskeptik stecken keineswegs bloß ideologische oder etwa gewinnsüchtige Interessen, sondern zunächst auch ein Interesse am Erhalt grundsätzlicher Freiheitsrechte, inklusive Privateigentum, individueller Entfaltung und politischer Gestaltung. Z.B. warnte Hans Jonas in Das Prinzip Verantwortung vor einer "Öko-Diktatur", stellte aber die "Demokratie jetzigen Stils" in Frage und sagte unumwunden, daß Freiheitsverzichte der Individuen "selbstverständlich" unvermeidlich sei.[4] Der Jurist Klaus Bosselmann strebt einen ökologischen Rechtsstaat an, mit
- "einerseits einer ökologischen Rechtstheorie, wonach die nichtmenschliche Natur den individuellen Freiheitsrechten Grenzen zieht, eine selbstgesetzte Umweltethik zum Maßstab allen Rechts wird oder die Natur Eigenrechte erhält, andererseits einer ökologischen Rechtsordnung mit Elementen wie einer allgemeinen ökozentrischen Umweltverträglichkeitsprüfung, einer Beweislastumkehr bei ökologischen Risiko-Ereignissen oder einer Institutionalisierung von ökologischer Interessenwahrnehmung" Rezension Spektrum der Wissenschaft, 1993
Eine deratige ökozentrische Wende stünde m.E. durchaus im Gegensatz zu bisherigen anthropozentrischen politischen Ethik, Rosenkohl (Diskussion) 22:00, 27. Dez. 2015 (CET)
- Bobo11: Aber zu wieviel Prozent genau? Das einzige, was man zu lesen bekommt, sind doch Vermutungen, Schätzungen, Worte wie "wahrscheinlich" oder "sehr wahrscheinlich". Aber wo ist der Beweis? Hier wieder mal ein Bericht über etwas, das man bei den Berechnungen "vergessen" hat. Die westliche Menschheit hat irgendwie ein schlechtes Gewissen und will es erleichtern. Religiöse Erklärungen scheiden aus, man gibt sich ja aufgeklärt und wissenschaftlich. Deutsche haben ein besonders schlechtes Gewissen bzw. Angst. German Angst. --Heletz (Diskussion) 22:09, 27. Dez. 2015 (CET)
- Jaja, unter einem mathematischen Beweis macht ihr es nicht. Genauso kenne ich das auch von vielen anderen Pseudowissenschaftlern. Wo ist der Beweis, dass Evolution stattfindet, wo ist der Beweis, dass Karl der Große existiert hat, wo ist der Beweis für die Mondlandung. Das ist der letzte argumentative Notnagel, nachdem einem alle anderen Argumente widerlegt wurden. Es ist klar, dass hier auf der einen Seite die Wissenschaft steht und auf der anderen Seite die Ideologen.
- "Interesse am Erhalt grundsätzlicher Freiheitsrechte" hat nichts mit der Frage zu tun, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Du musst nicht die Realität leugnen, um deine Freiheit zu verteidigen, sondern kannst sagen: ok, den Klimawandel gibt es, und wird deswegen Tote geben, aber meine Freiheit, beliebig viel Kohle und Öl zu verbrennen, ist wichtiger. Das wäre ehrlicher, und jeder wüsste, woran er mit euch ist. (Da hat ja weiter oben schon jemand in diese Richtung argumentiert, mit natürlicher Selektion und Wilden und Dämmen.) Dann kann man über das reden, worum es tatsächlich geht: Hört meine Freiheit, die Faust zu schwingen, da auf, wo deine Nase anfängt, oder nicht? --Hob (Diskussion) 09:19, 28. Dez. 2015 (CET)
- sorrycnr --> lesen ! duck &weg --just aLuser (Diskussion) 11:16, 28. Dez. 2015 (CET)
- "Interesse am Erhalt grundsätzlicher Freiheitsrechte" hat nichts mit der Frage zu tun, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Du musst nicht die Realität leugnen, um deine Freiheit zu verteidigen, sondern kannst sagen: ok, den Klimawandel gibt es, und wird deswegen Tote geben, aber meine Freiheit, beliebig viel Kohle und Öl zu verbrennen, ist wichtiger. Das wäre ehrlicher, und jeder wüsste, woran er mit euch ist. (Da hat ja weiter oben schon jemand in diese Richtung argumentiert, mit natürlicher Selektion und Wilden und Dämmen.) Dann kann man über das reden, worum es tatsächlich geht: Hört meine Freiheit, die Faust zu schwingen, da auf, wo deine Nase anfängt, oder nicht? --Hob (Diskussion) 09:19, 28. Dez. 2015 (CET)
Jedes menschliche Wirtschaften, seit jeher und unvermeidlich, verbraucht Ressourcen und erzeugt Umweltschäden. Der Umweltverbrauch wird in gewissem Maße durch natürliche Regenerationsprozesse wieder kompensiert.
Die heutige kapitalistische Wirtschaftsweise beruht auf Ausbeutung, einerseits von menschlicher Arbeitskraft und andererseits von natürlichen Ressourcen; macht auf der Grundlage von Privateigentum und Warentausch aber eine egalitäre Sphäre bürgerlicher Freiheiten erst möglich.
Der Aufbau einer relativ egalitären Gesellschaft mit Massenwohlstand, inklusive Sozialstaat, auch etwa inklusive dem Erhalt von Naturschutzgebieten, gelang nur auf Grundlage einer Industrialisierung, einschließlich industrialisierter Landwirtschaft mit Flächenverbrauch, Maschinen-, Dünger-, Pestizideinsatz, Massentierhaltung. Somit konnte die Leibeigenschaft Ende des 18. Jahrhunderts abgeschaft, mühsame körperliche Feldarbeit reduziert werden.
Gerade die industrielle Ausbeutung des ganzen Planeten, verbunden mit dem Erzeugen von Treibhausgasen, also das Erzeugen globaler externe Effekte, ermöglichte es somit bisher, die kapitalistische Ausbeutung im Arbeitsprozess in einem gewissem Rahmen zu begrenzen, Rosenkohl (Diskussion) 11:38, 28. Dez. 2015 (CET)
- Ohne die industrielle Landwirtschaft wäre die Ernährung von 7 Milliarden Menschen heute gar nicht mehr möglich. Sicherlich könnte man die Fleischproduktion zurückfahren und die Überproduktion begrenzen, aber ein gewisses Maß an Überproduktion ist durch die Konkurrenzsituation im Kapitalismus systemimmanent. Und man kann den Entwicklungsländern wohl kaum ein Minimum an Wohlstand verweigern, was in Zukunft zu einer enormen Zunahme des Energieverbrauchs führen wird. Die 2,7 Milliarden Menschen, die in den nächsten 35 Jahren dazu kommen, müssen ja auch ernährt und versorgt werden. Aber das Bevölkerungswachstum ist seltsamerweise in der öffentlichen Debatte gar kein Thema.
- Beweisen lässt sich der Klimawandel oder der menschengemachte Anteil daran natürlich nicht, weil es sich um eine Voraussage der Zukunft handelt. Ebensowenig kann man beweisen, dass es morgen regnet. Sogar wenn man auf Satellitenbildern sieht, wie die Regenfront immer näher kommt, könnte man zwar dringend raten, einen Schirm mitzunehmen, aber ein Beweis ist das nicht. Ebenso kann man messen, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre seit 150 Jahren ansteigt (mindestens aber, seitdem man den CO2-Gehalt direkt misst), und ein höherer CO2-Gehalt führt zu einer allgemeinen Temperaturerhöhung. Auch wenn der Mensch daran nur einen minimalen Anteil hätte, wären verschiedene Maßnahmen, die eine CO2-Reduktion bewirken, eine gute Idee: Verringerte Nutzung fossiler Brennstoffe, weil sie endlich sind und die Gewinnung immer umweltzerstörerischer wird und weil wir davon abhängig und dadurch erpressbar sind, Verringerung der Fleischproduktion, weil Fleisch aus Massentierhaltung die Qualität reduziert und wir sowieso zu viel Fleisch essen, Umweltschutz und Schutz der Regenwälder, Wiedervernässung von Mooren als CO2-Senken usw.
- Ein Problem in der ganzen Geschichte ist, dass die Klimawandelverkünder (wie nennen die sich?) genauso apodiktisch argumentieren, wie die Klimawandelleugner. "Die Mehrheit der Klimaforscher sagt.." hört sich erstmal wichtig an und sollte auch zu denken geben, aber Wissenschaft wird ja nicht per Abstimmung gemacht, sondern per Überzeugung, und es gab schon Punkte in der Wissenschaft, in denen sich 100% der WIssenschaftler geirrt haben. Leute, die eine abweichende Meinung vertreten, werden komplett als Spinner oder bezahlte Schreiber der Ölindustrie abgewertet, wobei auch die übrigen Klimaforscher von irgendetwas leben müssen. Wenn man da über mehrere Jahre "Im Moment tut sich nichts" verbreitet, würde sich das sicherlich negativ auf die Zuteilung der Forschungsgelder auswirken, also muss man die Flamme immer am Köcheln halten. --Optimum (Diskussion) 23:59, 28. Dez. 2015 (CET)
- "dass die Klimawandelverkünder (wie nennen die sich?) genauso apodiktisch argumentieren, wie die Klimawandelleugner" ... "Die Mehrheit der Klimaforscher sagt.."
- Das ist falsch. Es geht nicht um Mehrheiten, es geht um gute und schlechte Argumente. Schlag eine aktuelle Klimatologie-Zeitschrift auf. Du wirst darin keine Artikel finden, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Das liegt daran, dass es keine guten Argumente dagegen gibt. Die Argumente, die es gab, haben sich als falsch herausgestellt. Die Mehrheitsverteilung ist nur eine Folge davon.
- Wenn du dagegen argumentieren willst, dann brauchst du echte Argumente und nicht so einen Käse wie "die Wissenschaftler haben sich schon früher mal alle geirrt". Das ist ein Scheinargument, das man nur von denen hört, die keine echten Argumente haben. Die "Leute, die eine abweichende Meinung vertreten", können das gern vertreten, aber aber sie müssen sich damit abfinden, dass man sie fragt "mit welcher Begründung?" Und wenn sie dann nur Dinge vorbringen können wie "an dem Ort X war es zum Zeitpunkt Y kälter als vorher" oder "Hilfe, ich werde unterdrückt" oder "die Wissenschaftler haben sich schon früher mal geirrt", dann müssen sie sich damit abfinden, dass ihre Meinung nicht ernstgenommen wird.
- Wissenschaft ist halt nicht wie Pokern: es wird nicht geblufft, sondern die Karten liegen sichtbar auf dem Tisch. Und wer nur Luschen hat, kann sich nicht durchmogeln, sondern hat verloren. Wer sich mit Scheinargumenten auskennt, der kann bei solchen Kontroversen wie dieser erkennen, auf welcher Seite die schlechten Argumente liegen. --Hob (Diskussion) 11:45, 29. Dez. 2015 (CET)
- Bisher ist nur noch nie der Nachweis erbracht worden, der Klimawandel sei menschengemacht. Bisher ist das lediglich eine Annahme, eine Vermutung, eine Befürchtung or whatever. EIKE hat gestern jedenfalls festgestellt, die Eisbären vermehren sich und werden fetter. Auch ein Physiker ist keineswegs panisch. --Heletz (Diskussion) 13:27, 29. Dez. 2015 (CET)
Sie verstehen grundsätzlich nicht, worum es sich beim Nachweis einer Kausalität im Rahmen der auf Evidenz basierenden Wissenschaft handelt. Evidenzbasierte Kausalität kann stets nur als Aussage über die Gültigkeit eines bestimmten Models mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden, aber nie als absolut wahre Aussage. Absolut wahre Aussagen über die Realität kann man tatsächlich nur als Glaubenssätze im Rahmen von religiösen Weltanschauungen treffen, aber solche Glaubenssätze besitzen dann keine Vorhersagekraft mit Bezug auf die weitere Entwicklung der empirischen Realität, Rosenkohl (Diskussion) 13:48, 29. Dez. 2015 (CET)
Und "die Eisbären vermehren sich und werden fetter" ist nur ein weiteres der vielen Märchen der Klimawandelleugner [5]. EIKE ist keine zuverlässige Quelle, und Björn Lomborg auch nicht. An solchen Dingen kann man wunderbar erkennen, wer Recht hat: die einen müssen Zahlen verdrehen, Daten selektieren, Zitate aus dem Kontext reißen und Gerüchte verbreiten - und die anderen haben das nicht nötig. --Hob (Diskussion) 16:02, 29. Dez. 2015 (CET)
Der Ökomodernismus spricht sich einem 2015 veröffentlichten Manifest für eine weitere Intensivierung und Konzentrierung der Landwirtschaft aus, um globale Bedrohungen wie Klimamwandel, Ozonloch und Meereübersäuerung in den Griff zu bekommen und größere Gebiete renaturisieren zu können.
Dagegen sieht der Weltagrarbericht "als neues Paradigma der Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts (...) Kleinbäuerliche, arbeitsintensivere und auf Vielfalt ausgerichtete Strukturen" als "Garanten einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Lebensmittelversorgung durch widerstandsfähige Anbau- und Verteilungssysteme"
Dabei möchte der Weltagrarbericht zugleich vermeiden "die real existierende kleinbäuerliche und traditionelle Landwirtschaft romantisch zu verklären oder gar eine Rückkehr zuvorindustriellen Zuständen zu fordern", und beschreibt "ihre oft unzureichende Produktivität und Effizienz"
Laut Weltagrarbericht tragen "Gesundheits- und umweltschädliche Praktiken und der Mangel an traditionellem wie modernem Wissen [...] zum Elend vieler Subsistenz- und Kleinbauernfamilien bei. Viele überkommene Bewirtschaftungsformen bieten keine nachhaltige Perspektive mehr. Die Herausforderungen der Zukunft seien nur mit einem enormen Innovationsschub zu bewältigen und entsprechend qualifizierteren Bäuerinnen und Bauern."
Dabei tastet der Weltagrarbericht die Form des Privateigentums nicht an, wenn er vorschlägt: "Faire Kredite für Grundinvestitionen und Versicherungen gegen Missernten können helfen, die Risiken überschaubarer zu machen."[6]
Natürlich möchte jeder Kleinbauer das eigene Stück Land selbst besitzen. Ein Kredit, z.B. mit dem Land als Sicherheit, bedeutet jedoch wieder einen Eigentumstitel des Kreditgebers. Gleichwohl, weder ökomodernistisches Manifest noch Weltagrarbericht, so unterschiedlich sie scheinbar argumentieren, bekommen m.E. den erwähnten grundsätzlichen Mechanismus aus Ausbeutung der menschlicher Arbeit und Ausbeutung der Natur in den Blick; daß also Umweltverbrauch einschließlich globaler Erwärmung auf einer globalen Stufenordnung buchstäblich als ein Druckventil zur Abmilderung der sozialen Spannung funktioniert, Rosenkohl (Diskussion) 22:41, 29. Dez. 2015 (CET)
- "Vor 130.000 Jahren veränderte sich das globale Klima", erklärt Adrian Parker , der für die Studie die Umweltbedingungen von damals rekonstruiert hat. "Es kam zu einer Warmzeit, das Monsun-System im Indischen Ozean wurde nach Norden gedrängt und brachte Arabien Niederschläge." kann man hier nachlesen. --Heletz (Diskussion) 23:24, 1. Jan. 2016 (CET)
Fürs Archiv: Klimawandel? Dieser Winter ist zu warm? Wir haben gerade mal zwei Wochen Winter und in Berlin sind unglaublich niedrige Minus 10 Grad Celsius (-10° C). Wohl auch die ganzen nächsten Tage (aber dann rutscht der Artikel ins Archiv).--Wikiseidank (Diskussion) 18:00, 3. Jan. 2016 (CET)
- Scheint ein Thema zu sein welches viele interessiert. In weniger als 150 Jahren interessiert es keinen mehr den es heute für wichtig hält. Die zukünftigen Bewohner akzeptieren das Wetter wie es dann ist. genauso haben die Leute vor Hunderten oder Tausenden von Jahren auch akzeptiert was sie angetroffen haben. --Netpilots ✉ 00:49, 4. Jan. 2016 (CET)
- Oh, zwei neue Abwiegler. Zum X-ten Mal: Nein, die Temperaturen im Dezember in Deutschland sind kein Beleg für globale Erwärmung, und die Temperaturen jetzt in Berlin sind kein Beleg dagegen. Dass es eine globale Erwärmung gibt, ergibt sich aus der Gesamtmenge aller Daten und nicht aus einzelnen Datenpunkten. Und woher sie kommt, ergibt sich ebenfalls aus der Gesamtmenge aller Daten und nicht aus den Meinungen von Laien. Und schon gar nicht aus den Meinungen von Leuten, die meinen, sie wüssten schon heute, was in 150 Jahren gedacht wird. --Hob (Diskussion) 15:04, 4. Jan. 2016 (CET)
Klar haben wir eine globale Erwärmung, im Prinzip seit 20000 Jahren, mit kleineren und größeren Rückschlägen, im Moment wieder ein stärkerer Schub. Das ist ein Vorgang in der Natur, naturgesetzlich, oder - je nach Weltanschauung - vom lieben Gott initiiert. Natur und/oder lieber Gott nehmen dabei auf die Bewohner keine Rücksicht, die können sich ggfs. selbst helfen (vgl. "Arche Noah"). Klar ist aber auch, dass der Mensch seit langer Zeit, extrem verstärkt seit ca. 200 Jahren bei der Erwärmung nachhilft. Das soll jetzt per Klimakonferenzbeschluss begrenzt werden auf 2° in diesem Jahrhundert. Funktioniert vielleicht, aber nur dann, wenn Natur/lieber Gott nicht von sich aus durch natürliche Vorgänge dafür sorgen, dass die Temperatur über 2° pro 100 Jahre ansteigt. Das ist die bisher ignorierte Schwachstelle der Beschlüsse. Da hilft es auch nicht, dass "99% der Klinaforscher" (Zahl wurde eingangs genannt) die natürliche Erwärmung kleinreden. --84.135.137.68 18:00, 4. Jan. 2016 (CET)
- Oh, jetzt sind Götter die Ursache. Sehr wissenschaftlich, dagegen kann die Klimatologie natürich nicht anstinken. --Hob (Diskussion) 23:41, 4. Jan. 2016 (CET)
- Zum "Jahr ohne Sommer" gibt es wieder einen neuen Artikel. --Heletz (Diskussion) 18:29, 4. Jan. 2016 (CET)
- Auf den Beweis, daß der klimawandel menschengemacht sei, warten wir noch immer. Noch nicht mal der angebliche Anteil des Menschen kann beziffert werden. --Heletz (Diskussion) 18:29, 4. Jan. 2016 (CET)
- Zum "Jahr ohne Sommer" gibt es wieder einen neuen Artikel. --Heletz (Diskussion) 18:29, 4. Jan. 2016 (CET)
- Lies halt die entsprechenden Wikipedia-Artikel und die Quellen dazu, da findest du gute Gründe. Deine Scheinargumente sind alle oben widerlegt worden. Wie wär's damit, das Thema zu begraben? Du glaubst ja eh nie dran, egal wieviele Gründe dafür es gibt, also ist das hier sinnlos. --Hob (Diskussion) 23:41, 4. Jan. 2016 (CET)
- @HOB: "Oh, jetzt sind Götter die Ursache." Was soll das? Ich habe geschrieben: "je nach Weltanschauung"... Auch von den fast 100% Klimatologen bestreitet doch wohl keiner die Möglichkeit einer nichtanthropogenen Klimaänderung, auch in sehr kurzer Zeit, die Daten liegen doch vor. Wer sich aber zu 100% auf einen ausschließlich (!!!) vom Menschen gemachten Klimawandel fixiert, ist der eigentliche "Klimaignorant" oder "-leugner" (ich mag beide Ausdrücke eigentlich nicht, da es Kampfbegriffe sind). Sollen all die Faktoren, die bisher zu Eis- oder Warmzeiten bzw. zu deren Einzelphasen geführt haben, jetzt plötzlich unwirksam sein?
- Was bedeutet überhaupt: "Nahezu 100% der Klimatologen sehen das anders..." Hast Du sie gezählt? Du meinst höchstens den klimatologischen Mainstream, dem Gegenpositionen gegenüberstehen (sonst gäb es ja keine Diskussion, wie wir sie erleben). Das kenne ich schon: der mainstream sagt das (liefert die Ergebnisse), was gerade politisch gefördert wird. Ich kenne das schon. Es gab Zeiten, wo "nahezu 100%" der einschlägigen Wissenschaftler für die Kernenergie warben, später wussten "nahezu 100%" das Waldsterben auf ihre Art zubegründen, dann das Ozonloch, ebenso AIDS, Rinderwahnsinn etc. etc. Jedesmal ein gigantischer wissenschaftlicher Medienhype über die Probleme, die uns angeblich in die Katastrophe führen sollten. Nach ein paar Jahren ist entweder das Problem selbst verschwunden oder, wenn nicht, dann die Aufregung darüber, weil etwas anders Superwichtig geworden ist. Jedes Jahrzehnt wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, bis die nächste kommt. Dieses Thema wird sich auf ähnliche Art selbst beerdigen. Natürlich wirds wärmer, die Menschen werden sich darauf einrichten. --84.135.150.54 00:19, 5. Jan. 2016 (CET)
- Die Auseinandersetzung, ob der mittlerweile unbestreitbare Klimawandel (der für die Lebensgrundlagen der Menschen eine Katastrophe ist) in der Natur oder in den Aktivitäten der Menschen seine Ursache hat und falls in beidem zu welchen Anteilen und ob das „bewiesen“ ist oder nicht täuscht über den eigentlichen Knackpunkt hinweg: Welche Konsequenzen sind zu ziehen, was ist zu tun?
- Die Vertreter einer angeblich überwiegend naturbedingten Klimakatastrophe sehen keinen Grund, irgendetwas zu ändern, außer sich (wie auch immer, je nach Zynismus) „darauf einzurichten“. Wir haben das Schlamassel ja nicht erzeugt, die Natur ist schuld, man kann da nichts machen... Hätten wir es erzeugt oder wesentlich miterzeugt, wie es die Vertreter einer menschengemachten Klimakatastrophe sehen, dann sind in der logischen Folge Handlungsoptionen zu diskutieren und Konsequenzen umzusetzen. Das bedeutet zwar nicht das Aus für die Ölindustrie, aber das Aus im energieerzeugenden Sektor, also auch mit starken Auswirkungen auf die Automobilindustrie, die ob Katalysator oder Elektroauto offenbar unfähig oder unwillig ist, sich schon zu bewegen, bevor der Druck der Verhältnisse sie dazu zwingt. Es geht in der Ölindustrie also um erhebliche Umsatzeinbrüche, die durch den steigenden Bedarf an Öl in der Plastikindustrie und den Düngemitteln nicht ausgeglichen werden. Für die Kohleförderung sieht es noch schlechter aus. Die australische Kohleindustrie liegt (auch durch die derzeit niedrigen Ölpreise) bereits am Boden. Dazu kommt, dass es für die „Tigerstaaten“ und Schwellenländer kurzfristig gesehen wesentlich billiger ist, ihren steigenden Energiebedarf mit Kohle und Öl abzudecken. Die Schwellenländer stehen in starker Konkurrenz zu zueinander und zu den entwickelten Industriestaaten. Es gibt also insgesamt gesehen mächtige ökonomische Interessen, aus der sich entwickelnden Klimakatastrophe keine Konsequenzen ziehen zu müssen, das Phänomen zu einer naturbedingten unabwendbaren Schicksalsbegebenheit umzulügen, die wir tatenlos hinnehmen sollen. Tatenlos, weil jeder Vorschlag einer Tat einen wirksamen Einfluß der Menschen auf das Klima anerkennt.
- In Per Anhalter durch die Galaxis bekommt das Handtuch unter anderem einen bedeutenden Nutzen, weil man es sich über den Kopf legen kann, wenn man dem Blick des“Gefräßigen Plapperkäfers von Traal“ zu entgehen sucht (ein zum Verrücktwerden dämliches Vieh, es nimmt an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen - bescheuert wie eine Bürste, aber sehr, sehr gefräßig). Die Verharmloser des menschlichen Einflusses auf die Klimkatastrophe haben sich ihr Handtuch über den Kopf gelegt. Vor allem diejenigen, die bisher lediglich partiell oder nur sehr indirekt betroffen sind und - das korreliert imho mit der Dummheit des Wegschauens und Wegleugnens - erwarten, auch in Zukunft wenig betroffen zu sein. Die Klimakatastrophe funktioniert aber nach Gesetzmäßigkeiten, die mit der Dummheit eines Plapperkäfers nichts zu tun haben. Die Frage nach den Ursachen ist im gegenwärtigen Stadium ohnehin unerheblich. Die Katastrophe kümmert sich nicht um das Handtuch auf dem Kopf der Verharmloser und Kleinredner.
- Ob also beispielsweise das Methan, das derzeit dem mittlerweile auftauenden Permafrost entweicht und die globale Erwärmung erheblich beschleunigt, nun zu dem Anteil an der Katastrophe gehört, der den Menschen oder „der Natur“ in ihrer Unabänderlichkeit zuzuschreiben ist, gleicht dem Streit darüber, wieviele Engel auf eine Nadelspitze passen. Das Haus brennt bereits und man kann versuchen, zu löschen oder sich daneben stellen und erstmal diskutieren zu wollen, was zu dem Brand geführt hat und ob das überhaupt ein Brand ist oder nicht eine Erfindung der Journalisten. Von allen, die bereits jetzt betroffen sind, wird eine solche Haltung als zynisch und menschenverachtend erfahren. --2003:45:463F:AC00:CDE3:8310:BBCA:65A2 03:31, 5. Jan. 2016 (CET)
- "hast du sie gezählt?" - Ich nicht. Siehe [7].
- Die 97% betreffen aber nur diejenigen Artikel, in denen ausdrücklich diese Frage beantwortet wird. Natürlich gibt es Klimatologen, die das in ihren Studien gar nicht mehr erwähnen, weil das eh selbstverständlich ist.
- "die Möglichkeit einer nichtanthropogenen Klimaänderung" - was soll das denn? Selbstverständlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Aber:
- Theorie: Aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe ist damit zu rechnen, dass der Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre ansteigt.
- Praxis: das ist so. Siehe Keeling-Kurve.
- Theorie: Aufgrund des Absorptionsspektrums des Kohlenstoffdioxids und des Treibhauseffekts ist theoretisch damit zu rechnen, dass bei steigendem Kohlenstoffdioxidgehalt auch die globale Temperatur ansteigt.
- Praxis: das ist so. Siehe Hockeyschläger-Diagramm.
- Es wäre theoretisch denkbar, dass es einen geheimnisvollen, bisher nicht entdeckten Effekt gibt, der in einem der beiden Theorie-Schritte den Effekt verhindert, und dann unabhängig davon einen anderen, geheimnisvollen, bisher nicht entdeckten Effekt, der dafür sorgt, dass die Temperatur trotzdem ansteigt. Wenn du das glauben willst, bitteschön. Wissenschaftler denken nicht so. Womöglich fallen Äpfel nicht wegen der Gravitation zur Erde, sondern wegen eines bisher unbekannten Effektes, und ein anderer bisher unbekannter Effekt gleicht die Gravitation genau aus...
- "sonst gäb es ja keine Diskussion, wie wir sie erleben" - Unfug. Die Diskussion gibt es, weil es Gruppierungen gibt, die aus ideologischen Gründen nicht wollen, dass irgendwas reguliert wird. Deswegen erfinden sie pseudowissenschaftliche Argumente. Einige solche Ideologen, aber sehr wenige, versuchen das innerhalb der Klimatologie, schaffen es aber nur mit unredlichen Tricks, ihre schlechten Argumente in wissenschaftlichen Zeitschriften unterzubringen. Siehe z.B. Willie Soon, der dafür recht gut bezahlt wurde.
- "Es gab Zeiten, wo "nahezu 100%"" usw. Das ist ein Argument, das von nahezu allen Pseudowissenschaften verwendet wird. Es läuft hinaus auf "könnte ja sein, dass ich trotzdem Recht habe, obwohl ich keine gute Begründung finde". Das ist ungefähr das schlechteste Argument, das es gibt. Entweder du hast ein echtes Argument oder du hast keins. --Hob (Diskussion) 09:53, 7. Jan. 2016 (CET)
Noch zur Ergänzung des Wetters in Berlin, von dem der TE ausging: Am 26. und 27. Dezember hatte es in Berlin als Höchstwert 14,6°C. Der Unterschied zu den 1977 an Weihnachten gemessenen 16°C ist derart gering, daß er nicht ins Gewicht fällt. --Heletz (Diskussion) 07:11, 6. Jan. 2016 (CET)
- Diese Art der Argumentation habe ich oben schon widerlegt. --Hob (Diskussion) 09:53, 7. Jan. 2016 (CET)
Kritiker der Klimaskeptiker sind großenteils selbst befangen in einer Vorwurfshaltung, z.B. auch der Beitrag von 2003:45:463F:AC00:CDE3:8310:BBCA:65A2. Denn die Position der Klimaskeptiker wird verkehrt dargestellt, indem verwechselt wird einerseits das Verdrängen der Ausbeutung von menschlicher Arbeit und von natürlichen Ressourcen aus dem Bewußtsein mit andererseits vermeintlichen ökonomischen Interessen der Klimaspektiker. Tatsächlich existieren solche ökonomischen Interessen zwar (etwa Kohlenstoffblase), ökonomische Interessen sind aber kein hinreichender Beweggrund, um zu erklären warum die menschliche Verursachung des Klimawandels aus dem Bewußtsein verdrängt wird.
Z.B. sagt Bärbel Höhn anläßlich der UN-Klimakonferenz in Paris 2015:
- "Es gibt zwei Punkte, die einfach besser sind als bisher. Der erste, dass eigentlich alle Staaten erkennen, wir müssen wirklich was tun, und jeder der Staaten auch bereit ist, einen Beitrag zu leisten, einfach weil man auch sieht, dass die Wetterextreme immer mehr zunehmen. Die Folgen des Klimawandels werden ja immer stärker. Und der zweite wichtige Punkt: Es gibt eine Alternative zur Kohle, die erneuerbaren Energien, und das war in den letzten Jahren noch nicht so stark, denn die Preisreduktion bei den Erneuerbaren hat das jetzt wirklich auch zur Alternative gemacht." [8]
Der Argumente von Höhn, daß einzelne Staaten aufgrund von einzelnen Unwetterkatastrophen freiwillig aus der Treibhausgasproduktion aussteigen würden, und daß erneuerbare Energien am Markt gegen die fossile Energieerzeugung gewinnen könnten sind illusorisch. Denn demokratische Staaten bestehen nur aufgrund, und sind gebunden an das Funktionieren der Marktwirtschaft und Erzeugen von Massenwohlstand mit einem graduellem Ausgleich zwischen Armen und Reichen.
In der marktförmigen Ökonomie ist die Ausbeutung menschlicher Arbeit untrennbar gekoppelt an die Ausbeutung natürlicher Ressourcen; dies bedeutet umgekehrt, daß ein staatliches Verbot von Treibhausgastechnologien im Rahmen einer Marktwirtschaft zu einer weiteren Verschärfung der Ausbeutung der Arbeiter führen würde, denn in dem Fall müßten Kraftarbeiten wieder vermehrt körperlich verrichtet werden.
Eine demokratische Alternative zur Form des Marktes ist die Commons-based Peer Production (in etwa Allmende-basierte partnerschaftlicher Produktion), welche sich zwar in der Nische der freien Software- und Wissensproduktion teilweise hat etablieren können. In der Produktion materieller Güter ist partnerschaftliche Produktion hingegen unterentwickelt, und wäre staatlicherseits ordnungspolitisch unerwünscht. Soweit ich erkenne, ist aber gerade die Form einer Allmende-basierte Partnerschaft etwa in der Landwirtschaft notwendig, um den Treibhausgasausstoß und gleichzeitig die Ausbeutung der Menschen im Arbeitsprozeß reduzieren zu können, Rosenkohl (Diskussion) 23:45, 6. Jan. 2016 (CET)
- "befangen in einer Vorwurfshaltung" - mir geht es erst mal darum, die untauglichen Argumente, die von der Freie-Markt-Lobby stammen, auszuräumen, damit der Rest von uns sich um das Problem kümmern kann. Die Lobby sollte bei dem Problem wegen erwiesener Inkompetenz/Unredlichkeit nichts zu sagen haben dürfen. --Hob (Diskussion) 09:53, 7. Jan. 2016 (CET)
- Und genau das ist die Geisteshaltung, die die ganze Klima-Sache immer wieder in ein schiefes Licht rückt und praktisch automatisch Widerstand erzeugt. "Nur wir sind der Kreis der wahren Erleuchteten und wir bestimmen, wer zu uns gehört." Alle anderen müssen ins Lächerliche gezogen und am besten mundtot gemacht werden. Aber so ist das keine Wissenschaft, sondern Religion. Dabei basieren alle Vorhersagen, wie sollte es anders sein, auf Modellen. Und bei denen ist das, was hinten heraus kommt, trotz Supercomputern immer noch davon abhängig, was man vorne reingesteckt hat. Die fachverwandten Meteorologen arbeiten ebenfalls mit solchen Modellen und reklamieren gern mal 90%ige Trefferquoten, aber kein Meteorologe würde sein Leben darauf verwetten, dass morgen in Berlin-Pankow 6 mm Niederschlag fallen. Versteh mich nicht falsch, ich glaube auch, dass der Mensch einen erheblichen Anteil an der Klimaerwärmung hat und dass dicke Eisbären oder die Tatsache, dass vor 1000 Jahren irgendwo Wein wuchs, nur marginale Bedeutung haben. Und wenn alle Prognosen nach oben zeigen, wäre es unsinnig, mit einer anderen Richtung zu rechnen. Selbst, wenn der menschliche Anteil nur gering wäre, gäbe es ausreichend Gründe, um erneuerbare Energien einzusetzen. Aber warum wird das von manchen Seiten immer wie ein Glaubensgrundsatz verkauft? Das sieht eben nicht aus, wie "sich ums Problem kümmern". Und manche Aspekte werden anscheinend völlig ausgeblendet, z.B. der Bevölkerungsanstieg von jetzt 7 auf 11 Milliarden im Jahr 2100, überproportional in Afrika. Womit werden wohl die hinzugekommenen 4 Milliarden Menschen ihre Suppe kochen? Selbst wenn man sie alle mit Solaröfen ausstatten könnte, würde deren Produktion wahrscheinlich die Umwelt so stark belasten, dass gar keine Sonne mehr den Erdboden erreicht. Wer gegen den Klimawandel ist, müsste eigentlich für sofortige Geburtenkontrolle kämpfen.--Optimum (Diskussion) 21:54, 7. Jan. 2016 (CET)
- "das ist die Geisteshaltung" - Nein. Manche Fragen sind unklar, und manche sind es nicht. Die angebliche Unsicherheit der Modelle, die du vorbringst, stammt aus der Strategie Fear, Uncertainty and Doubt, die von der Klimaleugnungs-Industrie verwendet wird und die von den gleichen Leuten (Frederick Seitz, Fred Singer usw.) vorher zur Leugnung des Zusammenhangs zwischen Tabak und Krebs verwendet wurde. Tatsächlich sind die Vorhersagen der Modelle viel besser, als diese Leute behaupten - man kann das nachprüfen, und die Klimatologen tun das dauernd. Deswegen sind sie ja inzwischen davon überzeugt. Das sind keine Anfänger. Die Behauptung "man weiß nichts Genaues" hat lange genug funktioniert, und so langsam erkennen auch Teile der Öffentlichkeit, dass sie falsch ist, nachdem es den Klimatologen schon länger klar war.
- Es geht mir darum, dass die Lügner und Stümper in den Denkfabriken nicht mehr fälschlich für glaubwürdig gehalten werden. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Pseudowissenschaften und mit den Unterschieden zur Wissenschaft, und das hier ist ein klassischer, eindeutiger Fall. Ich habe etliche Bücher zum Thema gelesen, von beiden Seiten, und informiere mich auch auf Websites beider Seiten. Sobald man ein Argument im Detail nachprüft, merkt man, welche Seite die Anfängerfehler macht, und es ist immer die gleiche Seite. Das ist kein "Glaubensgrundsatz", sondern eine Folgerung aus der Beschäftigung mit dem Thema. --Hob (Diskussion) 01:08, 8. Jan. 2016 (CET)
- Und schwupp, schon wieder passiert. Ich habe gar nichts über die Qualität der Modelle gesagt, aber durch einen Nebensatz bin ich plötzlich ein Freund der krebsverharmlosenden Schergen der Tabakindustrie. Vielleicht hat auch Charles Manson oder Caligula diese mir unterstellte Strategie schon mal benutzt, für die Sache völlig irrelevant, aber jetzt, wo ich behauptet habe, dass Tabakrauch völlig unschädlich ist, muss man sich mit meinen anderen Aussagen ja gar nicht mehr befassen. Dabei ist es ganz logisch und kein Klimatologe würde bezweifeln, dass was "hinten heraus kommt, ... immer noch davon abhängig ist, was man vorne reingesteckt", denn die Durchschnittstemperatur von 2050 ist ja abhängig davon, was wir 2016 bis 2049 mit unserer Umwelt machen. Und das müssen wir heute einschätzen oder in den folgenden Jahren nach und nach "reinstecken". (Damit hier kein Zweifel aufkommt, ich weiß auch, dass selbst eine drastische CO2-Reduktion, zumindest wegen des langen Nachlaufs immernoch zu einem Temperaturanstieg führt.) Da liegt eben der Unterschied zu den anderen Wissenschaften. Zu einem Physiker, der nicht mit der Kopenhagener Deutung der Quantenphysik übereinstimmt, kämen keine Interessengruppen und würden versuchen, ihn "mundtot" zu machen. Aber in der Religion ist es ja so, dass mehrere Leute, die an den selben Gott glauben, sich trotzdem als Ungläubige bezeichnen, weil sie ihn nicht mit den selben Worten verehren. Wir kriegen hier wohl keinen Konsens mehr hin und Eike guckt schon ganz böse, weil dieser Thread so lang ist. Daher EOF von mir und freundliche Grüße. --Optimum (Diskussion) 18:56, 8. Jan. 2016 (CET)
- "Schwupp" ist eben nicht passiert. Du behauptest nur, es sei passiert. Ich habe dich weder als Freund von irgendjemandem bezeichnet, noch betrifft mich eine der weiteren Fantasien, die du hier ausbreitest. Insbesondere habe ich nicht behauptet, dass du was über Tabakrauch behauptet hättest. Ich halte dich lediglich für jemanden, der der Idee verfallen ist, dass alle Meinungen respektiert werden müssen (außer der Meinung, dass es Meinungen gibt, die nicht respektiert werden müssen - die kann man beliebig runtermachen). Ab dem Nebensatz "aber jetzt, wo ich behauptet habe, dass Tabakrauch völlig unschädlich ist" habe ich also nicht mehr weiter gelesen, weil ich dich nicht mehr ernst nehmen kann. Wenn du sowas in Zukunft vermeiden willst, solltest du zuhören, was deine Gesprächspartner wirklich sagen, und dir keine Märchen ausdenken. EOD. --Hob (Diskussion) 10:59, 11. Jan. 2016 (CET)
- Und schwupp, schon wieder passiert. Ich habe gar nichts über die Qualität der Modelle gesagt, aber durch einen Nebensatz bin ich plötzlich ein Freund der krebsverharmlosenden Schergen der Tabakindustrie. Vielleicht hat auch Charles Manson oder Caligula diese mir unterstellte Strategie schon mal benutzt, für die Sache völlig irrelevant, aber jetzt, wo ich behauptet habe, dass Tabakrauch völlig unschädlich ist, muss man sich mit meinen anderen Aussagen ja gar nicht mehr befassen. Dabei ist es ganz logisch und kein Klimatologe würde bezweifeln, dass was "hinten heraus kommt, ... immer noch davon abhängig ist, was man vorne reingesteckt", denn die Durchschnittstemperatur von 2050 ist ja abhängig davon, was wir 2016 bis 2049 mit unserer Umwelt machen. Und das müssen wir heute einschätzen oder in den folgenden Jahren nach und nach "reinstecken". (Damit hier kein Zweifel aufkommt, ich weiß auch, dass selbst eine drastische CO2-Reduktion, zumindest wegen des langen Nachlaufs immernoch zu einem Temperaturanstieg führt.) Da liegt eben der Unterschied zu den anderen Wissenschaften. Zu einem Physiker, der nicht mit der Kopenhagener Deutung der Quantenphysik übereinstimmt, kämen keine Interessengruppen und würden versuchen, ihn "mundtot" zu machen. Aber in der Religion ist es ja so, dass mehrere Leute, die an den selben Gott glauben, sich trotzdem als Ungläubige bezeichnen, weil sie ihn nicht mit den selben Worten verehren. Wir kriegen hier wohl keinen Konsens mehr hin und Eike guckt schon ganz böse, weil dieser Thread so lang ist. Daher EOF von mir und freundliche Grüße. --Optimum (Diskussion) 18:56, 8. Jan. 2016 (CET)
Der Klimawandel facht die Innovationsfreudigkeit des Menschen an. In einem Artikel der Süddeutschen (Link habe ich grad nicht) wurde schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß durch die Klimaveränderung am Ende der letzten Eiszeit der Mensch das Angeln lernte. Nun stellt man fest, daßauch durch das "Jahr ohne Sommmer" ebenfalls Innovationen befördert wurden.
Alle Busse (Linien- und Reisebusse!!) stellen bei langem Halt den Motor nicht aus!! In der ganzen Welt. Wieviel co2 oder Feinstaub wird dadurch in die Luft geblasen? Aber das stört keine Sau... Busse sind genau wie Autos richtige Dreckschleudern!!!--Hopman44 (Diskussion) 22:13, 12. Jan. 2016 (CET)
5. Januar 2016
IE11: PDF ohne speichern öffnen
Wenn ich einen PDF-Link anklicke, fragt der IE seit kurzem "Wie möchten Sie mit xx.pdf verfahren?" Auswahlmöglichkeiten sind
- Öffnen (Die Datei wird nicht automatisch gespeichert)
- Speichern
- Speichern unter
Wähle ich die erste Option aus, geschieht aber nicht das Angekündigte, sondern am unteren Rand erscheint ein Balken "Möchten Sie xx.pdf von www.xyz.com speichern?" Nach der Auwahl von "Speichern" kann die Datei geöffnet werden und wurde auch im Downloads-Ordner abgespeichert.
Wie bekomme ich das alte Verhalten wieder, wo direkt ohne Nachfrage geöffnet wird (nicht im Browser, sondern im Acrobat Reader), ohne dass vorher gespeichert werden muss?
Danke --11:14, 5. Jan. 2016 (CET) (ohne Benutzername signierter Beitrag von IEprob.123 (Diskussion | Beiträge))
- In der Systemsteuerung unter
Indischen OptionenInternetoptionen oder im IE unter Optionen Programme und Dateien bzw. Dateien den PDF-Betrachter entfernen. - Sicherheitshinweis nebenbei: Im Acrobat Reader in den Voreinstellungen (STRG+K), unter „Java Script“ die die Ausführung dessen untersagen (Checkbox abwählen=Haken rausnehmen). --Hans Haase (有问题吗) 13:03, 5. Jan. 2016 (CET) Sag mal „Internet“ – „Inder nett!“
- Kann dort nirgends den PDF-Betrachter entfernen. --IEprob.123 (Diskussion) 16:38, 5. Jan. 2016 (CET)
- Welches Windows verwendest Du? IE11 gibt es für Windows 7, 8, 8.1 und 10. Welchen Adobe/Acrobat Reader verwendest Du? --Rôtkæppchen₆₈ 01:38, 6. Jan. 2016 (CET)
- Win 7. Adobe Reader XI. --IEprob.123 (Diskussion) 10:20, 7. Jan. 2016 (CET)
- Diese Kombination hab ich nicht. Ich kann nur Vista / XI oder 7 / DC bieten. --Rôtkæppchen₆₈ 20:24, 7. Jan. 2016 (CET)
- [9] verweist auf [10] und dürfte Deine Lösung sein. --Hans Haase (有问题吗) 13:30, 10. Jan. 2016 (CET)
- Das hatte ich schon erfolglos versucht. Aktiviere ich das Addon, wird die PDF im Browser angezeigt, deaktiviere ich es, kommt wieder die Speichern-Abfrage. --IEprob.123 (Diskussion) 08:43, 11. Jan. 2016 (CET)
- Du möchtest, dass der Arcobat Reader nach dem Download die Datei öffnet. Mit der App tut er eingebettet das im Fenster des IE per ActiveX. Soll der Arcobat Reader selbst öffnen, lade eine größere PDF-Datei herunter und wähle öffnen. Mit der Checkbox auswählen, dass dies immer mit dieser Art von Datei (PDF) geschehen soll. Zuvor muss PDF. Firefox macht es so,[11] IE11 muss es auch können. Dieser Dialog[12] erscheint beim neueren IE unten. Die Optionen sind dort ebenso auswählbar. --Hans Haase (有问题吗) 12:19, 11. Jan. 2016 (CET)
- Danke für deine Bemühungen, leider nicht zielführend. Wie ganz oben beschrieben, führt "Öffnen" nicht zum angekündigten Verhalten ("Die Datei wird nicht automatisch gespeichert" [13]), sondern es muss dann trotzdem gespeichert werden. Ich möchte, dass beim Klick auf einen Link die PDF im Adobe Reader geöffnet wird. Ohne irgendwelche Buttons dazwischen. --IEprob.123 (Diskussion) 23:27, 11. Jan. 2016 (CET)
- Du möchtest, dass der Arcobat Reader nach dem Download die Datei öffnet. Mit der App tut er eingebettet das im Fenster des IE per ActiveX. Soll der Arcobat Reader selbst öffnen, lade eine größere PDF-Datei herunter und wähle öffnen. Mit der Checkbox auswählen, dass dies immer mit dieser Art von Datei (PDF) geschehen soll. Zuvor muss PDF. Firefox macht es so,[11] IE11 muss es auch können. Dieser Dialog[12] erscheint beim neueren IE unten. Die Optionen sind dort ebenso auswählbar. --Hans Haase (有问题吗) 12:19, 11. Jan. 2016 (CET)
- Das hatte ich schon erfolglos versucht. Aktiviere ich das Addon, wird die PDF im Browser angezeigt, deaktiviere ich es, kommt wieder die Speichern-Abfrage. --IEprob.123 (Diskussion) 08:43, 11. Jan. 2016 (CET)
- [9] verweist auf [10] und dürfte Deine Lösung sein. --Hans Haase (有问题吗) 13:30, 10. Jan. 2016 (CET)
- Diese Kombination hab ich nicht. Ich kann nur Vista / XI oder 7 / DC bieten. --Rôtkæppchen₆₈ 20:24, 7. Jan. 2016 (CET)
- Win 7. Adobe Reader XI. --IEprob.123 (Diskussion) 10:20, 7. Jan. 2016 (CET)
- Welches Windows verwendest Du? IE11 gibt es für Windows 7, 8, 8.1 und 10. Welchen Adobe/Acrobat Reader verwendest Du? --Rôtkæppchen₆₈ 01:38, 6. Jan. 2016 (CET)
- Kann dort nirgends den PDF-Betrachter entfernen. --IEprob.123 (Diskussion) 16:38, 5. Jan. 2016 (CET)
Geschäftsmodell
Welche Fakten über ein Unternehmen (Geschäftsmodell) dürfen eigentlich juristisch legal kommuniziert werden?--Muroshi (Diskussion) 11:21, 5. Jan. 2016 (CET)
- Alle, soweit nicht gesetzlich oder vertraglich verboten.--Vsop (Diskussion) 11:38, 5. Jan. 2016 (CET)
- Google mal nach "Verschwiegenheitspflicht", ignoriere den WP-Artikel und schau Dir die Seiten der Handels-/Handwerkskammern an. Da stehen einige Beispiele für alles, was nicht** geht. Gruß, --Benutzer:Apierta 18:28, 5. Jan. 2016 (CET)
- Warum soll ich den WP-Artikel denn ignorieren? Ich spreche übrigens nicht aus der Mitarbeiterperspektive (Verschwiegenheitspflicht). --Muroshi (Diskussion) 22:38, 5. Jan. 2016 (CET)
- Na, weil der WP-Artikel die ärztliche/anwältliche Schweigepflicht meint, und das was anderes als die Mitarbeiter-Verschwiegenheitspflicht ist. Wenn es Dir aber um die offenbar gar nicht geht, solltest Du vieleicht ein bisschen exakter sagen, was Du überhaupt wissen willst. Gruß, --Benutzer:Apierta 13:40, 6. Jan. 2016 (CET)
- Ein Beispiel: Darf ich das Geschäftsmodell von Fielmann als Konsumentenschützer publik machen?--85.4.233.141 00:52, 7. Jan. 2016 (CET)
- Das hilft immer noch nicht weiter. Was verstehst du hier genau unter „Geschäftsmodell“? --Jossi (Diskussion) 11:06, 8. Jan. 2016 (CET)
- Dazu gibt es keine eindeutge Definition: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsmodell Womit das Unternehmen Geld erwirtschaftet, wie seine Margen strukturiert sind, die Art und Weise wie es seine Produkte verkauft, Absatzkanäle, Nachhaltigkeit etc.--85.4.233.141 12:33, 8. Jan. 2016 (CET)
- Solange du nicht gegen vertragliche Verpflichtungen verstößt, keine dir anvertrauten oder auf illegalem Wege beschafften Informationen benutzt, deine Behauptungen gerichtsfest belegen kannst und keine Schmähkritik betreibst, kannst du selbstverständlich die Geschäftspolitik einer Firma öffentlich kritisieren. --Jossi (Diskussion) 21:53, 10. Jan. 2016 (CET)
- Illegal beschaffte Infos zu benutzen ist illegal? --Distelfinck (Diskussion) 22:03, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich meinte natürlich Informationen, die du dir auf illegale Weise beschafft hast. Da illegal=ungesetzlich, könntest du damit Ärger bekommen. (Whistleblower gehen dieses Risiko bewusst ein.) --Jossi (Diskussion) 16:17, 11. Jan. 2016 (CET)
- Hat der Deutsche Staat mit Schweizer Bankkundendaten auch schon gemacht. Sogar gekauft hat er sie. Aber Staatsakteure stehen vielleicht ohnehin in einer anderen Kategorie.--85.4.233.141 21:12, 11. Jan. 2016 (CET)
- Was ist mit Kundenkommunikation im Geschäft (Beispiel Fielmanns übliche handschriftliche Preis-Notiz: Billig, Mittler, Spitzenoptik). Darf ich die Zettel im Laden fotografieren und die Bilder veröffentlichen?--85.4.233.141 21:10, 11. Jan. 2016 (CET)
- Im Laden herrscht Hausrecht. Man kann Dir das Fotografieren dort untersagen. Es heimlich zu tun, kann zum Hausverbot führen. --Blutgretchen (Diskussion) 21:27, 11. Jan. 2016 (CET)
- Das wäre dann schon zu spät. :) --85.4.233.141 23:48, 11. Jan. 2016 (CET)
- Im Laden herrscht Hausrecht. Man kann Dir das Fotografieren dort untersagen. Es heimlich zu tun, kann zum Hausverbot führen. --Blutgretchen (Diskussion) 21:27, 11. Jan. 2016 (CET)
- Was ist mit Kundenkommunikation im Geschäft (Beispiel Fielmanns übliche handschriftliche Preis-Notiz: Billig, Mittler, Spitzenoptik). Darf ich die Zettel im Laden fotografieren und die Bilder veröffentlichen?--85.4.233.141 21:10, 11. Jan. 2016 (CET)
- Illegal beschaffte Infos zu benutzen ist illegal? --Distelfinck (Diskussion) 22:03, 10. Jan. 2016 (CET)
- Solange du nicht gegen vertragliche Verpflichtungen verstößt, keine dir anvertrauten oder auf illegalem Wege beschafften Informationen benutzt, deine Behauptungen gerichtsfest belegen kannst und keine Schmähkritik betreibst, kannst du selbstverständlich die Geschäftspolitik einer Firma öffentlich kritisieren. --Jossi (Diskussion) 21:53, 10. Jan. 2016 (CET)
- Dazu gibt es keine eindeutge Definition: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsmodell Womit das Unternehmen Geld erwirtschaftet, wie seine Margen strukturiert sind, die Art und Weise wie es seine Produkte verkauft, Absatzkanäle, Nachhaltigkeit etc.--85.4.233.141 12:33, 8. Jan. 2016 (CET)
- Das hilft immer noch nicht weiter. Was verstehst du hier genau unter „Geschäftsmodell“? --Jossi (Diskussion) 11:06, 8. Jan. 2016 (CET)
- Ein Beispiel: Darf ich das Geschäftsmodell von Fielmann als Konsumentenschützer publik machen?--85.4.233.141 00:52, 7. Jan. 2016 (CET)
- Na, weil der WP-Artikel die ärztliche/anwältliche Schweigepflicht meint, und das was anderes als die Mitarbeiter-Verschwiegenheitspflicht ist. Wenn es Dir aber um die offenbar gar nicht geht, solltest Du vieleicht ein bisschen exakter sagen, was Du überhaupt wissen willst. Gruß, --Benutzer:Apierta 13:40, 6. Jan. 2016 (CET)
- Warum soll ich den WP-Artikel denn ignorieren? Ich spreche übrigens nicht aus der Mitarbeiterperspektive (Verschwiegenheitspflicht). --Muroshi (Diskussion) 22:38, 5. Jan. 2016 (CET)
- Google mal nach "Verschwiegenheitspflicht", ignoriere den WP-Artikel und schau Dir die Seiten der Handels-/Handwerkskammern an. Da stehen einige Beispiele für alles, was nicht** geht. Gruß, --Benutzer:Apierta 18:28, 5. Jan. 2016 (CET)
Historische und wohl sehr schwierige Musikfrage
Gitarr(enkompon)ist Kaspar Joseph Märtz, der sonst in Wien tätig war, soll in der Saison 1841/1842 ein Konzert in Berlin gegeben haben, eventuell im Opernhaus (der heutigen Lindenoper), also irgendwann zwischen Herbst 1841 und Frühjahr 1842. Dabei heißt Konzert nach damaligen Gepflogenheiten nicht unbedingt, dass nur er gespielt hat; vermutlich gab es im Verlauf der Veranstaltung Darbietungen mehrerer Musiker. Hat jemand nähere Informationen? Ein Datum? Eine Quelle gar? Danke, --NfdA (Diskussion) 17:49, 5. Jan. 2016 (CET)
- Hier einmal grob: [https://books.google.de/books?id=84INS9GBUCcC&pg=PA3=false#v=onepage&q&f=false Selected Operatic Fantasies. --G-Michel-Hürth (Diskussion) 18:21, 5. Jan. 2016 (CET)
- Mit Details zu Berlin kann ich auch nicht dienen; aber ein paar Infos zu anderen Auftritten während dieser Reise findet man schon: Dresden, Breslau, Prag. lg, --Niki.L (Diskussion) 12:20, 6. Jan. 2016 (CET)
- "For the dates and locations of Mertz's known concert activity see Stempnik, “Caspar Joseph Mertz,” 92-94" heißt es in Brian Torosians biographischen Abriss [14]. Berlin war zum damaligen Zeitpunkt 1841 m.W. nicht die führende Musikstadt in Deutschland, so daß vermutlich genauere Zeit- und Ortsangaben für das angebliche Konzert nicht in der Musikpresse überliefert sind, Rosenkohl (Diskussion) 13:37, 6. Jan. 2016 (CET)
- Herzlichen Dank zusammen, ich wusste ja, dass es schwierig sein konnte... Sollte noch jemand das Berliner Datum finden, immer her damit; ich schaue ab und zu mal vorbei (bin nicht jeden Tag am Netz). NfdA (Diskussion) 15:43, 7. Jan. 2016 (CET)
- Allerdings werden Themen hier nach dem dritten Tag der Untätigkeit archiviert. --Speravir (Disk.) 01:45, 8. Jan. 2016 (CET)
- Hm. Ein Konzert 1841/1842 im Opernhaus sollte eigentlich einen Niederschlag in der Berliner Presse (zumindest für die "gebildeten Stände") gefunden haben. Was über die Bibliotheken nicht erreichbar ist, könnte vielleicht im Archiv des Dortmunder Insituts für Zeitungsforschung zu finden sein. (Der Artikel Institut für Zeitungsforschung spiegelt leider nicht angemessen die Einzigartigkeit und Bedeutung dieser Einrichtung). --2003:45:465A:9300:9C16:4AF5:EAC:E69 23:17, 8. Jan. 2016 (CET)
- Allerdings werden Themen hier nach dem dritten Tag der Untätigkeit archiviert. --Speravir (Disk.) 01:45, 8. Jan. 2016 (CET)
- Herzlichen Dank zusammen, ich wusste ja, dass es schwierig sein konnte... Sollte noch jemand das Berliner Datum finden, immer her damit; ich schaue ab und zu mal vorbei (bin nicht jeden Tag am Netz). NfdA (Diskussion) 15:43, 7. Jan. 2016 (CET)
- "For the dates and locations of Mertz's known concert activity see Stempnik, “Caspar Joseph Mertz,” 92-94" heißt es in Brian Torosians biographischen Abriss [14]. Berlin war zum damaligen Zeitpunkt 1841 m.W. nicht die führende Musikstadt in Deutschland, so daß vermutlich genauere Zeit- und Ortsangaben für das angebliche Konzert nicht in der Musikpresse überliefert sind, Rosenkohl (Diskussion) 13:37, 6. Jan. 2016 (CET)
Danke für den Hinweis auf das Zeitschriftenarchiv; betrachtet man die deutschen Zeitschriftenlandschaft des 19. Jahrhunderts genauer, dann merkt man allerdings, daß viele erst nach 1841 gegründet worden sind. Dies ist auch wenig überraschend, lag doch die Presselandschaft nach den Karlsbader Beschlüssen in Folge von Restauration und Zensur darnieder.
Überdies sind unter den bereits digitalisierten Jahrgängen einer Zeitschrift oft kaum die frühen Jahrgänge der ersten Jahrhunderthälfte vorhanden.
Für Ankündigungen und Rezensionen Berliner Konzerte käme die Vossische Zeitung in Frage; bisher sind 9 ausgwählte Jahrgänge digitalisiert, darunter etwa 1839 und 1848, jedoch leider nicht 1841 oder 1842. [15]
Über Josephine Plantin heißt es: "für das Fachblatt der Münchner Gittaristen hatte sie eine biographische Skizze von J. K. Metz geschrieben. ['Gf.' 1901, Heft 10 ff.]" [16]. "Gf." ist wohl die Zeitschrift Der Gitarrefreund.
Allerdings sollen sich Mertz und Plantin erst Monate nach dem Berliner Auftritt kennengelernt haben, so daß eventuell über diese Phase nur wenig in Plantins biographischer Skizze steht.
Es wäre vielleicht hilfreich, aufgrund welcher Quelle vermutet wird, daß das Konzert im Operhaus stattgefunden haben soll, Rosenkohl (Diskussion) 12:28, 10. Jan. 2016 (CET)
- Nochmal besten Dank zusammen.
- Ja, auch die biographische Skizze der Witwe erwähnte das Konzert in Berlin; inzwischen habe ich das Konzertdatum gefunden - und zwar tatsächlich in der Vossischen Zeitung. Dieses wunderbare Blatt, das (zumindest für jene Jahren) von den Hofnachrichten ("Prinzessin ist abgereist") über einen reichhaltigen Auslandsteil bis hin zur Verlobungsanzeige und zum Haarwuchsmittel die damalige Zeit vor uns wiederauferstehen lässt, liegt weiterhin nicht digitalisiert vor. Man kann sich nur im Westhafen die Augen verderben, indem man den Mikrofilm in weiß auf Schwarz vor sich vorbeikurbelt, bis man fündig wird. Opernhaus stimmt übrigens nicht, es war im Schauspielhaus, vermutlich dem Schinkelbau, der ja noch bis vor wenigen Jahren so hieß (heute offiziell Konzerthaus). Damit hier erledigt, NfdA (Diskussion) 16:05, 11. Jan. 2016 (CET)
6. Januar 2016
Namensbestandteil "-enn"
Reine Neugierde auf den Namen, nicht auf die Vita der Person: Wie kommt das klein geschriebene "-enn" im Namen der Kriminologin Rita Steffes-enn zustande. --Maasikaru (Diskussion) 09:05, 6. Jan. 2016 (CET)
- GoogleBooks Suche => Steffes-lai, Steffes-mics (von miis — Bartholomäus herkommend) <= Play It Again, SPAM (Diskussion) 09:25, 6. Jan. 2016 (CET)
- Diese Antwort würde mich als Fragesteller eher verstören als weiterbringen. --Mauerquadrant (Diskussion) 10:04, 6. Jan. 2016 (CET)
- Hat es zunächst durchaus:-> Ich konnte aber dann über diese Hilfe ermitteln, dass es sich offenbar um eine lokale Sonderform aus Laubach (Eifel) handelt. Der Googlebook-Schnipsel gehört zu einem Aufsatz: Peter Wimmert: Die Eigennamen des Dorfes Laubach, Kr. Cochem : Ein Beitrag zur Kenntnis der Eifeler Mundart. in: Zeitschrift für Deutsche Mundarten, 6. Jahrg. (1911), S. 36-40, erhältlich über JSTOR. Was "-enn" bedeutet, weiss ich zwar immer noch nicht. Meine Neugier ist aber gestillt. Deshalb danke. --Maasikaru (Diskussion) 10:08, 6. Jan. 2016 (CET)
- Und wie kommt man bei der suche nach Steffes-enn auf die Idee nach Steffes-lai oder Steffes-mics zu suchen? Ohne Erklärung dieses Zwischenschrittes ist das eine lieblos hingeklatschte Antwort. --Mauerquadrant (Diskussion) 10:35, 6. Jan. 2016 (CET)
- Ich habe versucht, die Ref. zu verlinken. Wenn man das aber macht, wird genau dort abgeschitten, wo es interessant wird. Dann habe ich herumprobiert und gefunden, dass mit der vorgegebenen Suche "am meisten sichtbar ist". Zu meiner tiefen Befriedigung hat der Frager den Faden aufgenommen - und daran gezogen. Play It Again, SPAM (Diskussion) 10:49, 6. Jan. 2016 (CET)
- Und wie kommt man bei der suche nach Steffes-enn auf die Idee nach Steffes-lai oder Steffes-mics zu suchen? Ohne Erklärung dieses Zwischenschrittes ist das eine lieblos hingeklatschte Antwort. --Mauerquadrant (Diskussion) 10:35, 6. Jan. 2016 (CET)
- Hat es zunächst durchaus:-> Ich konnte aber dann über diese Hilfe ermitteln, dass es sich offenbar um eine lokale Sonderform aus Laubach (Eifel) handelt. Der Googlebook-Schnipsel gehört zu einem Aufsatz: Peter Wimmert: Die Eigennamen des Dorfes Laubach, Kr. Cochem : Ein Beitrag zur Kenntnis der Eifeler Mundart. in: Zeitschrift für Deutsche Mundarten, 6. Jahrg. (1911), S. 36-40, erhältlich über JSTOR. Was "-enn" bedeutet, weiss ich zwar immer noch nicht. Meine Neugier ist aber gestillt. Deshalb danke. --Maasikaru (Diskussion) 10:08, 6. Jan. 2016 (CET)
- Diese Antwort würde mich als Fragesteller eher verstören als weiterbringen. --Mauerquadrant (Diskussion) 10:04, 6. Jan. 2016 (CET)
„Now he discovered that secret from which one never recovers, that even in the most perfect love one person loves less profoundly than the other.“
- Ich würde mal in Richtung -senn denken. Der Steffen, der Senn(er) war als die Namen vergeben wurden.--2003:75:AF0A:E200:7161:9489:2EF4:BA32 10:40, 6. Jan. 2016 (CET)
Senner in der Eifel? „So findet man: Steffes-lai, Steffes-mies (von miis — Bartholomäus herkommend), Steffes- tun {tun = Anton), Steffes-ollig, Steffes-enn, Stoffes -hoff und. Steffes- Holländer.“ Nichts davon führt Wimmert auf eine Berufstätigkeit zurück. Auch heute noch bleiben manche Rätsel ungelöst. --Vsop (Diskussion) 10:59, 6. Jan. 2016 (CET)
- Fahr mal in die Eifel. Berge wie im Allgäu.--2003:75:AF0A:E200:25C7:3AB:F209:EF3E 13:37, 6. Jan. 2016 (CET)
- So isses! Vielleicht käme man durch Genealogie dieser Familien weiter (anfängliche Doppelbenennung, dann Verkürzung).
- Es hat (auch) nichts mit dem bretonischen Suffix "-enn" zu tun, aber die oben im Link angegebenen Beispiele machen klar, dass es wohl irgendeine Abkürzung eines Namenssuffixes (Heiligenname, topographischer Zusatz, ... whatever) ist, der erlaubte, die Vielfalt der Steffes (Stephans?) auseinanderzuhalten. Play It Again, SPAM (Diskussion) 11:02, 6. Jan. 2016 (CET)
- Besser verlinkt. Hört sich für mich an wie Änn, Koseform von Anna, ich bin aber etwas weiter südlich zuhause. --Pp.paul.4 (Diskussion) 12:33, 6. Jan. 2016 (CET)
- Teufel auch!
- TF: Da steht etwas von französischen Einwanderern - und hier haben Zugezogene dieser Regionen den Zunamen "von der Bretagne"... Vielleicht hat es doch etwas mit dem bretonischen "enn" zu tun? Die "Steffes-in" ? "in-Anhängung" - gabs ja im Deutschen auch. Play It Again, SPAM (Diskussion) 13:11, 6. Jan. 2016 (CET)
- Besser verlinkt. Hört sich für mich an wie Änn, Koseform von Anna, ich bin aber etwas weiter südlich zuhause. --Pp.paul.4 (Diskussion) 12:33, 6. Jan. 2016 (CET)
- Finnische Nachnamen wie z.B. Kimi Räikkönen? --Hans Haase (有问题吗) 13:26, 6. Jan. 2016 (CET)
gibt es zu dieser namens-auffälligkeit (wie nennt man das phänomen? gibts da ein fachbegriff?) einen wiki-artikel? --Dirk <°°> ID 30601 20:20, 6. Jan. 2016 (CET)
- Genanntname beschreibt ein ähnliches Phänomen. Und Benutzer:Hans Haase sei herzlich gratuliert zu der nicht zu bremsenden Schamlosigkeit, mit der er sich wieder mal mit Blödsinn hervortut. --Vsop (Diskussion) 13:22, 7. Jan. 2016 (CET)
Ist das vielleicht nur ein Druckfehler für eigentlich "-Enn", also ein gewöhnlicher Doppelname? Ansonsten könnte man ja bei wirklichem Interesse die Person selbst fragen, da sie offenbar noch lebt; Für Historiker z.B. ist so ein Umstand immer ein Glücksfall. --84.135.153.125 13:45, 7. Jan. 2016 (CET)
- Nein, das gehört so. Ich habe mal in der Moselgegend gelebt und kannte jemanden dieses Namens. Der wusste aber auch nur, dass es eben so ist. Grüße Dumbox (Diskussion) 13:53, 7. Jan. 2016 (CET)
- Der Artikel Patronym brachte mir Suchbegriffe, die zu einem Herrn aus Österreich führten.[17] Man könnte ihn fragen. --Hans Haase (有问题吗) 03:50, 8. Jan. 2016 (CET)
- Weitere Recherche deutet vage auf Färöer hin. --Hans Haase (有问题吗) 19:44, 10. Jan. 2016 (CET)
- Bitte, Hans! Warst du schon mal in der Eifel? Die österreichischen und ganz besonders die färöerischen Einflüsse dort halten sich in Grenzen. Grüße Dumbox (Diskussion) 19:53, 10. Jan. 2016 (CET)
hochrequente röntgenstrahlung,elektromagnetische frequenzen
Ich war 10jahre in haft bin seit 8monaten draußen,5jahre bedingt(21.2maßnahme).Und ich bin noch immer eingeschalten ..röntgenstrahlung,frequenzen?..,gedankenkontrolle,körperschmerzen/beeinflußung. Wie lange dauert es bis die abschalten?,Was ist das?,Wenn ich ins ausland fahre geht das weiter? Bitte um eine antwort. --178.165.129.58 13:58, 6. Jan. 2016 (CET)
- Hö? Was ist die Frage? Aluhut? --Magnus (Diskussion) für Neulinge
- ich würde mich da bei der Ursache nicht so konkret festlegen... meine Ärzte nennen es „Kopfschmerzsyndrom“ und Kraniomandibuläre Dysfunktion... dagegen soll man die Muskeln im Nacken und auf der Stirn und den Wangen selbst massieren... und nachts gegebenenfalls ne Aufbissschiene tragen... --Heimschützenzentrum (?) 14:19, 6. Jan. 2016 (CET)
- Aluhüte helfen nicht gegen Röntgenstrahlung, D'oh! Gegen die muss es schon ein Bleihut sein, wegen der ROHS-Regeln (fuck EU!) aber inzwischen kaum noch beschaffbar, am besten der OP gräbt eine Abraumhalde um und verhüttet sein Blei selbst. Aber Vorsicht. Durch das ständige Tragen des Bleihutes kann es zu Nackenschmerzen kommen. Siehe unten! -- Janka (Diskussion) 14:46, 6. Jan. 2016 (CET)
Aber wie lange machen die das nach der haft mit mir noch? (nicht signierter Beitrag von 178.165.129.58 (Diskussion) 15:15, 6. Jan. 2016 (CET))
- Versuche es mit Grundlagenwissen! Dann geht die Angst weg, die aus dem Unwissen und der damit verbundenen Verunsicherung resultiert. Wenn Du diesen Verschwörungstheorien länger unterliegst, wirst Du eigenmotiviert fremdgesteuert und ein geeigneter Kandidat zur Rückfälligkeit bleiben. Siehe Panoptismus als eine These. Es scheint als wärst Du gedanklich noch eingesperrt. --Hans Haase (有问题吗) 15:19, 6. Jan. 2016 (CET)
- Es kommt nicht auf das Material, sondern auf die Masse des Hutes an. Ein dünner Osmiumhut ist also genausogut wie ein extra dicker Aluhut. --Rôtkæppchen₆₈ 15:40, 6. Jan. 2016 (CET)
Chronologie wiederhergestellt --Vsop (Diskussion) 02:54, 7. Jan. 2016 (CET)
Ja ich bin irgenwie noch gedanklich eingesperrt.Ich bin mehrere bücher durchgegangen;haarp,bewusstseins-und gedankenkontrolle,internet...ect.Es stehen 10jahre und 5wochen bis 5monate danach bis abgeschalten wird.In haft hat mir jemand gesagt 6monate nach der haft ist es vorbei.Und jetzt habe ich ein buch (internet)gelesen über ein folteropfer(ähnlich wie bei mir),daß es nach einen jahr nach der haft vorbei war.Aber leider haben die nicht abgeschalten,kann mir wer weiterhelfen? (nicht signierter Beitrag von 178.165.129.58 (Diskussion) 16:01, 6. Jan. 2016 (CET))
- Meine Spekulation ist, dass du etwas hast, was ich als Laie "Verfolgungswahn" nennen würde. Du solltest mit einem Psychologen über diese Möglichkeit sprechen. --Eike (Diskussion) 16:07, 6. Jan. 2016 (CET)
- Gerade gegen dieses Paranodingsbums soll doch ein Aluhut helfen. --Rôtkæppchen₆₈ 16:10, 6. Jan. 2016 (CET)
Nein ich habe keine paranoja und ein aluhut hilft nicht,habe mir schon ein rho stab mini,masterchip anhänger,ray guard mobil gekauft(hilft nicht).
- Du hast einen Psychologen gefragt? --Eike (Diskussion) 16:30, 6. Jan. 2016 (CET)
- Wende Dich an Dr. Gernot Hochbürder. Der kan Dir mit ziemlicher Sicherheit helfen. Das ist zwar etwas teurer, aber effektiv und effizient. --Rôtkæppchen₆₈ 16:39, 6. Jan. 2016 (CET)
Ich habe schon einen psychologen/therapeuten wegen meiner persöhnlichkeit,bin ein ehemaliger gewalttäter.Das ist eine auflage vom gericht. Nur es ist der von der haft. (nicht signierter Beitrag von 178.165.129.58 (Diskussion) 16:47, 6. Jan. 2016 (CET))
- Falls du mit dem nicht klarkommst, kannst du versuchen einen anderen zu bekommen, dabei müsste aber wohl der bisherige Therapeut und auch das Gericht zustimmen. Solange die Röntgenstrahlen von außen anhalten, solltest du auf keinen Fall die Therapie abbrechen, und dich immer an alle Auflagen halten, sonst sitzt du sehr schnell wieder drinnen und Bewährung gibts dann keine mehr. Im Übrigen gilt, dass die Auskunft von Wikipedia keine Gesundheitsfragen beantworten kann und darf.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 18:01, 6. Jan. 2016 (CET)
Bei ernsthaften Hintergrund ernsthafte Angaben: --- ? Möglich. da obiges auch möglich war! --KleinerTimmy (Diskussion) 18:10, 6. Jan. 2016 (CET)
- Der Fragesteller hat nach eigenen Angaben als früherer Gewalttäter bis zur Nachsehung eines Strafrests zehn Jahre in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verbracht, weil er, „ohne zurechnungsunfähig zu sein, unter dem Einfluß seiner geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad eine Tat“ begangen hat, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, § 21 Abs. 2 StGB Österreich. Er meint, dort, aber auch in den acht Monaten seit seiner Haftentlassung Bestrahlung, Gedankenkontrolle ausgesetzt gewesen zu sein. Er fragt, wie lange das dauert, bis die abschalten, und ob er davor im Ausland sicher sei. Diese Frage ist keine „Gesundheitsfrage“, sondern wie folgt zu beantworten:
- Eine heimliche Bestrahlung von Anstaltsinsassen und/oder Haftentlassenen zum Zweck von Gedankenkontrolle und Beeinflussung findet auch in Österreich nicht statt. Zum einen wäre eine solche Bestrahlung als Körperverletzung strafbar. Zum anderen sind Strahlen zu einer wirksamen Gedankenkontrolle bisher nicht bekannt. Die Beschwerden des Fragestellers müssen deshalb andere Ursache haben, die vielleicht mit der ihm gerichtlich attestierten Abartigkeit im Zusammenhang stehen. Diese Ursachen festzustellen, sollte der Fragesteller sich mit seinem Psychologen bemühen, statt auf irgendwelche Geldschneider zu hören, die ihm in betrügerischem Gewinnstreben abstruse Verschwörungstheorien und wirkungsloses Strahlenschutzspielzeug andrehen. --Vsop (Diskussion) 02:54, 7. Jan. 2016 (CET)
Das ist der 21.1 von dem du schreibst;unzurechnungsfähig,geiestig abnorm,gefährlich und möglich in der psychatrie abzusitzen! Meiner ist der 21.2;zurechnungsfähig,geistig abnorm,gefährlich und nicht möglich in der psychatrie abzusitzen! Entlassung gibt es erst wenn die gefährlichkeit gering ist bei beiden,nur beim 21.1 mit einahmen durch medikamente (flüssig oder spritze). (nicht signierter Beitrag von 178.115.130.247 (Diskussion) 12:02, 7. Jan. 2016 (CET))
- Bitte sorgfältiger lesen: ich schrieb „ohne zurechnungsunfähig zu sein“, wie es wörtlich in § 21 Abs. 2 steht. --Vsop (Diskussion) 13:29, 7. Jan. 2016 (CET)
Wie auch immer: Es gibt keine Strahlung, die irgendwie aus der Ferne Gedanken beeinflussen, gar kontrollieren kann. Selbst, wenn man das wollte, wäre es nicht möglich. Rainer Z ... 20:09, 7. Jan. 2016 (CET)
Dann sind das frequenzen oder was anderes ich weiß es nicht genau was das ist.Aber ich weiß wie es wirkt,auf verschiedenen körperteilen schmerzen(abwechselnd),öfters urinieren,an den penis kratzen beim gehen,im gehirn redet er mit sich selbst und weist mich ab und zu auf personen in meiner nähe hin die auch angeschlossen sind,?körperkontrolle-gedankenempfang?(bewegungsabläufe sagt er mir voraus und die geräusche am körper).Die 10jahre haft wurden mir in meinen gedanken auch mitgeteilt,obwohl 8und 9jahre mir auch mitgeteilt wurden.Und jetzt; 6-12monate nach der haft werde ich abgeschalten.Ich habe viel schriftliches darüber gefunden;10jahre mindestens,5wochen bis 5monate danach und jetzt habe ich über ein ehemaligen gefolterten gelesen das es erst ein jahr nach der haft abgeschalten wurde (ähnlichkeiten wie bei mir). Und ich werde überwacht,bemerkbar. (nicht signierter Beitrag von 77.119.130.231 (Diskussion) 14:10, 8. Jan. 2016 (CET))
- und was spricht nun gegen Kraniomandibuläre Dysfunktion und Folie à deux...? --Heimschützenzentrum (?) 08:37, 9. Jan. 2016 (CET)
Weil das zu offen passiert und ich habe mehrere gesundheitsuntersuchungen gemacht mit guten ergebnissen.
- Ich denke, dass Du Dir unbedingt noch einmal eine zweite Meinung von einem anderen Psychater suchen solltest, wenn das möglich ist. Vieles spricht doch dafür, dass Dir eine innere Stimme etwas einredet und zwar so realistisch, dass Du es glaubst. Mit anderen Worten: Du wirst nicht bestraft, aber Dein Gehirn macht es Dir so realistisch vor, dass Du denkst, dass Du wirklich bestrahlt wirst. Dies deutet auf eine psychatrische Erkrankung hin. Hast Du früher mal härtere Drogen genommen? Das ist oft der Auslöser für solche Erkrankungen. Wie gesagt, versuche den Rat eines anderen Psychaters zu bekommen. 90.184.23.200 14:15, 10. Jan. 2016 (CET)
Nein ich habe keine psychatrische erkrankung.Aber ich habe früher härtere drogen genommen und hatte früher eine schwere persöhnlichkeitsstörung beim gutachten und gefährlich,einen teil dazu beigetragen haben die opfer weil sie gesagt haben das sie mich nicht kennen.Was aber nicht stimmt.Ich habe das ganze nicht gewußt beim gutachten erst später wie bush ca.2005 oder 2006 wien besuchte haben die losgelegt(und beamten,häftlinge).Ich habe geglaubt das die gas eingeschalten hatten,und hatte geglaubt das die anderen es besser verkraften als ich weil ich geschwächt war durch die drogeneinnahme früher.Dabei war ich es alleine (Elektromagnetismus...?),psychologisch kontrolliert!
- Du scheinst elektrosensibel zu sein. Hast Du schon einmal Urlaub an einem elektrofeldarmen Ort wie Eisenschmitt gemacht? --Rôtkæppchen₆₈ 19:36, 10. Jan. 2016 (CET)
Nein war ich noch nicht(Eisenschmidt).Aber wenn das doch stimmen würde was ich schreibe in welches land müsste ich fahren das das abgeschalten wird (bin aus österreich). Nein war ich noch nicht(Eisenschmidt).Aber wenn das doch stimmen würde was ich schreibe in welches land müsste ich fahren das das abgeschalten wird (bin aus österreich).
- http://www.prepaid-flat.net/eisenschmitt-fehlender-mobilfunk-fuehrt-zur-abwanderung/ Nach Aluhut und http://www.hochbuerder.org/ findet user:Rotkaeppchen68 es nun also amüsant und zu verantworten, dem Fragesteller „Urlaub im Funkloch“ vorzuschlagen. Gelegenheit dazu bietet indes auch Österreich mit seinen Bergen zuhauf: https://www.netztest.at/de/Karte. Nur wird das dem Fragesteller leider genau so wenig helfen wie „rho stab mini,masterchip anhänger,ray guard mobil“. Wie viel Zeit will er denn noch vertun, bevor er sein Misstrauen gegenüber dem ihm zugeteilten Psychologen endlich aufgibt? --Vsop (Diskussion) 21:38, 11. Jan. 2016 (CET)
- Kommt ein Paranoiker in eine Buchhhandlung und sagt zum Verkäufer: "Ich suche etwas über Verfolgungswahn." Darauf der Buchhändler: "Sie stehen hinter Ihnen!"--Astra66 (Diskussion) 10:46, 12. Jan. 2016 (CET)
Der ist nun mal von der haft,da gibt es keine hilfe sondern psychatrie,zurück in haft oder mehr elektrizität.Ich bin frei und kann mir nicht weiterhelfen in dieser Sache außer abwarten das abgeschalten wird. (nicht signierter Beitrag von 91.141.1.1 (Diskussion) 11:39, 12. Jan. 2016 (CET))
Wofür war der Milliardenkredit an die DDR (Strauß/Schalck-Golodkowski)?
Erhalt der DDR? Zweckgebunden in der BRD auszugeben, damit Wirtschaftsförderung für die BRD Industrie?--Wikiseidank (Diskussion) 15:44, 6. Jan. 2016 (CET)
- Ende des ersten Absatzes im Artikel Alexander Schalck-Golodkowski und dem ref folgen. --mw (Diskussion) 15:49, 6. Jan. 2016 (CET)
- (Schlecht geschriebene Prosa) Durfte die DDR das Geld frei verwenden? Musste dies in die BRD (für Warenkäufe) zurückfließen?--Wikiseidank (Diskussion) 16:15, 6. Jan. 2016 (CET)
- Die DDR hat auch öfters Kredite ausgehandelt und sie nicht abgerufen, auch später nach 1983 noch. Es sollte immer nur die Liquidität des Staatshaushaltes gewährleistet sein. Irgendwie war ja Wirtschaft und Staat eine Suppe. Ein Staatsbankrott der DDR war zum damaligen Zeitpunkt nicht im Interesse des Westens, wegen der unbekannten Reaktion der damaligen UDSSR. Also hat der Westen sich mit Bedingungen zurückgehalten, wohl hoffend, dass die sich zu einem passenderen Zeitpunkt überschulden. --2003:75:AF0A:E200:25C7:3AB:F209:EF3E 16:43, 6. Jan. 2016 (CET)
- Der Staatsbankrott der DDR ist eine Zeitungsente. --Pölkkyposkisolisti 16:44, 6. Jan. 2016 (CET)
- Da gebe ich Dir recht, die Wende kam aus politischen Gründen, der Bankrott stand lediglich vor der Tür.--2003:75:AF0A:E200:25C7:3AB:F209:EF3E 17:16, 6. Jan. 2016 (CET)
- Achwas? Natürlich eine unbequeme Meinung. Hier aber möglich. Sie sollte nur belegt werden. Grüße --KleinerTimmy (Diskussion) 18:12, 6. Jan. 2016 (CET)
- Da gebe ich Dir recht, die Wende kam aus politischen Gründen, der Bankrott stand lediglich vor der Tür.--2003:75:AF0A:E200:25C7:3AB:F209:EF3E 17:16, 6. Jan. 2016 (CET)
- Der Staatsbankrott der DDR ist eine Zeitungsente. --Pölkkyposkisolisti 16:44, 6. Jan. 2016 (CET)
- Wie kann ein Kredit in DM dem DDR Staatshaushalt in MDN Liquidität verschaffen? Kann man mir meine Vermutung ausreden, dass dieser Kredit auch nichts anderes war, als "Entwicklungshilfe", also Kredite mit der Verpflichtung davon im Kreditgeberland einzukaufen (und gewisse politische Zusagen einzuhalten)?--Wikiseidank (Diskussion) 21:08, 6. Jan. 2016 (CET)
- Was hat die DDR denn mit den Einnahmen aus den Intershops und dem Zwangsumtausch gemacht, wenn sie mit Westgeld gar nichts anfangen konnte? --Optimum (Diskussion) 22:20, 6. Jan. 2016 (CET)
- Der Kollege will nur etwas bestimmtes hören, trotzdem noch eine Antwort. Die DDR musste für ihre Wirtschaft um den bekannt hohen Qualitätsstandard zu halten viel Material im Westen gegen Devisen einkaufen. Alles gab es nicht im Ostblock und wenn, dann nicht zur Genüge oder nicht in gewünschter Qualität. Selbst der Rum und die Bananen aus Cuba kosteten Devisen. Probleme machten auch die (Zwangs-)Lieferungen in die Bruderländer, die nur wertloses Geld einbrachten.--2003:75:AF0A:E200:BC88:BF56:461A:3164 23:06, 6. Jan. 2016 (CET)
- Diese Darstellug ist stark vereinfachend. Die Wahrheit liegt dazwischen. Wohl war die DDR-Volkswirtschaft auf Gestattungsproduktion und Westexporte angewiesen, dennoch hätte ein Nichtzustandekommen von Milliardenkredit und Erdgas-Röhren-Geschäft nicht sicher einen DDR-Staatsbankrott ausgelöst. --Rôtkæppchen₆₈ 02:51, 7. Jan. 2016 (CET)
- Der Kollege will nichts bestimmtes hören, sondern ist auf der Suche nach Gegenargumenten zu seiner Vermutung, die dadurch entsteht, da es nirgendwo genauer beschrieben ist. Vielleicht können es nicht mal die Beteiligte der DDR erklären, weil sie es eigentlich auch nicht verstanden haben - siehe Zins-Swap-Derivat Geschäfte, die diverse Kommunen in den 2000ern abgeschlossen haben, ohne diese zu verstehen--Wikiseidank (Diskussion) 08:25, 7. Jan. 2016 (CET)
- Diese Darstellug ist stark vereinfachend. Die Wahrheit liegt dazwischen. Wohl war die DDR-Volkswirtschaft auf Gestattungsproduktion und Westexporte angewiesen, dennoch hätte ein Nichtzustandekommen von Milliardenkredit und Erdgas-Röhren-Geschäft nicht sicher einen DDR-Staatsbankrott ausgelöst. --Rôtkæppchen₆₈ 02:51, 7. Jan. 2016 (CET)
- Der Kollege will nur etwas bestimmtes hören, trotzdem noch eine Antwort. Die DDR musste für ihre Wirtschaft um den bekannt hohen Qualitätsstandard zu halten viel Material im Westen gegen Devisen einkaufen. Alles gab es nicht im Ostblock und wenn, dann nicht zur Genüge oder nicht in gewünschter Qualität. Selbst der Rum und die Bananen aus Cuba kosteten Devisen. Probleme machten auch die (Zwangs-)Lieferungen in die Bruderländer, die nur wertloses Geld einbrachten.--2003:75:AF0A:E200:BC88:BF56:461A:3164 23:06, 6. Jan. 2016 (CET)
- Was hat die DDR denn mit den Einnahmen aus den Intershops und dem Zwangsumtausch gemacht, wenn sie mit Westgeld gar nichts anfangen konnte? --Optimum (Diskussion) 22:20, 6. Jan. 2016 (CET)
- Die DDR hat auch öfters Kredite ausgehandelt und sie nicht abgerufen, auch später nach 1983 noch. Es sollte immer nur die Liquidität des Staatshaushaltes gewährleistet sein. Irgendwie war ja Wirtschaft und Staat eine Suppe. Ein Staatsbankrott der DDR war zum damaligen Zeitpunkt nicht im Interesse des Westens, wegen der unbekannten Reaktion der damaligen UDSSR. Also hat der Westen sich mit Bedingungen zurückgehalten, wohl hoffend, dass die sich zu einem passenderen Zeitpunkt überschulden. --2003:75:AF0A:E200:25C7:3AB:F209:EF3E 16:43, 6. Jan. 2016 (CET)
- (Schlecht geschriebene Prosa) Durfte die DDR das Geld frei verwenden? Musste dies in die BRD (für Warenkäufe) zurückfließen?--Wikiseidank (Diskussion) 16:15, 6. Jan. 2016 (CET)
Nebenziel war wohl auch das Kassieren der üblichen Vermittlerprovision (man munkelt konkret von 8,75 Mio DM). Ob sich Strauß und Schalck-Golodkowski das Geld geteilt haben oder schwarze Parteikassen gefüllt wurden ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Rentiert haben dürfte es sich vermutlich im persönlichen Bereich der Beteiligten. Benutzerkennung: 43067 08:28, 7. Jan. 2016 (CET)
- Die DDR benötigte für Geschäfte auf dem Weltmarkt Devisen. Da die eigene Mark für solcherlei Handel nämlich nichts wert war, waren Valutamark (Westgeld) hilfreich, denn mit Hilfe der DM konnte gehandelt werden. Ich verweise als Veranschaulichung immer wieder gerne auf die Kaffeekrise in der DDR, denn Kaffee konnte die DDR eben nur mit Dollar (oder eben DM) erwerben. Problematisch für die DDR Anfang der 1980er waren folgende Entwicklungen: durch die von Honecker durchgesetzte Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik erhöhten sich die Schulden (subventionierte Miet-, Lebensmittel-, Schuhpreise und dgl. mehr, für deren Herstellung eben z. T. auch Waren eingeführt werden mußten > höherer Devisenbedarf) zum anderen traf die DDR - wenn auch verspätet - die Ölkrise, da die UdSSR Anfang der 1980er Jahre die Preise an den Weltmark anglich. Um das zu verdeutlichen: Offiziell gab es in der DDR keine Preiserhöhungen. Wenn nun also ein Brötchen 5 Pf. kostete, dann sind darin ja auch Produktionskosten enthalten. Diese änderten sich aber im Laufe der Jahre (z. B. steigende Erdölpreise > Verteuerung des Diesels > höhere Produktionskosten). Der Staat mußte also immer stärker subventionieren. Je mehr die Bürger kauften, desto mehr mußte hergestellt werden, desto höhere Kosten. Kredite in Valutamark halfen da ungemein.--IP-Los (Diskussion) 14:51, 8. Jan. 2016 (CET)
- Hier wird zuviel durcheinander geschmissen. Erdöl aus der UdSSR wurde bestimmt nicht in DM gehandelt. Alternativen dazu konnte man sich auch nicht für DM auf dem Weltmarkt kaufen. Der "Weltmarkt" war auch bei eventuellem Vorhandensein von DM für die DDR (und RGW) nicht frei, siehe Embargos. Die "Kaffekrise" war in den 1980ern nicht mehr spürbar und mit Vietnam (habe jetzt keine Links, einfach googln) wurde die Möglichkeit geschaffen, Kaffee im sozialistischen Wirtschaftsgebiet zu beschaffen. (Noch heute profitiert der Weltmarkt von der Pionierarbeit der DDR im vietnamesischen Kaffeeanbau.). Zutreffend ist, dass die UdSSR durch die Veränderungen (Perestroika) die Wirtschaftsbeziehungen innerhalb des RGW und damit auch für die DDR verschlechterte. Die hier in Rede stehende 1 Mrd. DM hätte das langfristig jedoch nicht ausgleichen können und die Ökonomen der DDR (die sich natürlich erst mal gegen Parteibeschlüsse durchsetzen mussten) hatten ein langfristiges Denken (und kein Quartalsorientiertes, betriebswirtschaftliches)--Wikiseidank (Diskussion) 08:50, 9. Jan. 2016 (CET)
- Das Durcheinanderschmeißen sehe ich auch. Die Mark der DDR war eine reine Binnenwährung, nicht konvertibel und damit für den Handel außerhalb des RGW überhaupt nicht zu gebrauchen. Zwischen RGW-Ländern wurde mit Transferrubeln "bezahlt". Beliebt waren auch Kompensationsgeschäfte, wie dieses. Die Zahlungsunfähigkeit der DDR war wohl nicht nur eine Zeitungsente, sondern durchaus zu befürchten. Der Binnen"markt" im RGW-Bereich wäre nie ein Problem gewesen, aber die DDR musste viele Dinge im NSW-Gebiet kaufen und hatte da ein Außenhandelsdefizit, dazu den Mangel an Devisen, also konvertibler Währung, so dass ein Kredit in einer harten konvertiblen Währung schon half, auch um weitere "Konsumgüter" zu kaufen, um Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. --Hic et nunc disk WP:RM 09:37, 9. Jan. 2016 (CET)
- Hier wird zuviel durcheinander geschmissen. Erdöl aus der UdSSR wurde bestimmt nicht in DM gehandelt. Alternativen dazu konnte man sich auch nicht für DM auf dem Weltmarkt kaufen. Der "Weltmarkt" war auch bei eventuellem Vorhandensein von DM für die DDR (und RGW) nicht frei, siehe Embargos. Die "Kaffekrise" war in den 1980ern nicht mehr spürbar und mit Vietnam (habe jetzt keine Links, einfach googln) wurde die Möglichkeit geschaffen, Kaffee im sozialistischen Wirtschaftsgebiet zu beschaffen. (Noch heute profitiert der Weltmarkt von der Pionierarbeit der DDR im vietnamesischen Kaffeeanbau.). Zutreffend ist, dass die UdSSR durch die Veränderungen (Perestroika) die Wirtschaftsbeziehungen innerhalb des RGW und damit auch für die DDR verschlechterte. Die hier in Rede stehende 1 Mrd. DM hätte das langfristig jedoch nicht ausgleichen können und die Ökonomen der DDR (die sich natürlich erst mal gegen Parteibeschlüsse durchsetzen mussten) hatten ein langfristiges Denken (und kein Quartalsorientiertes, betriebswirtschaftliches)--Wikiseidank (Diskussion) 08:50, 9. Jan. 2016 (CET)
Hier wird zuviel durcheinander geschmissen. In der Tat. Die "Kaffekrise" war in den 1980ern nicht mehr spürbar und mit Vietnam (habe jetzt keine Links, einfach googln) wurde die Möglichkeit geschaffen, Kaffee im sozialistischen Wirtschaftsgebiet zu beschaffen. Ja, man begann mit ersten Projektierungen Ende der 70iger/Anfang der 80iger. Da Pflanzen aber auch Erntereife benötigen, rechnete man erst Ende der 80iger mit ersten kleinen Ernten. Die DDR hatte letzten Endes vom vietnamesischen Kaffee genau nichts. Soviel dazu. M. W. ging es um die Kreditfähigkeit/Bonität der DDR auf dem internationalen Bankenmarkt. Wie auch heute viele Staaten, wurde die DDR damals von Ratingagenturen schlecht bewertet. Der Kredit half, den Buchstaben und das Plus nach dem Buchstaben wieder auf ordentliches Niveau zu heben. Es geht also nicht darum, ob mit dem Kredit bestimmte Waren gekauft wurden, sondern es war eine geldpolitische Entscheidung. Warum ausgerechnet Kommunistenfresser Strauß zur weiteren Stabilität der DDR beitrug ist eine andere Geschichte. Hier ist sicher auch ein Blick auf das damalige Verhältnis CDU-CSU hilfreich.--scif (Diskussion) 10:35, 9. Jan. 2016 (CET)
- (BK) Hier wird nichts durcheinandergeworfen: Die UdSSR erhöhte in den 1970er Jahren die Preise für Erdöl stetig, um sie an das Weltmarktniveau anzupassen (zumal die DDR vorher durch den Wiederverkauf Gewinne erzielt hatte). Da die DDR dafür andere Güter lieferte, mußte sie mehr liefern. Die DDR mußte also mehr Leistungen für dieselbe Menge Öl aufbringen. Außerdem fehlten diese Güter für den Handel mit dem sogenannten Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet.
- Die Kaffeekrise habe ich nur als Veranschaulichung für die Wichtigkeit von Devisen gewählt. Aber: Die Beschaffung von Kaffee war auch danach immer noch ein Problem, soll heißen, die DDR mußte dafür immer mehr Geld ausgeben. Die DDR-Führung hatte registrieren müssen, daß die Ersatzlösungen Unmut unter der Bevölkerung auslösten. Man mußte also weiterhin (aus Sicht der Planungskommission) teuren Kaffee importieren. Natürlich wurde nun auch Vietnam gefördert, aber profitieren konnte die DDR davon nicht mehr, denn der massive Wachstum dieses Sektors setzte in Vietnam erst in den 1990er Jahren ein, da gab es die DDR nicht mehr. Die DDR war also bis 1990 von den Weltmarktpreisen abhängig, Vietnam bot da wenig Entlastung. Schaut man sich die Kaffeepreise in den 1980er Jahren an, dann zehrte das an den Devisenausgaben. Dieses Problem hatte die DDR natürlich auch mit anderen Waren.
- Was den Kredit betrifft: Die DDR hatte 1982 laut Bundesbank 25,1 Mrd. DM Schulden und damit ein Liquiditätsproblem, da kaum noch Banken DDR-Kredite finanzieren wollten. Der Kredit half, diese Schulden abzubauen, um so auch wieder stärkere Unterstützung durch Banken erlangen zu können.--IP-Los (Diskussion) 11:22, 9. Jan. 2016 (CET)
- Konsumgüter hat die DDR (erst mal, siehe unten) nicht im westlichen Ausland gegen DM gekauft. Das musste die DDR Produktion bzw. der RGW schon selbst schaffen. Anders könnte das bei Schlüsseltechnologien (bspw. IT) ausgesehen haben, aber dagegen stand ja bspw. COCOM. Zur Geldbeschaffung (Eigenkapitalnachweis) bei westlichen Banken ist mit Sicherheit absolut abwegig (wie sollten die zurückgezahlt werden?). Was in den 1980ern aufgefallen ist, dass Konsumgüter aus der BRD in der DDR (zumindest Berlin;o) verfügbar wurden, obwohl es ausreichende (wenn auch nicht so attraktive) Alternativen aus der DDR Konsumgüterproduktion gab, bspw.: Adidas Sportschuhe, Levis 501, VW Golf, HiFi, GEMA Rechte für westliche Popmusik usw.. Daher die Vermutung(!) die DDR konnte/musste mit dem Milliardenkredit westliche Konsumgüter beschaffen. Die BRD gab der DDR Geld, die vollständig in die BRD Wirtschaft zurückflossen = "Wirtschaftsförderung" nach dem Modell Entwicklungshilfe (oder Griechenland), Geldgeben mit der Verbindung von Bedingungen und gleichzeitigem vollständigen Rückfluss.--Wikiseidank (Diskussion) 11:29, 10. Jan. 2016 (CET)
- Die Produkte, die du meinst, wurden zumeist in der DDR hergestellt, erhältlich waren sie überwiegend per Genex.
- Konsumgüter hat die DDR (erst mal, siehe unten) nicht im westlichen Ausland gegen DM gekauft. Kaffee konnte man in der DDR nicht anbauen, die RGW konnte ihn auch nicht beschaffen, also mußte der im NSW erworben werden. Das galt auch für andere Rohstoffe. Dafür benötigte man harte Devisen (Dollar, DM).
- Zur Geldbeschaffung (Eigenkapitalnachweis) bei westlichen Banken ist mit Sicherheit absolut abwegig (wie sollten die zurückgezahlt werden?). So wie das auch heute noch geschieht - durch Handelsüberschüsse. Deshalb hat man vieles in den Westen exportiert. Die DDR arbeitete eng mit Westunternehmen zusammen (VW, Quelle, Aldi usw.) und lieferte die Waren dann in die Bundesrepublik. Problematisch war dann, daß bestimmte exportierte Waren dann im Inland fehlten (Beispiele: Radeberger, Wernersgrüner - im Osten gab es diese Biersorten nur begrenzt, z. B. in der Mitropa zu entsprechenden Preisen, Grabower Küßchen usw.) oder es gab sie nur in minderwertiger Qualität (Ausschußware).--IP-Los (Diskussion) 15:57, 10. Jan. 2016 (CET)
Hab ich bzgl. Kaffe und Liquidität was anderes behauptet? Es ist nur eine höchst abenteuerliche Vorstlleung, das mancher glaubt, das irgendwelche Westwaren konkret mit den Strauß-Milliarden bezahlt worden sind. Erstens halte ich es für kaum vorstellbar, das man da konkrete Ausgaben konkreten Waren zuordnen kann, zum anderen ist das Auftauchen westlicher Konsumgüter kein Indiz für die Straußmilliarden. Speziell beim so beliebten Thema Kaffe setzte die Staatliche Plankommission zu einem gewissen Prozentsatz auf Oma Erna, die Kaffee aus dem Westen mitbrachte bzw. auf die Westpakete. Bei anderen westlichen Konsumgütern fallen mir die Namen Delikat, Exquisit und Inter-Shop ein. Und wenn wir schon bei Sportschuhen sind: m. W. ließ eine Marke auch in der DDR herstellen, zum anderen lief da viel über den Leistungssport. Speziell im Fußball wurde in den 80igern z. T. bis in die Bezirksliga mit adidas gespielt.--scif (Diskussion) 19:15, 10. Jan. 2016 (CET)
- Es gab aber auch eine Adidas-Gestattungsproduktion im Ostblock. Somit waren Adidas-Schuhe auch für Transferrubel erhältlich. Auch hat die DDR Elektro-Hausgeräte und Unterhaltungselektronik auch nach Westdeutschland exportiert. Die Gestattungsproduktion wurde bereits genannt. Von den Praktica-Kameras wurde der Ausschuss in der DDR verkauft, die fehlerfreie Ware in Westdeutschland. Der westdeutsche Anbieter Foto-Quelle hat Orwo-Filme und -Fotopapiere (Vorkriegs-„Agfacolor Neu“ von 1936) unter der Eigenmarke Revue verkauft. --Rôtkæppchen₆₈ 19:25, 10. Jan. 2016 (CET)
- @scif Dich habe ich ja auch gar nicht gemeint, sondern Deinen Punkt sogar noch weiter ausgeführt. Die Strauß-Milliarden waren nicht dazu da, einfach mal Produkte zu erwerben, sondern die Liquiditätsprobleme zu beheben.
- @Rotkäppchen Da gab es ja eine Riesenpalette, z. B. auch Möbel, Strumpfhosen usw. Teilweise entfernte man dann im Westen den Hinweis auf das Herkunftsland.--IP-Los (Diskussion) 19:53, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich habe beides gesehen: Im Westen verkaufte Möbel und Geschirr mit „Hergestellt in der DDR“ bzw „Made in GDR“ auf der Rückseite und ein DDR-Radio mit Philips vorne- und „Made in Germany“ hintendrauf und
 auf einigen Bauteilen. Der Netzstecker des Radios hatte dieselbe Form wie der einer von meinem Großvater aus der DDR mitgebrachten Tischleuchte. --Rôtkæppchen₆₈ 22:25, 10. Jan. 2016 (CET)
auf einigen Bauteilen. Der Netzstecker des Radios hatte dieselbe Form wie der einer von meinem Großvater aus der DDR mitgebrachten Tischleuchte. --Rôtkæppchen₆₈ 22:25, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich habe beides gesehen: Im Westen verkaufte Möbel und Geschirr mit „Hergestellt in der DDR“ bzw „Made in GDR“ auf der Rückseite und ein DDR-Radio mit Philips vorne- und „Made in Germany“ hintendrauf und
Akku mit zu wenig Ampere laden gefährlich?
Hallo, hab schon Google & Co gefragt, aber nicht wirklich ne Antwort gefunden. Ich habe zu Weihnachten eine neue E-Dampfe geschenkt bekommen und bis dato über USB 3.0 geladen. Nun hab ich aber gelesen, dass das meinen Computer zerstören kann. Von meiner alten habe ich jedoch noch einen Wandstecker, der 5.0V bei 0.5A raushaut. Da USB 3.0 allerdings 0.9A ausgibt, frage ich mich, ob ich trotzdem mit dem Wandstecker, der per USB lädt, meine E-Dampfe laden kann, oder ist das zu gefährlich für den Akku (ist der hier [18]) --Odeesi talk to me rate me 20:52, 6. Jan. 2016 (CET)
- Das Problem krigt hier nicht der Akku, sondern das Ladegerät. Wenn deine E-Dampfe mehr Amper zieht als das Ladegerät liefern kann, überhitzt das Ladegerät (oder eben diesen Computerstromkrie des USB 3 versorgt). Du soltest also immer darauf schauen, dass das Ladegerät mehr Amper liefern kann als deine E-Dmapfe beziehen will. --Bobo11 (Diskussion) 22:06, 6. Jan. 2016 (CET)
- Wie soll ein Verbraucher mehr Strom ziehen als das Ladegerät liefern kann? Kannst mir das mal technisch erklären? Er kann möglicherweise mehr Strom ziehen, als die Quelle liefern sollte (wenn sie so blöd ist, das zu tun), aber nicht mehr, als sie liefern kann. Wo soll der denn herkommen? Und dafür, daß eine Stromquelle nicht mehr Strom abgibt, als für sie gut ist, sollte einklich deren Hersteller konstruktiv sorgen (Strombegrenzung). --Kreuzschnabel 07:16, 7. Jan. 2016 (CET)
- Mit dem kann ist logischerweise die Strommenge gemeint, die das Ladegerät auf immer und ewig lieferen kann 8Udn nicht der kurzfristig lieferbare). Also auf die Stromstärke, auf die das Ladegerät auch ausgelegt ist. Wenn die E-Dampfe 1.2 A beziehen will, dann sollte das Ladegerät mindestens 1.2A ausgeben können, ohne dabei überlastet zu werden. Sprich auf dem Typenschild des Ladegerät sollte in diesem Fall mindesten 1.2 A stehen. --Bobo11 (Diskussion) 09:40, 7. Jan. 2016 (CET)
- Wie soll ein Verbraucher mehr Strom ziehen als das Ladegerät liefern kann? Kannst mir das mal technisch erklären? Er kann möglicherweise mehr Strom ziehen, als die Quelle liefern sollte (wenn sie so blöd ist, das zu tun), aber nicht mehr, als sie liefern kann. Wo soll der denn herkommen? Und dafür, daß eine Stromquelle nicht mehr Strom abgibt, als für sie gut ist, sollte einklich deren Hersteller konstruktiv sorgen (Strombegrenzung). --Kreuzschnabel 07:16, 7. Jan. 2016 (CET)
- Der Akku darf da nicht ungeregelt dran. Batterycontroller bzw. Ladeschaltungen verhindern Überstrom, Überladen usw… Der USB sollte mit einer PTC-Sicherung – einer selbstrückstellenden Sicherung oder einem FET (Feldeffekttransistor, der selbst bei Überstom Schließt bzw. abregelt oder abgeregelt wird) ausgestattet sein. Aus Kostengründen ist er das oft nicht und es brennt ein filterndes Bauteil durch. Nur die alten Nickel-Cadmium-Akkus durften wegen des Memory-Effektes nur in vollständigen Zyklen und nicht im Schneckentempo geladen werden. --Hans Haase (有问题吗) 22:37, 6. Jan. 2016 (CET)
USB-Netzteile mit 3 Ampere gibt es für wenig Geld beim Elektronikhändler.Da lohnt es nicht, zuerst das alte Ladegerät zu ruinieren. Hier kommt es nämlich auf die Ladeschaltung der E-Dampfe an. Ist diese Ladeschaltung hinreichend intelligent, mit dem Ladegerät auszumachen, wieviel Strom sie ziehen darf, lädt sie auch an einem 500-mA-Ladegerät, nur abersechsmalzweimal so lang. Ist die Ladeschaltung der E-Dampfe doof, ziehst sie ohne nachzufragen0,9, 2,1 oder 31 Ampere und überhitzt oder zerstört so das Ladegerät.Für 3 Ampere ist eigentlich USB 3.1 Typ C zuständig, der kann und darf das.PCs haben aber üblicherweise USB 3.0 Typ A, der nur bis 1,5 Ampere spezifiziert ist. Je nach genauer Spezifikation der USB-3.0-Anschlüsse sind die Steckverbinder am PC elektrisch bis 5 A belastbar, der PC kann und darf aber vorher abregeln (oder kaputtgehen). --Rôtkæppchen₆₈ 22:38, 6. Jan. 2016 (CET)
- Naja, die Dampfe scheint schon was intelligenter zu sein. Is ne Wismec Presa TC75W, auch wenn ich den Akku niemals so auslasten würde... da wäre der Dampf mir dann zu heiss. Aber technisch beruht sie wohl auf der joytech eVic VTC Mini. --Odeesi talk to me rate me 23:18, 6. Jan. 2016 (CET)
- Eine Last im elektrischen Stromkreis kann nicht mehr Strom „ziehen“, als die Quelle abgibt. Die E-Dampfe kann also nicht mit Gewalt 0,9 A aus einem USB-Netzteil ziehen, das sich weigert, selbst im extremsten Fall, also dem Kurzschluß, mehr als 0,5 A zu liefern. Ich weiß nicht, wie das Schaltungskonzept heutiger USB-Anschlüsse in dieser Hinsicht aussieht, kann mir aber nicht so recht vorstellen, daß da auf Versorgungsseite groß was kaputtgehen soll. Am ehesten kann ich mir denken, daß der Last die 0,5 A, die sie bekommt, nicht reichen und der Akku deshalb gar nicht oder nicht richtig geladen wird. Inwieweit das der Fall ist, sollte dir einklich die Anleitung sagen, aber bei der Qualität heutiger Anleitungen hab ich da meine 2fel. --Kreuzschnabel 07:12, 7. Jan. 2016 (CET)
- Eine Quelle kann durchaus mehr Strom abgeben, als ihr guttut. Dann überhitzt die Stromquelle, geht kaputt oder die Sicherung brennt durch. Die oben verlinkte Dampfe hat einen Anschluss Mikro-USB 2.0 Typ AB, darf also maximal 1 Ampere ziehen. USB 3.0 Typ A darf mit Datenverkehr bis 0,9 und ohne bis mindestens 1,5 Ampere belastet werden. Meines Erachtens sollte die Dampfe also problemlos an einem USB 3.0 Typ A geladen werden können. --Rôtkæppchen₆₈ 09:33, 7. Jan. 2016 (CET)
Kann mir mal jemand erklären, was eine E-Dampfe ist? Die Website des Herstellers hilft mir da auch nicht wirklich weiter. --Jossi (Diskussion) 11:23, 8. Jan. 2016 (CET)
- E-Zigarette, vermute ich. --Eike (Diskussion) 11:45, 8. Jan. 2016 (CET)
Einen Akku mit zuwenig Ampere zu laden, kann sogar lebensgefährlich sein. Nehmen wir an, du lädst den 12-Volt-Akku eines Autos mit 1 Mikroampere. Du wirst dabei sterben. --62.202.181.162 11:31, 8. Jan. 2016 (CET)
- Nein, die Selbstentladung der Starterbatterie ist höher. Komm wieder runter, gefährlich ist das nicht. --Hans Haase (有问题吗) 23:37, 9. Jan. 2016 (CET)
- Das war ein Witz, oder sollte jedenfalls einer sein. Sogar wenn du einen Metallstab in die Luft hältst, kriegst du einen Strom ab, der höher ist, wei das Ding als Antenne wirkt.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 23:44, 9. Jan. 2016 (CET)
7. Januar 2016
Abkürzung in einem Kirchenbuch?
Moin, mal wieder eine Frage an die versammelten Experten: In einem Kirchenbuch findet sich ein Eintrag »geboren am 24. November igoi oder Jahrgang igoi Nr. 38«, das Jahr wurde mir leider nicht übermittelt, wird wahrscheinlich 17. bis 19. Jh. sein. Was bedeutet dieses »igoi«. Wahrscheinlich eine Abkürzung die ich meinen Nachschlagewerken nicht finden. Was Google ausspuckt, bezieht sich eher auf Börsengeschehen in unserer Zeit, soweit ich das ausreichend überblicken kann. Freue mich über Antwort. --Gwexter (Diskussion) 11:37, 7. Jan. 2016 (CET)
- Sicher, dass da nicht 1901 steht? Grüße Dumbox (Diskussion) 11:40, 7. Jan. 2016 (CET)
- Was mich betrifft: Brett vorm Kopf? Ich frage noch mal ... --Gwexter (Diskussion) 11:58, 7. Jan. 2016 (CET) Sorry, meine Bemerkung war wohl eher doppeldeutig ...
- Schau dir mal Mediävalziffer an. Ich wette, Dumbox hat recht. Rainer Z ... 12:08, 7. Jan. 2016 (CET)
- Möglicherweise hat den Leser (nicht ich) auch ein jeweiliges Pünktchen über den handschriftlichen Ziffern irritiert, war ja lange Zeit üblich. Wie gepostet, ich habe nochmal zurückgefragt. --Gwexter (Diskussion) 12:48, 7. Jan. 2016 (CET)
- Wenn es ein Kirchenbuch ist, müsste sich schon aus dem Gesamtzusammenhang (übergreifender Titel, alle anderen Einträge etc.) ergeben, ob prinzipiell die Lesart "1901" in Frage kommt oder ob das abwegig ist. Wenn das "igoi" nur an einigen Stellen auftaucht, denke ich, dass es eine andere Bedeutung hat. Das Ganze ist doch eine Frage zur "Historik" als Wissenschaft. Gibt es hier in WP keine Historiker, die das lösen können? Ich dachte doch, die Historiker lernen den Umgang mit Quellen. Dazu gehört doch zu allererst das Lesen selbiger. Vielleicht kann man auf dem Geschichtsportal helfen? --84.135.153.125 13:32, 7. Jan. 2016 (CET)
- Schimpf doch nicht gleich. So ein Projekt zur Lokalgeschichte hat meist viele Freiwillige, die Quellen lesen und transkribieren, und sicher nicht alle sind ausgebildete Historiker. Da kann so eine Fehldeutung von Ziffern für Buchstaben leicht mal vorkommen, und in den beiden genannten Kontexten ist die Konjektur nun halt ausgesprochen naheliegend. Gwexter sprach ja selbstironisch von einem Brett, und oft genug passiert es einem ja, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Grüße Dumbox (Diskussion) 13:44, 7. Jan. 2016 (CET)
- Danke Dumbox. @IP: Zur Erläuterung: Ich habe die Anfrage wie o. a. bekommen, kenne das Original also nicht. Um solche Dinge zu klären, muss man übrigens kein Historiker sein. Ich selbst bin auch keiner, schlage mich aber seit einem Vierteljahrhundert mit alten Schriften herum, wobei ich zurückschauend bis ins 17. Jahrhundert Texte recht gut lesen kann. Und wenn man mal was nicht weiß (oder vom rechten Weg abirrt), darf man ja wohl noch fragen dürfen, auch wenn da keine hochkarätige wissenschaftliche Fakultät drauf wartet. Zur Qualität der Leute, die in diesen Bereich der WP reinschauen, mag ich mich nur lobend äußern. LG --Gwexter (Diskussion) 14:06, 7. Jan. 2016 (CET)
- Übrigens liefert mir Google-Buchsuche allein für November igoi angeblich 688 (geschätzt 82, angezeigt 93) Ergebnisse, die auch 1801 beinhalten (nämlich gleich das erste mir angezeigte Ergebnis). --Pp.paul.4 (Diskussion) 14:30, 7. Jan. 2016 (CET)
- Wie in diesem Falle: https://books.google.de/books?id=lH2WpQwZYRkC&pg=PA492&&dq=Dezember+igoi eine falsche Übertragung per Texterkennung. Suchbegriff hier »Dezember igoi«. Da muss man wohl erst drauf kommen. --Gwexter (Diskussion) 14:42, 7. Jan. 2016 (CET)
- Übrigens liefert mir Google-Buchsuche allein für November igoi angeblich 688 (geschätzt 82, angezeigt 93) Ergebnisse, die auch 1801 beinhalten (nämlich gleich das erste mir angezeigte Ergebnis). --Pp.paul.4 (Diskussion) 14:30, 7. Jan. 2016 (CET)
- Wenn es ein Kirchenbuch ist, müsste sich schon aus dem Gesamtzusammenhang (übergreifender Titel, alle anderen Einträge etc.) ergeben, ob prinzipiell die Lesart "1901" in Frage kommt oder ob das abwegig ist. Wenn das "igoi" nur an einigen Stellen auftaucht, denke ich, dass es eine andere Bedeutung hat. Das Ganze ist doch eine Frage zur "Historik" als Wissenschaft. Gibt es hier in WP keine Historiker, die das lösen können? Ich dachte doch, die Historiker lernen den Umgang mit Quellen. Dazu gehört doch zu allererst das Lesen selbiger. Vielleicht kann man auf dem Geschichtsportal helfen? --84.135.153.125 13:32, 7. Jan. 2016 (CET)
- Möglicherweise hat den Leser (nicht ich) auch ein jeweiliges Pünktchen über den handschriftlichen Ziffern irritiert, war ja lange Zeit üblich. Wie gepostet, ich habe nochmal zurückgefragt. --Gwexter (Diskussion) 12:48, 7. Jan. 2016 (CET)
- Schau dir mal Mediävalziffer an. Ich wette, Dumbox hat recht. Rainer Z ... 12:08, 7. Jan. 2016 (CET)
- Was mich betrifft: Brett vorm Kopf? Ich frage noch mal ... --Gwexter (Diskussion) 11:58, 7. Jan. 2016 (CET) Sorry, meine Bemerkung war wohl eher doppeldeutig ...
"Texterkennung"???? --84.135.141.169 11:03, 8. Jan. 2016 (CET)
- Um deinem Fragesteller helfen zu können, wäre ein Faksimile (Scan, Foto) des Kirchenbucheintrags hilfreich. Die Möglichkeit eines Lesefehlers ist sonst einfach zu hoch. --Jossi (Diskussion) 11:33, 8. Jan. 2016 (CET)
- @IP: In beiden Beispielen (in meinem noch etwas deutlicher) ist klar erkennbar, das beim Erfassen von »I80I«, was im Original im Kontext deutlich als »1801« anzusehen ist, ein Fehler unterlief. So etwas ist typisch für Programme, die Grafik-Textdateien (wie beispielsweise bei diesen Google-Scan-Interpretierungen) in weiter verarbeitbare Zeichen umstricken, also wirklich simple Lesefehler. Weil ich selbst viel mit Texterkennung arbeite, hätte ich das wissen sollen, aber ich kenne das Original zu meinem Anliegen noch nicht. Ich nehme jatzt an, dass es sich um ein pdf-Dokument handelt, das auf diese Art und Weise entstanden ist. Ein Lesefehler ist allerdings auch bei einer Handfschrift nicht auszuschließen. Ich hatte das schon erwähnt, dass die Ziffer 1 in älternen Schriften (wegen des Pünktchens darüber, dass die Ziffer 1 kennzeichnen soll) im Eifer des Gefechts schon mal als »i« oder »j« interpretiert wird. --Gwexter (Diskussion) 22:21, 8. Jan. 2016 (CET)
Vielleicht ein missgelesenes ejsd. [ejusdem] oder ibid. [ibidem]? --Miebner (Diskussion) 22:33, 8. Jan. 2016 (CET)
- Moin, ich habe Rückmeldung bekommen: Gemeint ist sowas wie »igio« oder »ig io«, wie oben benannt also falsch übermittelt. Es geht um einen Geburtseintrag mit Taufe, wobei diese Zeichenkombination sich wohl auf den Taufeintrag bezieht. Die genaue Jahresangabe habe ich jetzt auch mit 1901, Zufall. An das Original komme ich leider nicht ran und muss mich auf meinem Informanden verlassen. Lesefehler per TE trifft also nicht zu, aber in meinen schlauen Büchern finde ich auch nichts. Ich denke aber, dass diese mögliche Abkürzung nichts anderes aussagen könnte als »getauft im gleichen Jahr« oder so ähnlich. LG --Gwexter (Diskussion) 19:33, 9. Jan. 2016 (CET)
8. Januar 2016
Betriebssysteme in Java?
Hallo. Die folgende Frage ist vielleicht dämlich, aber welchen Vorteil bieten den Nutzern eigentlich Java-Betriebssysteme? Können sie auf ein laufendes OS gestartet werden oder wie läuft das mit der Kommunikation mit der Hardware? (nicht signierter Beitrag von 94.222.214.17 (Diskussion) 09:21, 8. Jan. 2016 (CET)) --(nicht signierter Beitrag von 94.222.214.17 (Diskussion) 2016-01-08T08:21:26 (UTC))
- es gibt auch Java-Prozessoren... :) --Heimschützenzentrum (?) 09:25, 8. Jan. 2016 (CET)
- Keinen, sie sind zu langsam. Auch wenn immer wieder erwähnt wird, dass man auch mit Java performant programmieren könnte, passiert das in der Realität nie. Genau so wie die Plattformunabhängigkeit von Java die zwar theoretisch möglich ist in der Praxis aber praktisch nicht vorkommt. --2003:66:8954:937A:2CEF:7AE2:7372:22A8 11:16, 8. Jan. 2016 (CET)
- Das letztere ist falsch. Die weltweit millionenfach eingesetzten Programmpakete Apache OpenOffice und LibreOffice sind dank Java plattformunabhängig. --FGodard|✉|± 11:54, 8. Jan. 2016 (CET)
- Das wäre neu. Tatsache ist, dass sich zumindest LibreOffice der Altlast Java, die aus StarOffice übernommen wurde, entledigen will und schon den größten Teil des java-abhängigen Codes ohne Java neu geschrieben hat. Es verbleibt nur noch ein kleiner Teil java-abhängiger Code, der aber auch irgendwann mal weg soll. Siehe LibreOffice#4.x-Versionen--Rôtkæppchen₆₈ 13:12, 8. Jan. 2016 (CET)
- Da muss man aber auch sagen, dass es heute nur bedingt um Performance geht. Was bringt mir der schnellste Code wenn ihn keiner schreiben kann oder es zu lange dauert ihn zu schreiben (übertrieben ja, schon klar). Und wenn selbst Optimierung nichts bringt und Teile zeitkritisch sind, dann werden diese eben in C oder so ausgelagert. Java-Code ist nun nicht allzu schwer, wird an vielen Hochschulen gelehrt, plattformunabhängig. Trotzdem verstehe auch ich nicht so recht, wie Java angeblich die populärste Programmiersprache sein kann. --87.140.192.3 21:35, 8. Jan. 2016 (CET)
- Wenn Du den Artikel zu Ende gelesen hättest, dann hättest Du auch erfahren, dass die Methodologie dieses Index fragwürdig ist. Von einer in der verwendeten Form nicht wirklich gestellten Suchmaschinenanfrage auf die Popularität dieser Sprache zu schließen, halte ich für nicht zielführend. --Rôtkæppchen₆₈ 05:00, 10. Jan. 2016 (CET)
- Das letztere ist falsch. Die weltweit millionenfach eingesetzten Programmpakete Apache OpenOffice und LibreOffice sind dank Java plattformunabhängig. --FGodard|✉|± 11:54, 8. Jan. 2016 (CET)
Sonnenaufgangszeiten in Abhängigkeit von der geografischen Höhe/Höhendifferenz
Ich bin gestern von Tromsø nach Oslo geflogen. In Tromsø ist derzeit Polarnacht. Die dauert noch bis 15. Januar (siehe Artikel Tromsø). Als das Flugzeug um 10:45 Uhr etwa 50 km südlich von Tromsø war und eine Höhe von etwa 4800 m erreicht hatte (alles per GPS ermittelt), ging zu meiner Überraschung im Süden die Sonne auf. Ich hätte erwartet, dass man dazu deutlich südlicher sein muss. Nun zur Frage: wie kann man die Sonnenaufgangszeiten bei gegebener geografischer Breite und Länge über die Bezugshöhe korrigieren? Im Web habe ich dazu nichts gefunden. Mit zunehmendem Breitengrad sollte der Einfluss der Bezugshöhe immer größer werden. Oder als konkrete Rechnung: Wie hoch muss in Tromsø ein Ballon fliegen, damit man im Dezember zur Sonnenwende die Sonne zur Mittagszeit gerade noch sieht? Gruß --Kuebi [✍ · Δ] 18:54, 8. Jan. 2016 (CET)
- Wenn man annimmt, dass das Sonnenlicht den Polarkreis an Mittwinter tangential streift, ist das eine einfache trigonometrische Aufgabe. Bei einem Winkelunterschied Tromsö-Polarkreis von 3,08 Grad und einem Erdradius von 6366,2km komme ich auf 9,2km Höhe. Natürlich auch von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Wer hat was anderes? --Optimum (Diskussion) 19:19, 8. Jan. 2016 (CET)
- Cool! Die 3,08° hätte ich ja selbst aus den Breitengraden (Tromsø und Polarkreis) errechnen können. Auf die Idee kam ich nicht. Aber interessant, dass man bei den flachen Winkeln gar nicht so hoch hinaus muss, um einen deutlichen Effekt zu erzielen. Gruß und Dank --Kuebi [✍ · Δ] 19:26, 8. Jan. 2016 (CET)
- Wenn du nicht die Gradzahl sondern die Entfernung zum Polarkreis hast, geht es mit den Formeln in Sichtweite#Geometrische_Sichtweite. --Engie 19:40, 8. Jan. 2016 (CET)
Das erinnert ein bisschen an die Frage von neulich: Wie weit ist es bis zum Horizont. 90.184.23.200 15:07, 9. Jan. 2016 (CET)
- Faktisch ist der Polarkreis dann alles andere als ein Kreis, sondern speziell im Gebirge eine Vielzahl von Linien, die im Norden auf den Gipfeln ihre maximale Auslenkung haben. Ein Kreis wäre es nur, wenn man es auf Seehöhe bezieht.--Kuebi [✍ · Δ] 08:19, 10. Jan. 2016 (CET)
- Nicht mal dann. Ein Kreis ist der Polarkreis nur, wenn man von einem Rotationsellipsoid oder einer Sphäre ausgeht. Das gilt aber für jeden Breitenkreis. --Digamma (Diskussion) 10:49, 10. Jan. 2016 (CET)
- Faktisch ist der Polarkreis dann alles andere als ein Kreis, sondern speziell im Gebirge eine Vielzahl von Linien, die im Norden auf den Gipfeln ihre maximale Auslenkung haben. Ein Kreis wäre es nur, wenn man es auf Seehöhe bezieht.--Kuebi [✍ · Δ] 08:19, 10. Jan. 2016 (CET)
- In der Praxis ist natürlich wieder alles viel komplizierter als in der Theorie, siehe z.B. Erdfigur. Der Polarkreis ist nur eine gedachte Linie. Für die Sichtbarkeit der Sonne muss man dann auch noch das Geoid und die Astronomische Refraktion berücksichtigen.--Optimum (Diskussion) 12:09, 10. Jan. 2016 (CET)
zwei Fragen Physik: Lichtgeschwindigkeit/Gravitation
Hallo, ich hab zwei Fragen an euch:
1) Angenommen man hätte einen 500.000 km langen Stab und bewegt das eine Ende. Dass das andere Ende sich natürlich nicht sofort bewegt, ist mir schon klar. Nur warum nicht? Was führt dazu, dass die Bewegung des Stabs trotzdem langsamer als die Lichtgeschwindigkeit ist? Ist es der Impuls oder was verbirgt sich physikalisch dahinter? --2003:7A:ED4C:AD68:6934:E78E:EE61:D9CD 19:22, 8. Jan. 2016 (CET)
2) Im Schulunterricht wurde uns gezeigt, dass Körper im Vakuum gleichschnell fallen. Wenn wir zwei Körper unterschiedlicher Masse nehmen und diese im Vakuum fallen, fällt der schwerere Körper dann (theoretisch?) schneller? Im newtonschen Gravitationsgesetz tauchen ja beide Massen auf.--2003:7A:ED4C:AD68:6934:E78E:EE61:D9CD 19:22, 8. Jan. 2016 (CET)
- zu Frage Nr. 2 gab es ein berühmtes Experiment: https://www.youtube.com/watch?v=5C5_dOEyAfk Im Vakuum fallen die Körper (Hammer und Feder) gleich schnell. Mit Newtons Gesetz wird die Kraft berechnet und nicht die Geschwindigkeit. Um die größere Masse des Hammers auf die gleiche Geschwindigkeit wie die der Feder zu bringen, ist die größere Kraft aus Newtons Formel nötig. --Heldenzeuger (Diskussion) 19:35, 8. Jan. 2016 (CET)
- Zu Frage 1, dein Stab ist niemals 100% starr (im Sinne von die Atome sind gegeneinander unbeweglich). Daher breitet sich die Information wie eine Welle durch den Körper aus. Da der Stab (bzw. die Atome aus denen er besteht) eine Masse besitzen, welche Träge ist, kann die Information auch nicht die Lichtgeschwindigkeit erreichen. --Jogo.obb (Diskussion) 19:54, 8. Jan. 2016 (CET)
- Ein 500.000 km langer Stahlstab mit 1cm Durchmesser würde übrigens 300.000 t wiegen. Selbst wenn dieser Stab schwerelos im Weltraum schwebt, bleibt da noch die Massenträgheit. Die größte Rakete, Saturn V, wog nur 1/100stel davon. Mal eben so bewegen klappt also nicht. --Optimum (Diskussion) 20:22, 8. Jan. 2016 (CET)
- Das ist für ein Gedankenexperiment unerheblich.
- Stab: Reale Stäbe bestehen ja aus Atomen, die durch unterschiedliche elektromagnetische Kräfte (meist in kovalenten Bindungen) miteinander verbunden sind. Schon von Atom zu Atom breitet sich ein Kraftfeld, die für eine Beschleunigung erforderlich ist, nicht instantan aus. Fiktive Sräbe könnte man sich als starren Körper vorstellen. Wie sich ein solcher starrer Körper in relativistisch relevanter Größe bei Beschleunigung relativistisch verzerrt, ist nicht einfach zu beschreiben. Ein ähnliches Problem ist die Winkelbeschleunigung eines langen Stabes bis zu einer Winkelgeschwindigkeit, bei der die Bahngeschwindigkeit des Endes des Stabes sich der Lichtgeschwindigkeit annähert.
- Zwei unterschiedlich schwere Körper beschleunigen dann gleich schnell, wenn schwere Masse und träge Masse einander äquivalent sind. Davon geht man aus. Ob es stimmt, wird noch erforscht, zum Beispiel in Falltürmen. --BlackEyedLion (Diskussion) 23:29, 8. Jan. 2016 (CET)
- Ein 500.000 km langer Stahlstab mit 1cm Durchmesser würde übrigens 300.000 t wiegen. Selbst wenn dieser Stab schwerelos im Weltraum schwebt, bleibt da noch die Massenträgheit. Die größte Rakete, Saturn V, wog nur 1/100stel davon. Mal eben so bewegen klappt also nicht. --Optimum (Diskussion) 20:22, 8. Jan. 2016 (CET)
- Die Stahlstabfrage wurde ja im Prinzip schon beantwortet, nochmal in meiner Formulierung: Es gibt keine starren Materialien. Es gibt nur Materialien, die dir in kleinen Dimensionen starr erscheinen, weil sich an einem Ende eingebrachte Bewegungen so schnell auf das andere Ende übertragen, daß du den Eindruck hast, der Körper bewege sich „als Ganzes“. Das tut er aber nie. Auch ein 1-m-Stab, der an einem Ende bewegt wird, wird von einer Körperschallwelle durchlaufen, die die übrigen Teilchen, aus denen er besteht, dieser Bewegung folgen läßt – aber das ist so weit unter der Wahrnehmungsgrenze, daß es einem nicht bewußt ist. Ich gehe mal, bis mir einer widerspricht, davon aus, daß sich diese Welle grundsätzlich mit der entsprechenden Schallgeschwindigkeit ausbreitet (in Stahl wären das knapp 8 km/s). --Kreuzschnabel 08:27, 9. Jan. 2016 (CET)
- Die Fallfrage ist ganz einfach mit Logik zu beantworten: Ein schwerer Körper erfährt zwar eine höhere Gewichtskraft als ein leichter, ist aber auch entsprechend träger, benötigt also um denselben Faktor mehr Beschleunigungsarbeit, um auf dieselbe Geschwindigkeit zu kommen. So kürzt sich die Masse raus – zwei Körper im freien Fall werden in der gleichen Zeit um die gleiche Geschwindigkeit beschleunigt, auch wenn einer 1000-mal schwerer ist als der andere. Der schwerere hat dann allerdings im Vergleich zum leichten die 1000-fache kinetische Energie, tut beim Auftreffen auf Newtons Schädel also mehr weh. --Kreuzschnabel 08:33, 9. Jan. 2016 (CET)
- Zur Fallfrage gibt es auch das folgende einfache (Gedanken- oder tatsächliches) Experiment: Wenn der schwerere Körper schneller fallen würde, was würde passieren, wenn wir zwei verschieden schwere Körper mit einer dünnen Schnur verbinden und fallen lassen? Fallen sie zusammen langsame als der schwerer Körper allein, weil der leichtere das Gesamtobjekt ausbremst? Oder schneller, weil sie zusammen ja noch schwerer sind? Das passt nicht zusammen, also muss die Falldauer von der Masse unabhängig sein. --132.230.195.196 10:25, 9. Jan. 2016 (CET)
- Kreuzschnabel: Schallgeschwindigkeit ist richtig, beim oben diskutierten Stab dauert es also grob ein Tag, bis sich das andere Ende bewegt. In Neutronensternen kann die Schallgeschwindigkeit in die gleiche Größenordnung wie die Lichtgeschwindigkeit kommen, bleibt aber immer langsamer. --mfb (Diskussion) 11:22, 11. Jan. 2016 (CET)
Dämme im Mittelalter
Hallo,
ich möchte für einen Fluss gaaanz grob abschätzen (nicht baurelevant!), wie ein Damm in diesem Fluss beschaffen sein müsste. Dazu habe ich die Abflussmenge des Flusses mit seiner Durchschnittsgeschwindigkeit multipliziert und die Kraft erhalten, die auf jeden hypothetischen Querschnitt des Flusses einwirkt.
Es geht um eine Wette mit einem Kameraden aus dem Geschichtsunterricht, ob man im Mittelalter nicht mit Dämmen die an Flüssen liegende Bevolkerung mit Wasser und einer Kanalisation hätte versorgen können. Anders ausgedrückt, der Damm soll auf mittelalterliche Weise errichtet worden sein. Meine Idee war jetzt einfach, da ich momentan die sicher komplizierten physikalischen Verhältnisse (im Flussbett steckende Baumstämme u. ä.) nicht miteinbeziehen kann, einfach zu kalkulieren, wie viel Baumaterial man aufschütten müsste, damit die ausgerechnete Kraft nicht ausreicht, um die Masse des Baumaterials zu bewegen und dazu noch eine Hochwasser- / Stauungseffekt- / Sicherheitsmarge von 200 % aufzuschlagen.
Darum meine Frage: 1.) Welches Haupt-Baumaterial wurde für Dämme im Mittelalter verwendet? 2.) Wie wurde damals ein Damm konstruiert (rein interessehalber)?
Ich weiß, dass diese "Berechnung" modellhaft-abstrakt ist und nichts mit der damaligen Realität zu tun hat und allein schon ungenaue Datenwerte das Ergebnis verhageln. Aber ich bin einfach neugierig. Vielen Dank im Voraus, --217.237.164.210 20:02, 8. Jan. 2016 (CET)
- Nicht gerade Mittelalter, aber siehe den Artikel Cornalvo-Talsperre. Laut en:WP gab es in Persien im Mittelalter auch reihenweise Stauseen mit Wasserrädern zur Kultivierung der Agrargebiete; suche nach = "dam". Siehe aber auch Liste römischer Talsperren und See von Homs. Da die Erfindung des römischen Betons dann in Vergessenheit geriet mag dann eine lange Pause bis in die beginnende Neuzeit eingetreten sein. --Cookatoo.ergo.ZooM (Diskussion) 21:19, 8. Jan. 2016 (CET)
- Bitte definiere Mittelalter genauer, am besten mit einer 50-100 Jahre Periode. Denn im dem was normalerweise als Mittelalter bezeichnet wird, gab es eigtlich noch kein Bedarf an "moderen" Dämme. Was Otto Normalbürger gern noch als Mittelalter versteht ist aber gern mal Spätmittelalter oder schon Frühe Neuzeit (ab 15. jahrhundert). Dann richtige Flussverbauungen usw. gab es erst vereinzelt im Spätmittelarter, richtig verbreitet eigentlich erst in der frühe Neuzeit. Das dieses Zeitproblem auch ein Problem bei der Fragestellung sein kann, ist hoffentlich verständlich.--Bobo11 (Diskussion) 22:59, 8. Jan. 2016 (CET)
- Zum Thema selber (ohne Zeitbezug); In der Regle Holz udn was sonst vor Ort vorhanden war. Denn der Transport war bevor es ausgebaute Strassen gab ein generelles Problem. Die "guten" Strassen, also die Chaussee somit die ersten echten Kuststrassen sind aber ganz klar schon Neuzeit (Selbst 1836 rechnete der Kanton Bern für Strassentransporte noch wie folgt. Die Annahme war, dass der effektive Gestehungspreis beim Ankauf von einem m³ Stein zu 2 alten Franken, sich bei Transport über 6 (sechs!) Kilometer verdoppelt. Der Transport über 6 Kilomter ebenfalls 2 alte Franken kostet würde). Davor war es schlichweg unrealistisch mit nicht vor Ort greifbaren Baumaterialen zu bauen. Das heisst man musste sich in der Umgebung bedinen können, oder die Baustoffe mussten auf dem Fluss von oben heran geführt werden können (und das ging am einfachsten beim Holz). Am üblichsten waren Faschinen Verbauungen. Mit dennen griff man eben auch in die Strömmung und denn Geschiebtransport ein. Die Dämme wurden dann mit abgelagerten Kies von Hand geschüttet, oder man brach das Rohmaterial eben in der Nähe. Das waren auch keien Bauarbeiter die diesen Ausbau machten, sondern die Bevölkerung vor Ort erledigte die Sache als Gemeinwerk. Gern mal als Fronharbeit, oft aber auch als bezahlte Taglöhner-Arbeit. Dann aber eben in der Form der Beschäftigung der Armen in der Zeit wo keine Feldarbeit anfiel (eine frühe Form der Fürsorge). --Bobo11 (Diskussion) 23:14, 8. Jan. 2016 (CET)
- Zum Thema Holztransport muss man auch die kleinen Staudämme nennen, die das Wasser von Bächen soweit aufgestaut haben, dass auch dort mit einer Welle die Flösse transportiert werden konnten. Die Staudämme bestanden z.T. am Rand aus Kies/Erde/Stein, im Wasser dann aus Holzpalisaden. --Hachinger62 (Diskussion) 19:20, 9. Jan. 2016 (CET)
9. Januar 2016
Durch Schädelbasisbruch gerruchsinn verloren was kann ich tun
--91.44.152.185 12:27, 9. Jan. 2016 (CET)
- Notarzt rufen? --Simon-Martin (Diskussion) 12:30, 9. Jan. 2016 (CET)
- Anosmie lesen und den behandelnden Arzt fragen. Play It Again, SPAM (Diskussion) 12:38, 9. Jan. 2016 (CET)
Kommt entweder von selbst wieder oder auch nicht. Behandlung gibt es keine, nur eine Menge Scharlatane. -- Janka (Diskussion) 16:55, 9. Jan. 2016 (CET)
- Ja, da hat Janka recht, entweder erholen sich die Nerven von selbst, oder sie bleiben für immer geschädigt. Aber du kannst es auch positiv sehne, denn nicht jeder überlebt einen Schädelbasisbruch. Sei glücklich das du überlebt hat, denn eine positive Lebenseistellung hilft auch dann, wenn der Geruchsinn beeinträchtigt bleibt. --Bobo11 (Diskussion) 17:21, 9. Jan. 2016 (CET)
- Mach doch aus Deiner Not eine berufliche Existenz. Ein Freund von mir verlor bei einem epileptischen Anfall Geruch und GeschmacKsinn...ein Arzt machte ihn auf eine sehr gute Verdienstmöglichkeit aufmerksam. Der ist Tatortreiniger geworden. Der arbeitet 5- maximal 10 Tage im Monat und verdient wirklich gut. Ist nichts für zartbesaitete Seelen. Aber die Leichen sind immer schon weg, in der Regel handelt es sich auch nicht um Morde sondern verweste Vereinsamte. Das ist sehr geruchsintensive Entrümpelung die sehr, sehr gut bezahlt wird. Einmal hatte der einen dreifach Messermord, da war der echt fertig nach, habe die ganze Nacht mit dem gesoffen um den aufzumuntern, aber das war einmal in 10 Jahren.--Markoz (Diskussion) 00:15, 10. Jan. 2016 (CET)
Radon in Gebäuden und WU-Beton
Hallo, im Artikel WU-Beton vermisse ich die Information, inwieweit dieser auch das Eindringen von Radon-Strahlung verhindert/vermindert. Diese Präsentation legt das eventuell nahe. Das finde ich aber schwierig zu beurteilen, weil diese Quelle sehr stichwortartig ist und keine Zahlen nennt. Kennt jemand belastbare Quellen und kann ggf. auch den Artikel entsprechend ergänzen? --85.177.158.32 15:05, 9. Jan. 2016 (CET)
- Ich halte das für Theoriefindung. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Radon und Wasser (Partikelgröße, Dipolmoment, molare Masse, …) sind zu unterschiedlich, um aus der Dichtigkeit für das eine auf eine Dichtigkeit für das andere zu schließen. --Rôtkæppchen₆₈ 18:55, 9. Jan. 2016 (CET)
- Auf jeden Fall geht es nicht um das Eindringen von Strahlung, sondern um das Eindringen von Radon selbst. --Digamma (Diskussion) 20:35, 9. Jan. 2016 (CET)
- Wasserundurchlässig heißt noch lange nicht gasundurchlässig, WU-Beton würde sonst nicht trocknen. Die Zuschläge von WU-Beton sind vor allem gegen die kapillare Weiterleitung von Wasser gerichtet, nicht gegen Transport von Gas oder Wasserdampf. Außerdem kann je nach Zusammensetzung auch durch Beton selbst Radon freigesetzt werden. Vielleicht hat es eine gewisse verzögernde Wirkung, aber womöglich ist das auch einfach nur ein netter Versuch.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 22:08, 9. Jan. 2016 (CET)
- Vor allem hat Wasser ein Dipolmoment. Es interagiert also mit den atomaren Bestandteilen des Betons. Somit können Wassermoleküle an den Beton adsorbiert werden, was die Diffusion von Wasser durch den Beton verhindert oder verlangsamt. Radon hat kein Dipolmoment, ist chemisch fast völlig reaktionsträge und interagiert so sehr wenig mit dem Beton. Es diffundiert ungehindert durch die Gitterlücken der Beteonbestandteile. SiO2, einer der Hauptbestandteile des Betons, hat so große Lücken zwischen den Bestandteilen des Kristallgitters, dass da Radonatome locker zwischenpassen. --Rôtkæppchen₆₈ 23:31, 9. Jan. 2016 (CET)
- Hier ein Papier, was sich mit der Diffusion von Radon durch Beton befasst. --Rôtkæppchen₆₈ 23:34, 9. Jan. 2016 (CET)
- Wasserundurchlässig heißt noch lange nicht gasundurchlässig, WU-Beton würde sonst nicht trocknen. Die Zuschläge von WU-Beton sind vor allem gegen die kapillare Weiterleitung von Wasser gerichtet, nicht gegen Transport von Gas oder Wasserdampf. Außerdem kann je nach Zusammensetzung auch durch Beton selbst Radon freigesetzt werden. Vielleicht hat es eine gewisse verzögernde Wirkung, aber womöglich ist das auch einfach nur ein netter Versuch.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 22:08, 9. Jan. 2016 (CET)
- Das ist die falsche Frage. Die Abdichtung von erdberührenden Bauteilen erfolgt ausser in einigen wenigen Sonderfällen (Weiße Wanne ohne zusätzliche Sperren ) nicht über den Beton sondern über Horizontal- und Vertikalabsperrungen aus PVC- PIB- oder Bitumenwerkstoffen. Die sind nicht diffusionsoffen. Solche Sperreen haben einen sd-Wert von 50 - 500. 20 cm Beton hatt ca. 30 - Die Frage ist also die der Porengöße der Folien. Ein Radon Atom hat etwas 0,22 nm ein Wassermolekül 0,28 nm Graf Umarov (Diskussion) 01:46, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wassermolküle sind nur so klein in gasförmigem Zustand. Flüssig bildet Wasser über Wasserstoffbrücken Konglomerate von hunderten Molekülen, die an diversen Substanzen haften bleiben oder größere Löcher einfach verstopfen Darauf beruht z. B. das Prinzip, dass ein Filzhut kein Wasser durchlässt oder die Dichtigkeit von Goretex gegenüber Regen. Gegen Radon hilft aber beides ganz sicher gar nichts. Kunststofffolien sind z. B. je nach Material und Dicke manchen Gasen gegenüber ziemlich diffusionsoffen.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 22:55, 11. Jan. 2016 (CET)
- Das ist die falsche Frage. Die Abdichtung von erdberührenden Bauteilen erfolgt ausser in einigen wenigen Sonderfällen (Weiße Wanne ohne zusätzliche Sperren ) nicht über den Beton sondern über Horizontal- und Vertikalabsperrungen aus PVC- PIB- oder Bitumenwerkstoffen. Die sind nicht diffusionsoffen. Solche Sperreen haben einen sd-Wert von 50 - 500. 20 cm Beton hatt ca. 30 - Die Frage ist also die der Porengöße der Folien. Ein Radon Atom hat etwas 0,22 nm ein Wassermolekül 0,28 nm Graf Umarov (Diskussion) 01:46, 10. Jan. 2016 (CET)
- Zum Schutz vor Radon muß der Werkstoff nicht gasdicht sein, sondern nur einen hinreichenden Diffusionswiderstand (also "kleine Poren") bieten, weil Radon eine kurze Halbwertszeit hat und binnen Tagen nach seiner Entstehung aus Radium zerfällt. Entsprechend bietet auch eine dichte Oberflächenbeschichtung (z. B. Anstrich) eines radiumhaltigen Werkstoffs einen guten Schutz. (Die Tochterprodukte des Radons sind übrigens auch radioaktiv, aber weniger problematisch, weil nicht gasförmig.) (nicht signierter Beitrag von 92.224.159.94 (Diskussion) 14:22, 11. Jan. 2016 (CET))
- Sorry, aber das ist falsch. Die Gefahr geht beim Radon gerade von den festen, hochradioaktiven Tochternukliden wie dem 218Po aus. Diese Nuklide setzen sich im Gewebe fest und schädigen es durch die unmittelbar im Gewebe entstehende Strahlung. Siehe Radonbelastung#Einfluss des Radons auf den Menschen. Die Tochternuklide des Radons sind mitnichten weniger problematisch, sondern häufiger Krebsauslöser bei Bergarbeitern, siehe Schneeberger Krankheit. --Rôtkæppchen₆₈ 22:56, 11. Jan. 2016 (CET)
- BK Das Gegenteil zu deiner Vermutung ist richtig. Das Problem ist, dass auf diese Weise Uran und Thorium anfangen zu "wandern" und die Zerfallsprodukte an allen möglichen Stellen auftauchen können. Wenn Radon zerfällt, bleibt Polonium zurück, das z. B. in der Lunge durchaus einigen Schaden anrichten kann und nicht einfach wieder ausgeatmet werden kann. Man denke sich, dass man ein Radonatom einatmet und nach 20 Sekunden wieder ausatmet. Schaden = 0. Es kann auch sein, dass genau in dem Moment der Zerfall eintritt, dann habe ich einmal den Schaden durch den Radon-Zerfall und durch den anschließenden mPoloniumzerfall einen mehrfachen weiteren Schaden. Weiterhin kann das Radon auch außerhalb des Körpers in der Umgebungsluft zerfallen und ich atme die Zerfallsprodukte mit der Luft ein. Dann fällt der Schaden durch den Zerfall von Radon weg, der Schaden durch Polonium bleibt. Siehe Radon-Zerfallsprodukte.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 23:13, 11. Jan. 2016 (CET)
- Ist Begriffsstutzigkeit notwendige Bedingung zur Mitarbeit in der Wikipedia? Die Gefahr beim Radon geht davon aus, daß es gasförmig ist, sich dadurch in der Umgebungsluft ausbreitet und deswegen leicht eingeatmet werden kann. Sobald es - außerhalb des menschlichen Körpers und der Atemluft natürlich - zerfallen ist, sind die Tochterprodukte fest und damit immobil. Also besteht ein sinnvoller und wirksamer Schutz darin, die Radon-Diffusion durch Sperren zu be- oder verhindern. Und Uran und Thorium "wandern" natürlich nicht, dafür sind die Halbwertszeiten viel zu hoch. Die Quelle von Radon ist Radium, sonst nichts. Und natürlich tritt das in Baustoffen isoliert von seinen Vorprodukten auf, weil es nämlich wasserlöslich ist und deswegen aus den primären Lagerstätten ausgewaschen und anderswo angelagert wird - schließlich verwendet kein Mensch Uranerz als Baumaterial, also ist das Argument mit den Zerfallsreihen lediglich hohles Gefasel. Übrigens wird Radon nicht "einfach wieder ausgeatmet". Es lagert sich nämlich an die feuchte Lungenschleimhaut an und bleibt dort gebunden - daß man genauso viel Stickstoff wieder aus- wie einatmet liegt daran, daß Stickstoff wenig wasserlöslich und das Körpergewebe damit bereits gesättigt ist; das ist also auch eher nur ein statistisches Gleichgewicht; Sauerstoff wird hingegen zu signifikanten Anteilen vom Körper aufgenommen, die ausgeatmete Luft enthält deutlich weniger Sauerstoff als die Umgebungsluft. Radon wird hingegen aus dem Körper nicht so häufig wieder abgegeben, weil es darin vergleichsweise selten ist - die relativen Partialdruckdifferenzen zwischen Außenluft und Konzentration im Körper sind hoch (obwohl der absolute Partialdruck von Radon auch bei relativ hohen Radioaktivitätskonzentrationen immer nur im homöopathischen Bereich liegt, es sich also um unwägbare Mengen handelt).
Alle Wege führen zum Mond
Hallo! Klar, das folgende ist keine allgemeine Wissensfrage, aber es geht eher um Einschätzung von Distanzen und Relationen. Wenn man davon ausgeht, daß in ein paar Jahrzehnten diverse Länder und Unternehmen in der Lage sein werden zum Mond zu fliegen, stellt sich für mich die Frage, wie dies praktisch vonstatten gehen soll. Gehen wir einfach mal davon aus, daß alle über ähnliche Technik mit den selben Eigenschaften verfügen. Wie beim Flugverkehr dürfte es nicht zu einer Komplikation kommen, was die Koordination der Starts auf der Erde angeht. Aber ich frage mich seit längerem, gibt es da nicht ein "Nadelöhr", andem sich alle Flugobjekte unabhängig von den Startbedingungen treffen, bevor sie in die Annäherung/Landung an verschiedenen Stellen geraten?`Oder ist es entsprechend der Mondumlaufbahn eher eine Kette von Nadelöhren? Denn trotz Weltall und den 3 Dimensionen ist es ja eine Start-Zielreise auf einer Ebene.Oliver S.Y. (Diskussion) 15:56, 9. Jan. 2016 (CET)
- Demnächst wird es so oder so, eher ein Problem sein eine Lücke im Weltraummüll zu finden, als das man auf den Routen zum Mond "Stau" hat. Aber es stimmt schon, es gibt nicht manche Route zum Mond, eigentlich nur eine idealle und enegrie effizente Bahn, wo die Raumschiffe sogar noch die selbe Geschwindigkeit haben werden. Aber diese Route ist also eher mit einer Einbahn zu vergleichen -di erst noch mit Tempomat befahren wird), denn mit einer engen Strasse mit Gegenverkeher. Entsprechend wäre es mit geregeltem Einfädeln zu lössen. Stau gäbe es am ersten auf der Warte-Umlaufbahn (Orbit) bevor die "letzte" Stufe (Apollo 11 Zündung Stuffe 3) gezündet wird uns die Erdumlaufbahn Richtung Mond verlassen wird. àhnliches gilt für den Abbrems Orbit beim Mond. Aber eben das setzt praktisch voraus, dass zur selben Sekunde zwei Raumschiffen zum Mond wollen (ICh glaub das ist definitiv zu regelen). --Bobo11 (Diskussion) 16:19, 9. Jan. 2016 (CET)
- Ehrlich gesagt rechne ich nicht damit, dass das jemals zu einem größeren Problem werden wird. Reisen zum Mond werden frühestens dann in nennenswertem Umfang unternommen werden, wenn man Bodenschätze auf dem Mond gewinnbringend abbauen kann (oder wenn man seinen Müll da verklappen kann). Ansonsten hat sich da in den letzten Jahrzehnten wenig getan, und das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht groß ändern. Warum auch: Der Mond ist a große nackerte Kugel - es gibt kein Leben auf dem Mond. Zur Zeit streiten sich auch nicht zwei Supermächte darum, wer es schneller und besser hinkriegt. Die Fortschrittsgläubigkeit wird in der kommenden Generation einen gewaltigen Dämpfer erleiden; die Probleme, sich hier auf der Erde um die Ressourcen zu streiten (aus Wirtschaftsflüchtlingen werden Umweltflüchtlinge); die wirtschaftlich benachteiligten Völker haben inzwischen verlässlichen Zugang zu Informationen und Kommunikationswegen, und mit Waffen werden sie ohnehin bestens versorgt - Spielereien wie Flüge zum Mond oder gar zum Mars werden in erster Linie stattfinden, um die Bevölkerung der Industrienationen von den wahren Problemen abzulenken, und das wird nicht zu Verkehrsstaus im Weltall führen. Wenn es überhaupt je so weit kommt. --Snevern 16:59, 9. Jan. 2016 (CET)
- Hallo! Ich war eigentlich auch lange Deiner Meinung, bis ich eine interessante These las. Demnach entspricht es sowohl dem Macht- als auch Forschungsdrang der Menschheit ansich, neue Wege zu gehen. Nach der Eroberung von Mond und Mars stehen die Asteroiden und Monde der Großplaneten auf dem Plan. Es soll plausibler sein, Produktionsstätten für Bauteile von Raumschiffen auf dem Mond zu errichten, als diese einzeln hochzuschicken. Wenn ich mal den Vergleich mit einem Schiff wie der neuen Fregatte F125 aufstelle, 120 Mann Besatzung, Vorräte für 2 Jahr = 7000 Tonnen Gewicht. Da wird schon der Transport vonn Vorräten, Elektronik und Ausrüstung einen enormen Aufwand verschlingen. Genauso stellt sich ethisch die Frage, wie lange Menschen im All verbringen können, und anschließend wieder auf das Erdleben anpassbar sind. Muß nicht eine Art "Alterssitz" geschaffen werden, wo die -nauten ihr Leben konstruktiv weiterführen? Zur Frage, es ist ja auch keine "Einbahnstraße", sonder es wird ja auch einen Rückverkehr geben, der genauso zu regulieren ist, und das bedeutet über längere Distanzen im Raum einen "Parallelverkehr" in einem gewissen "Schlauch", nicht nur "Öhr", wo mind. 2 am Ende dieses Schlauchs/Tunnels stehen. Nur wie "breit" kann dieser sein, wenn man die Entfernungen sieht. Wenn man von Berlin nach fliegen Köln will, und nur 1,2 Grad daneben liegt, kommt man in Düsseldorf oder Aachen an, und wer will das schon :), beim Mond dürften geringere Abweichungen zum Verpassen führen. Was ungünstig ist, wenn er erst in 27 Tagen wieder vorbeikommt.Oliver S.Y. (Diskussion) 17:53, 9. Jan. 2016 (CET)
- Also, das mit dem "Gegenverkehr" kann ich mir nicht so recht vorstellen. Mondflüge, jedenfalls die bisher üblichen, sind ja keine Direktflüge mit Fluchtgeschwindigkeit, sondern erweiterte Umlaufbahnen mit Trans-Lunar-Injection aus dem Parkorbit um die Erde und entsprechender Trans-Earth-Injection aus der Mondumlaufbahn. Dabei ändert sich der Drehsinn doch nicht, bzw. im Umkehrsinn um den Mond und dann wieder umgekehrt zur Erde, also vereinfacht: wie eine 8. Das ist doch eine Einbahnstraße, oder? (Ich bin aber kein Experte; it's all rocket science to me...). Grüße Dumbox (Diskussion) 18:38, 9. Jan. 2016 (CET)
- P.S.: Das (sicher nicht ganz ernst Gemeinte) mit den 27 Tagen ist natürlich sehr irdisch gedacht. In irgendeine, wenn auch ungeplante, Mondumlaufbahn würde man schon kommen, wenn man nicht komplett in die falsche Richtung schießt, aber dann ist eh die Dingens am Dampfen. Hätte die TLI gar nicht geklappt, wären die Apollos, so war es ausgerechnet, auf einer Ellipse automatisch zur Erde zurückgeflogen ("free return"). Aber natürlich kann man unterwegs immer ein wenig nachregulieren, in Zukunft, mit besseren Antriebssystemen, sicher noch viel besser als damals bei Apollo - und die haben immerhin mit viel Improvisation Nr. 13 heimgebracht; eine Jahrhundertleistung, wenn du mich fragst. Grüße Dumbox (Diskussion) 19:05, 9. Jan. 2016 (CET)
- P.P.S. Eigentlich wäre ich aktuell vielleicht wirklich lieber in D'dorf oder Aachen. ;) Grüße Dumbox (Diskussion) 19:05, 9. Jan. 2016 (CET)
- Die Kurve die sie bei der Appolo geflogen sind ist auch die, die bei der Zeit-Energie-Rechung gewinnt. Und das schöne daran, dass es auch noch die Auto-Zurückkehr-Kurfe. Denn es ist ein der seltenen stabile Flugbahnen um zwei Schwerpunkte. Und weil sie stabil ist, wurde sie gewählt (Dazu kommt alles was im Weltraum nicht stabil ist, ist mit zusätzlichem Energieaufwand verbunden). Und Richtig, diese Flugbahn ist vereinfacht gesagt eine langezogene Acht zwischen Mond und Erde. Die eben dazu nur in eine Richtung gut funktioniert. Weil du von der Erde aus nur in eine Richtung den Schwung der Erdrotation mitnehmen kannst, in der Gegenrichtung musst du dagegen ankämpfen. Das heisst also du brauchst einiges mehr an Energie um auf Fluchtgeschwindigkeit zu kommen, wenn du gegen die Rotation startest. Dazu rotiert ja der Mond um die Erde und damit auch der Flugweg. Auserhalb der "normalen" Sateliten- und Müll-Orbite, wird es devinitv nicht wirklich eng sein. --Bobo11 (Diskussion) 20:10, 9. Jan. 2016 (CET)
- Stabil ist die Umlaufbahn nicht - wenn man nichts weiter unternimmt, kommt man einmal zum Mond, zurück und danach zu nichts sinnvollem mehr.
- Zur Ausgangsfrage: Das Weltall ist riesig. Selbst wenn plötzlich einmal am Tag irgendwas zum Mond fliegt (derzeit sind wir bei nur 1-2 Weltraumstarts pro Woche, und fast alle in niedrige Erdumlaufbahnen), dann haben die Objekte noch einen typischen Abstand von ~100,000 km. 100 Flüge zum Mond pro Tag? Dann sind es immer noch viele tausend Kilometer. Zum Vergleich: In der niedrigen Erdumlaufbahn kreisen einige tausend Satelliten und sonstige Objekte in einem kleineren Volumen als es bei der Reise zum Mond jedes Objekt hätte. Die ISS macht Ausweichmanöver, sobald diese Objekte näher als ein paar Kilometer kämen, und braucht nur ein paar davon pro Jahr. --mfb (Diskussion) 11:11, 11. Jan. 2016 (CET)
- Die Kurve die sie bei der Appolo geflogen sind ist auch die, die bei der Zeit-Energie-Rechung gewinnt. Und das schöne daran, dass es auch noch die Auto-Zurückkehr-Kurfe. Denn es ist ein der seltenen stabile Flugbahnen um zwei Schwerpunkte. Und weil sie stabil ist, wurde sie gewählt (Dazu kommt alles was im Weltraum nicht stabil ist, ist mit zusätzlichem Energieaufwand verbunden). Und Richtig, diese Flugbahn ist vereinfacht gesagt eine langezogene Acht zwischen Mond und Erde. Die eben dazu nur in eine Richtung gut funktioniert. Weil du von der Erde aus nur in eine Richtung den Schwung der Erdrotation mitnehmen kannst, in der Gegenrichtung musst du dagegen ankämpfen. Das heisst also du brauchst einiges mehr an Energie um auf Fluchtgeschwindigkeit zu kommen, wenn du gegen die Rotation startest. Dazu rotiert ja der Mond um die Erde und damit auch der Flugweg. Auserhalb der "normalen" Sateliten- und Müll-Orbite, wird es devinitv nicht wirklich eng sein. --Bobo11 (Diskussion) 20:10, 9. Jan. 2016 (CET)
- Hallo! Ich war eigentlich auch lange Deiner Meinung, bis ich eine interessante These las. Demnach entspricht es sowohl dem Macht- als auch Forschungsdrang der Menschheit ansich, neue Wege zu gehen. Nach der Eroberung von Mond und Mars stehen die Asteroiden und Monde der Großplaneten auf dem Plan. Es soll plausibler sein, Produktionsstätten für Bauteile von Raumschiffen auf dem Mond zu errichten, als diese einzeln hochzuschicken. Wenn ich mal den Vergleich mit einem Schiff wie der neuen Fregatte F125 aufstelle, 120 Mann Besatzung, Vorräte für 2 Jahr = 7000 Tonnen Gewicht. Da wird schon der Transport vonn Vorräten, Elektronik und Ausrüstung einen enormen Aufwand verschlingen. Genauso stellt sich ethisch die Frage, wie lange Menschen im All verbringen können, und anschließend wieder auf das Erdleben anpassbar sind. Muß nicht eine Art "Alterssitz" geschaffen werden, wo die -nauten ihr Leben konstruktiv weiterführen? Zur Frage, es ist ja auch keine "Einbahnstraße", sonder es wird ja auch einen Rückverkehr geben, der genauso zu regulieren ist, und das bedeutet über längere Distanzen im Raum einen "Parallelverkehr" in einem gewissen "Schlauch", nicht nur "Öhr", wo mind. 2 am Ende dieses Schlauchs/Tunnels stehen. Nur wie "breit" kann dieser sein, wenn man die Entfernungen sieht. Wenn man von Berlin nach fliegen Köln will, und nur 1,2 Grad daneben liegt, kommt man in Düsseldorf oder Aachen an, und wer will das schon :), beim Mond dürften geringere Abweichungen zum Verpassen führen. Was ungünstig ist, wenn er erst in 27 Tagen wieder vorbeikommt.Oliver S.Y. (Diskussion) 17:53, 9. Jan. 2016 (CET)
Wortfindung Missbrauch öffentlichen Parkraums zu Werbezwecken

Wie nennt man dieses Phänomen? Gibt es dazu einen Begriff?
http://www.express.de/ordnungsamt-machtlos-werbung-blockiert-500-parkplaetze-5175880 --Tankwart (Diskussion) 16:39, 9. Jan. 2016 (CET)
- "Rollende Werbung", "Abstellen eines Werbezwecken dienenden Kraftfahrzeuges als gebührenpflichtige Sondernutzung". [19] --Joyborg 16:44, 9. Jan. 2016 (CET)
- Im Bild? Parken im Parkverbot. Dem Licht nach ist es zwischen 6-18h --87.148.75.22 18:28, 9. Jan. 2016 (CET)
- Da ist kein Parkverbot, nur eingeschränktes Haltverbot. Und der Führer des Kfz ist gerade im 3. Stock und holt die Kühltruhe, die er im Smart transportieren will. Dumbox (Diskussion) 20:39, 9. Jan. 2016 (CET)
- Ein mit Werbung beklebtes Fz irgendwo abstellen ist glaube ich keine Sondernutzung. In diesem Fall könnte es z. B. sein zum Ein- und Ausstieg von Personen. Wenn es länger steht, gelten da die üblichen Verkehrsregeln mit Knöllchen und Abschleppen. Ich denke genehmigungspflichtige Sondernutzung wäre es, wenn das Teil abgemeldet is und irgendwo auf öffentlicher Fläche rumsteht, so ähnlich wie eine Litfaß-Säule oder eine Plakatwand. Ähnliche Gerätschaften sind mir aber auch schon aufgefallen, die aber weit weniger fixe und laufende Kosten verursachen: Große Anhänger, die irgendwo monatelang auf öffentlichen Parkplätzen stehen, jedoch so, dass sie vom vorbeifahrenden Verkehr gut gesehen werden und für irgendeinen Puff werben. Wundert mich eh, dass es dazu noch keine Organisation gibt, die diese nutzlosen Nutzanhänger regelmäßig einer Weiternutzung in irgendeneiner ehemaligen Sowjetrepublik zuführen.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 19:14, 9. Jan. 2016 (CET)
- Es kann laut OVG Hamburg v. 20.12.1999 (Mein Link oben, fünfter Punkt) durchaus eine Sondernutzung sein: "Ob das Abstellen eines zugelassenen und betriebsbereiten Fahrzeugs im Einzelfall noch als lediglich vorübergehende Unterbrechung des fließenden Verkehrs ein dem Gemeingebrauch unterfallendes zulässiges Parken darstellt oder schon eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung beinhaltet, hängt dabei u. a. davon ab, ob das Kraftfahrzeug zu einem anderen Zweck als dem der späteren Inbetriebnahme abgestellt wurde. Dies muss an Hand der Einzelumstände entschieden werden." - Wie konsequent das verfolgt wird, ist natürlich eine andere Frage. Allerdings hat die Ordnungsbehörde unseres Städtchen meinen ehemaligen Arbeitgeber aufgefordert, einen Werbeanhänger genau deshalb zu entfernen. --Joyborg 19:57, 9. Jan. 2016 (CET)
- Und genau das ist der Grund, warum diese Anhänger normalerweise nicht wie oben behauptet auf öffentlichen Parkplätzen stehen, sondern vorzugsweise auf irgendwelchen privaten Grundstücken, deren Eigentümer dafür eventuell einen Obulus kriegen. Dafür müssen sie (die Anhänger meine ich jetzt) nämlich auch weder eine Zulassung noch TÜV noch sonstwas haben, was sie für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr qualifiziert - nichtmal Räder sind unbedingt nötig. Nur der Aufdruck muss gut lesbar sein. --Snevern 21:21, 9. Jan. 2016 (CET)
- Gelegentlich findet man in der Werbung (dafür) und auch hier den weniger offiziellen Begriff "parkende Werbung". Play It Again, SPAM (Diskussion) 23:07, 9. Jan. 2016 (CET)
- Dort, Birkenstraße 52, 40233 Düsseldorf, Koordinaten: 51.226962, 6.803893 war nach Streetview noch nicht immer Halteverbot. Unsere Städte klagen über leere Kassen. Las Vegas hat – zumindest auf dem Strip – die Straßenbeleuchtung quasi-privatisiert. NY am Time Square ebenso. --Hans Haase (有问题吗) 23:22, 9. Jan. 2016 (CET)
- Gelegentlich findet man in der Werbung (dafür) und auch hier den weniger offiziellen Begriff "parkende Werbung". Play It Again, SPAM (Diskussion) 23:07, 9. Jan. 2016 (CET)
- Und genau das ist der Grund, warum diese Anhänger normalerweise nicht wie oben behauptet auf öffentlichen Parkplätzen stehen, sondern vorzugsweise auf irgendwelchen privaten Grundstücken, deren Eigentümer dafür eventuell einen Obulus kriegen. Dafür müssen sie (die Anhänger meine ich jetzt) nämlich auch weder eine Zulassung noch TÜV noch sonstwas haben, was sie für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr qualifiziert - nichtmal Räder sind unbedingt nötig. Nur der Aufdruck muss gut lesbar sein. --Snevern 21:21, 9. Jan. 2016 (CET)
- Es kann laut OVG Hamburg v. 20.12.1999 (Mein Link oben, fünfter Punkt) durchaus eine Sondernutzung sein: "Ob das Abstellen eines zugelassenen und betriebsbereiten Fahrzeugs im Einzelfall noch als lediglich vorübergehende Unterbrechung des fließenden Verkehrs ein dem Gemeingebrauch unterfallendes zulässiges Parken darstellt oder schon eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung beinhaltet, hängt dabei u. a. davon ab, ob das Kraftfahrzeug zu einem anderen Zweck als dem der späteren Inbetriebnahme abgestellt wurde. Dies muss an Hand der Einzelumstände entschieden werden." - Wie konsequent das verfolgt wird, ist natürlich eine andere Frage. Allerdings hat die Ordnungsbehörde unseres Städtchen meinen ehemaligen Arbeitgeber aufgefordert, einen Werbeanhänger genau deshalb zu entfernen. --Joyborg 19:57, 9. Jan. 2016 (CET)
Aus Marketingsicht nennt man das Ambient-Marketing: Überraschende Veränderungen im direkten Lebensumfeld einer Zielgruppe durch Werbebotschaften wie z.B. Streetbranding erzeugen hier Aufmerksamkeit. Schwierig zu planen kann jedoch die perfekte Umsetzung einen enorm nachhaltigen Effekt innerhalb der Zielgruppe haben. --Graf Umarov (Diskussion) 01:20, 10. Jan. 2016 (CET)
Illegale Werbetafeln - In NRW gibt es die gesetzliche Regelung, dass über den Gemeingebrauch hinaus gehende Nutzungen von Straßen und Wegen eine genehmigungspflichtige Sondernutzung darstellen. Dies wird grundsätzlich dann angenommen, wenn eine Standzeit von 14 Tagen überschritten wird. Jetzt kann man sich denken, nach wie viel Tagen dann üblicherweise die Dinger von den Besitzern umgesetzt werden ... Hier in der Stadt war es ein Anhänger mit Angeboten für erotische Dienstleistungen mitten auf einer Autobahnüberführung, die Bürger, Lokalpresse und Verwaltung in Wallung brachte (hier ein Bericht mit Foto). Letztere gab sich zunächst machtlos, mittlerweile scheint das Ding aber nicht mehr aufgestellt zu werden. Benutzerkennung: 43067 10:23, 10. Jan. 2016 (CET)
- "Aus Marketingsicht..." nennt man das wohl "Ambient-Marketing" oder "Guerilla"-Marketing. Aus Sicht der Gemeinschaft(smehrheit) wird das wohl unterschiedlich bewertet. Das das Ordungsamt machtlos ist, liegt entweder an der fehlenden rechtlichen Grundlage oder der Ermessensauslegung des Ordnungsamts. Wenn das Ordnungsmat das Ermessen "falsch" auslegt, sollte der Gesetzgeber dafür sorgen, das Eindeutigkeit besteht.--Wikiseidank (Diskussion) 11:06, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ambient Media-Marketing ist etwas anderes. Das ist der Hinweis auf die Pizzeria nebenan auf der Rückseite des Parkscheins. Play It Again, SPAM (Diskussion) 11:13, 10. Jan. 2016 (CET)
- "Aus Marketingsicht..." nennt man das wohl "Ambient-Marketing" oder "Guerilla"-Marketing. Aus Sicht der Gemeinschaft(smehrheit) wird das wohl unterschiedlich bewertet. Das das Ordungsamt machtlos ist, liegt entweder an der fehlenden rechtlichen Grundlage oder der Ermessensauslegung des Ordnungsamts. Wenn das Ordnungsmat das Ermessen "falsch" auslegt, sollte der Gesetzgeber dafür sorgen, das Eindeutigkeit besteht.--Wikiseidank (Diskussion) 11:06, 10. Jan. 2016 (CET)
Ich kann da keinerlei Mißbrauch erkennen. Wieso wird davon ausgegangen? --Pölkkyposkisolisti 11:27, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn das Auto mit der Werbung nur auf dem Parkplatz steht, um Werbung zu machen und nicht benutzt wird, blockiert es einen Parkplatz.--Antemister (Diskussion) 15:17, 10. Jan. 2016 (CET)
- Na und? Dafür sind Parkplätze da. Außerdem kann niemand eine Grenze ziehen. So gut wie alle Dienstwagen von Handwerkern haben Werbung. Und das ist auch gut so, so weiß man als Bauleiter, wem welches Auto gehört. Und man hat Telefonnummern immer verfügbar. Darf ich jetzt nicht mehr vor der Haustür parken, wenn ich einen Aufkleber ans Auto pappe? --Pölkkyposkisolisti 15:53, 10. Jan. 2016 (CET)
- Doch, natürlich. Es geht um den Sinn des Abstellens, und der besteht beim (mit Werbung bedruckten) Handwerkerfahrzeug in erster Linie darin, den Handwerker und sein Handwerkszeug zu transportieren. Dafür sind Parkplätze da - nicht um Werbung für Werbetreibende zu ermöglichen. Die Tatsache, dass Grenzen schwer zu ziehen sind, ändert daran nichts: Häufig müssen Verwaltung, Vollzugsbeamte oder Richter von den äußeren Umständen auf die Motive des Handelnden schließen und dann entsprechende Konsequenzen ziehen - oder eben nicht. --Snevern 16:41, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn ein Auto ein paar Stunden am Straßenrand steht, tut es das wohl nicht für Werbung. Wenn ein abgewracktes Gefährt, bei dem man sich wundert, wie es da hingekommen ist, und sich fragt, wie es je aus eigener Kraft da wegkommen sollte, seit Monaten an derselben Stelle steht und ein Plakat trägt, das größer ist als das Gefährt selbst, ist der SInn vermutlich nicht der Transport. Klar gibt es dazwischen Zweifelsfälle, aber das ändert doch nichts daran, dass manche Parkraum für Werbung missbrauchen. --Eike (Diskussion) 16:49, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn ein zugelassenes und fahrbereites Auto irgendwo parkt, dann kann man nichts dagegen tun oder sagen, wieso auch? Dabei ist es unerheblich, ob das Fahrzeug irgendwie beschriftet ist oder nicht. Das ist in StVO und StVZO nicht vorgesehen. Werbung wird dann (eventuell) problematisch, wenn dadurch der Charakter eines hoheitlichen Fahrzeuges entsteht. Feuerwehrrot ist verboten, die Aufschrift "Pozilei" auf einem ehemaligen Polizeiauto jedoch nicht. Dachwerbung muß sicher angebracht sein. Alles Andere ist rechtlich vollkommen irrelevant. Ist es eine offensichtliche Schrottkarre, wird die Polizei den TÜV-Aufkleber kontrollieren und wenn der in Ordnung ist, wird sie nur etwas unternehmen, wenn ein Mangel offensichtlich ist (auslaufendes Öl, fehlende Bremsen oder so). Bei schrottreifen Fahrrädern mit Werbung wird es einfacher, weil die Verkehrssicherheit einfacher als beim Auto feststellbar ist. Die Motive, warum ich ein Auto auf gerade diesem zugelassenen Parkplatz parke, gehen niemanden etwas an. --Pölkkyposkisolisti 10:58, 11. Jan. 2016 (CET)
- "Die Motive, warum ich ein Auto auf gerade diesem zugelassenen Parkplatz parke, gehen niemanden etwas an." Pölkky, auch wenn Du es nicht glauben willst: Du irrst. Siehe oben. --Joyborg 11:52, 11. Jan. 2016 (CET)
- Vielleicht solltest du das den Gerichten mitteilen. [20] [21] --Eike (Diskussion) 12:05, 11. Jan. 2016 (CET)
- Ja, Pölkky, du irrst. Nicht alles, was man mit einem fahrbereiten, zum Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeug tun kann, ist auch erlaubt. Das mag daran liegen, dass es nicht nur für das Fahrzeug Vorschriften gibt, die man zu beachten hat, auch nicht nur für den Fahrer, der es bewegt, sondern auch für die Straße und den erlaubten Gebrauch derselben. So ist zum Beispiel unnützes Hin- und Herfahren innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn Andere dadurch belästigt werden (nachzulesen in § 30 Absatz 1 Satz 3 StVO). Und Parkplätze sind eben zum Parken da, und wenn ein Parkplatz als Dauerwerbefläche genutzt wird, steht er der Allgemeinheit nicht mehr zum Parken zur Verfügung. Zugegeben, die Grenzen sind fließend, und die Grenze des Zulässigen ist schwer festzustellen; ein Missbrauch ist daher nur schwer zu verhindern. Aber die Rechtslage ist dennoch so. Man sollte Dinge nicht allein deshalb erlauben, weil man sie im Einzelfall nur schwer beweisen kann. --Snevern 17:10, 11. Jan. 2016 (CET)
- Ok, wieder was gelernt. Hab ich so nicht erwartet. --Pölkkyposkisolisti 19:27, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wenn ein zugelassenes und fahrbereites Auto irgendwo parkt, dann kann man nichts dagegen tun oder sagen, wieso auch? Dabei ist es unerheblich, ob das Fahrzeug irgendwie beschriftet ist oder nicht. Das ist in StVO und StVZO nicht vorgesehen. Werbung wird dann (eventuell) problematisch, wenn dadurch der Charakter eines hoheitlichen Fahrzeuges entsteht. Feuerwehrrot ist verboten, die Aufschrift "Pozilei" auf einem ehemaligen Polizeiauto jedoch nicht. Dachwerbung muß sicher angebracht sein. Alles Andere ist rechtlich vollkommen irrelevant. Ist es eine offensichtliche Schrottkarre, wird die Polizei den TÜV-Aufkleber kontrollieren und wenn der in Ordnung ist, wird sie nur etwas unternehmen, wenn ein Mangel offensichtlich ist (auslaufendes Öl, fehlende Bremsen oder so). Bei schrottreifen Fahrrädern mit Werbung wird es einfacher, weil die Verkehrssicherheit einfacher als beim Auto feststellbar ist. Die Motive, warum ich ein Auto auf gerade diesem zugelassenen Parkplatz parke, gehen niemanden etwas an. --Pölkkyposkisolisti 10:58, 11. Jan. 2016 (CET)
- Na und? Dafür sind Parkplätze da. Außerdem kann niemand eine Grenze ziehen. So gut wie alle Dienstwagen von Handwerkern haben Werbung. Und das ist auch gut so, so weiß man als Bauleiter, wem welches Auto gehört. Und man hat Telefonnummern immer verfügbar. Darf ich jetzt nicht mehr vor der Haustür parken, wenn ich einen Aufkleber ans Auto pappe? --Pölkkyposkisolisti 15:53, 10. Jan. 2016 (CET)
Ich kenne einen Fall, wo ein Fahrrad mit angebrachtem Schild geparkt ist, das auf das gegenüberliegende Geschäft hinweist. Das steht da immer, wenn ich vorbeikomme. --Distelfinck (Diskussion) 17:14, 11. Jan. 2016 (CET) Wenn da Köln keine Handhabe hat ist das ein Internes Problem. Wahrscheinlich hat das Ordnungsamt Anweisung keine Gerichtsverfahren anzustreben oder so. Selbstverständlich kann immer geklagt werden, falls die festgelegt wird das eine Sondernutzung vorliegt. Dann muss das halt vor Gericht. Aber dort findet immer noch eine Abwägung durch den Richter statt und die sind nun mal auch nicht ganz weltfremd. Ein bisschen die Werbetafel alle 2 Wochen bewegen hilft dann auch nicht mehr. Das ist wie mit der Parkscheibe und dem Kreidestrich auf dem Reifen. Da hatte auch einer geklagt weil er ja sein auto aus der Lücke rausgefahren und dann wieder rein gefahren hatte. Und wen wurdert es der Richter hat festgestellt, dass auch wenn der Parkplatz verlassen wurde nur um direkt wieder hineinzufahren eben kein erneutes parken ist. Bauernschlau ist hat nicht alles. -- Mephisto - Disk Ich bin der Geist, der stets verneint 12:28, 12. Jan. 2016 (CET)
Wer kann diese Signatur / Unterschrift auf dem Gemälde entziffern?

Habe das Bild auf dem Flohmarkt erstanden. Es ist ein Stillleben mit Obst (Wein und Äpfel) und einem Krug, alles auf einer weißen Tischdecke. Wer kann die Signatur entziffern?
--Piadora (Diskussion) 17:04, 9. Jan. 2016 (CET)
- Karl-Heinz, Nachbar, Hobby-Maler --87.148.75.22 17:29, 9. Jan. 2016 (CET)
- So wird das nichts, weil man nach Signaturen auf Stillleben nicht nur nach den Signaturen suchen kann. Bitte das ganze Bild zeigen. Wahrscheinlich wird es schwiereig, weil Bilder von wirklich berühmten Malern nur selten auf Flohmärkten auftauchen. Play It Again, SPAM (Diskussion) 23:09, 9. Jan. 2016 (CET)
- Die werden aber hier und da anderen Artikeln beigelegt oder auch direkt verkauft. --2003:76:E4C:F1AD:8530:90E9:242D:23FF 23:51, 9. Jan. 2016 (CET)
Suche ein Mailprgramm das zu mir passt.
...und es sollte folgendes können: Ich hätte gerne eine Tabelle, bei der links runter alle meine 150 Adressen stehen und oben dann Spalten sind für meine verschiedenen Verteiler. Dann möchte ich ein X setzen können bei denen, die im Verteiler sind und kein X bei denen die keine Lust auf die eine oder andere Mail haben. Habt Ihr Tipps, egal ob kostenpflichtig oder gratis. Rolz-reus (Diskussion) 17:51, 9. Jan. 2016 (CET)
- Mal eine Rückfrage: Welches Mailprogramm verwendest Du bisher? --Rôtkæppchen₆₈ 18:51, 9. Jan. 2016 (CET)
Outlook rolz-reus (nicht signierter Beitrag von 84.166.159.83 (Diskussion) 08:40, 10. Jan. 2016 (CET))
nulla scientia melior musica animae harmonia
Wie lautet die Übersetzung dieser lateinischen Phrase? Woher stammt sie ursprünglich? --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 21:05, 9. Jan. 2016 (CET)
- Keine Wissenschaft ist besser als die Musik, die Harmonie der Seele. Diese Veröffentlichung (nicht der Swoboda, sondern weiter unten) könnte eventuell darauf hindeuten, dass es sich um ein Zitat von Hildegard von Bingen handelt. Laut dem New Grove Dictionary of Music trägt auch eine Motette von Cipriano di Rore aus dem Jahr 1544 den Titel Nulla scientia melior. --Jossi (Diskussion) 21:36, 9. Jan. 2016 (CET)
- Vielen Dank für die Übersetzung. Der Weg zu Hildegard von Bingen ist mir allerdings zu gewagt. Nach dieser Seite würde ich es schon in die römische Antike einordnen, wüsste aber gerne (falls ermittelbar) den genaueren Ursprung. Dort steht als Quelle "Detto segnalato da Franco C.", womit ich aber nichts anfangen kann. Der Spruch scheint in Musiker-Kreisen verbreitet. Ich finde ihn u.a. als Wahlspruch eines Ensembles hier und habe ihn in einem Konzertmitschnitt kunstvoll als Aufschrift auf einem Cembalo angebracht gesehen. --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 06:54, 10. Jan. 2016 (CET)
- Seltsamer Satz. Ich bin gespannt, ob sich die Quelle finden lässt; ich finde sie nicht. Man weiß aber auch nicht recht, wo man zu suchen anfangen soll, denn über die Zusammenhänge Musik/Harmonie/Weltseele/menschliche Seele wird ja seit vor Plato immer wieder geschrieben, über Aristoteles, Cicero, Boethius, Isidor, die Scholastiker, die Mystiker... Wenn der Ausspruch gutes Latein ist, verstehe ich ihn nicht wirklich. Scientia ist ja nicht die objektive Fachwissenschaft, sondern mehr das Wissen als solches; Musik hingegen ist eine ars, eine techne. Mal sehen, wer Licht ins Dunkel bringen kann. Grüße Dumbox (Diskussion) 10:47, 10. Jan. 2016 (CET)
- Pseudo-Latein im Titel eines Albums der Florentiner Rockband Novonada, Fundstellen ab 2012 im Internet, hier anhören. --Pp.paul.4 (Diskussion) 12:54, 10. Jan. 2016 (CET)
- Hm, glaube ich nicht. Auf der ersten von mir angegebenen Quelle steht es als "lateinisches Sprichwort", wenn ich das richtig deute und wird einem "Franco C." zugeschrieben. Im Bereich der klassischen Musik scheint der Spruch verbreitet zu sein (s. mein voriger Post). --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 15:45, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich habe im Netz auch mehrere Konzertberichte gefunden, in denen der Spruch als Verzierung auf Cembalodeckeln, und zwar bei Kopien historischer Instrumente, auftaucht. Novonada ist keinesfalls die Quelle, der Spruch ist älter; das zeigt schon der von mir angeführte Motettentitel, der eine Kürzung dieses Satzes hier sein dürfte. Auffällig ist, dass die ganz große Mehrzahl der Fundstellen im Internet italienischer Herkunft sind. Dieser Website würde ich allerdings keinen großen Beweiswert zuschreiben, das ist einfach eine der Internet-üblichen Sammelsuriums-Seiten aller möglichen lateinischen Sprüche ohne jede Quelle. Das schon von Dumbox monierte etwas fragwürdige Latein scheint mir eher für einen mittel- oder neulateinischen Ursprung zu sprechen. Der Hildegard-Hinweis ist mehr als schwach, da stimme ich dir zu; andererseits würde der Satz ganz hervorragend in ihre Musiktheorie passen. Leider scheinen digitalisierte lateinische Schriften Hildegards, die man durchsuchen könnte, extrem rar gesät zu sein. (Ganz zu schweigen davon, dass man bei der Websuche in einen Riesenstrudel esoterischer Geschäftemacherei mit ihrem Namen gerät, vom Hildegard-Tee bis zum Hildegard-Seminar – irgendwann habe ich entnervt das Handtuch geworfen.) --Jossi (Diskussion) 22:09, 10. Jan. 2016 (CET)
- Hm, glaube ich nicht. Auf der ersten von mir angegebenen Quelle steht es als "lateinisches Sprichwort", wenn ich das richtig deute und wird einem "Franco C." zugeschrieben. Im Bereich der klassischen Musik scheint der Spruch verbreitet zu sein (s. mein voriger Post). --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 15:45, 10. Jan. 2016 (CET)
- Pseudo-Latein im Titel eines Albums der Florentiner Rockband Novonada, Fundstellen ab 2012 im Internet, hier anhören. --Pp.paul.4 (Diskussion) 12:54, 10. Jan. 2016 (CET)
- Seltsamer Satz. Ich bin gespannt, ob sich die Quelle finden lässt; ich finde sie nicht. Man weiß aber auch nicht recht, wo man zu suchen anfangen soll, denn über die Zusammenhänge Musik/Harmonie/Weltseele/menschliche Seele wird ja seit vor Plato immer wieder geschrieben, über Aristoteles, Cicero, Boethius, Isidor, die Scholastiker, die Mystiker... Wenn der Ausspruch gutes Latein ist, verstehe ich ihn nicht wirklich. Scientia ist ja nicht die objektive Fachwissenschaft, sondern mehr das Wissen als solches; Musik hingegen ist eine ars, eine techne. Mal sehen, wer Licht ins Dunkel bringen kann. Grüße Dumbox (Diskussion) 10:47, 10. Jan. 2016 (CET)
- Vielen Dank für die Übersetzung. Der Weg zu Hildegard von Bingen ist mir allerdings zu gewagt. Nach dieser Seite würde ich es schon in die römische Antike einordnen, wüsste aber gerne (falls ermittelbar) den genaueren Ursprung. Dort steht als Quelle "Detto segnalato da Franco C.", womit ich aber nichts anfangen kann. Der Spruch scheint in Musiker-Kreisen verbreitet. Ich finde ihn u.a. als Wahlspruch eines Ensembles hier und habe ihn in einem Konzertmitschnitt kunstvoll als Aufschrift auf einem Cembalo angebracht gesehen. --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 06:54, 10. Jan. 2016 (CET)
Bei der Motette des Cipriano de Rore geht es um Selbsterkenntnis, nicht um Musik: „Nulla stientia <sic> melior, nulla doctrina salubrior qua quis se ipsum cognoscit“ - Es gibt kein besseres Wissen, keine heilbringendere Lehre, als daß einer sich selbst erkennt. Klaus Müller (Theologe): Voraussetzungen, Fragen und Fluchtlinien der Gegenwartsphilosophie. Vorlesung WS 2006/07
Das dürfte auf den tractatus de interiori domo des Bernhard von Clairvaux zurückgehen, wo es im 36. Kapitel heißt: „Cum inter omnia animalia, humanum genus tum digniori forma, tum digniori potentia dignius reperiatur; nulla scientia melior est illa, qua cognoscit homo se ipsum. Relinque ergo caetera, et te ipsum discute: per te curre, et in te consiste.“ --Vsop (Diskussion) 10:45, 11. Jan. 2016 (CET)
Bitte nicht drängeln, Benutzer:Pp.paul.4! --Vsop (Diskussion) 18:26, 11. Jan. 2016 (CET)
- Bitte Butter bei die Fische: Wer kann einen Beleg für den Spruch anbieten, der vor das Jahr 2010 zurückreicht? Wer kennt einen Beleg, dass es mit Hildegard von Bingen zu tun hat? Hildegards Diskographie umfasst bestimmt 1000 Einträge, aber nichts dergleichen. Der Blog-Eintrag mit dem Cembalo-Deckel vom 23. Juli 2015 schreibt, dass Giovanni Togni beim Festival Urbino Musica Antica am 20. Juli 2015 auf dem Nachbau eines Dulcken-Cembalos von 1740 gespielt hat. Der Spruch war auf dem Deckel des Cembalo-Nachbaus, das zählt nur als Beleg für 2015, nicht als Beleg für 1740, da gerade bei Cembalo-Nachbauten der Käufer das Deckel-Motto vorgibt (siehe Customer choice of Latin lid mottoes, bzw. weitere Mottos für Cembalos). Und bei einem anderen Hersteller heißt es zu einer Auswahl ähnlich verquerer Mottos: Mottos marked by † in the list below don’t appear on surviving original instruments or iconography, but were chosen specially by our customers to reflect their own particular philosophies. (Und bitte aus dem † keinen Strick drehen - es ist nicht antisemitisch gemeint.) --Pp.paul.4 (Diskussion) 11:30, 11. Jan. 2016 (CET)
Wie ich erst jetzt bemerke (sorry), liefert meine erstgenannte Quelle auch eine Übersetzung ins Italienische. Diese mit Google-Translate verdeutscht, liefert: "Keine Erkenntnis übersteigt die Musik für das Wohl der Seele." Sicher etwas holprig, aber in der Tendenz noch etwas anders als die Version von Jossi2. --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 16:14, 11. Jan. 2016 (CET)
- harmonia kann nur (Gleichsetzungs-)Nominativ oder Ablativ sein. Für die Übersetzung des Italieners müsste es Dativ sein (harmoniae), ganz abgesehen davon, dass ich es für recht gewagt halte, „harmonia“ mit „Wohlbefinden“ (benessere) zu übersetzen. Die Übersetzung ist falsch. --Jossi (Diskussion) 16:22, 11. Jan. 2016 (CET)
- Na ja, es könnte schon sein, dass "Franco C." (Wer ist das???) den Gedanken auf diese Weise latinisiert hat, mit "animae harmonia" als angebautem ablativus limitationis. Aber im Ernst, elegantes Latein ist das nicht... Grüße Dumbox (Diskussion) 16:37, 11. Jan. 2016 (CET)
- Und die Aussage (freie Deutung meinerseits) "Die Musik leistet mehr für das Wohl der Seele als jede Wissenschaft" könnte im Kontext ja ganz gut passen. --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 16:42, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wenn das gemeint sein sollte, dann kommen wir aber weit weg von dem 2500-jährigen philosophischen Kontext dieser Begriffe und nähern uns der Welt der Entspannungs-CDs inkl. Kräutertee... ;) Grüße Dumbox (Diskussion) 16:47, 11. Jan. 2016 (CET)
- Nicht unbedingt. Aus meiner Sicht ist es mehr ein Ausdruck von Hochachtung vor dieser Kunst. Aber egal - es handelt sich offenbar nicht um eines der relativ geläufigen lateinischen Zitate, die man kennen müsste. Insofern ist ja meine Ausgangsfrage mehr oder weniger beantwortet. --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 17:01, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wenn das gemeint sein sollte, dann kommen wir aber weit weg von dem 2500-jährigen philosophischen Kontext dieser Begriffe und nähern uns der Welt der Entspannungs-CDs inkl. Kräutertee... ;) Grüße Dumbox (Diskussion) 16:47, 11. Jan. 2016 (CET)
- Und die Aussage (freie Deutung meinerseits) "Die Musik leistet mehr für das Wohl der Seele als jede Wissenschaft" könnte im Kontext ja ganz gut passen. --Thomas Binder, Berlin (Diskussion) 16:42, 11. Jan. 2016 (CET)
- Na ja, es könnte schon sein, dass "Franco C." (Wer ist das???) den Gedanken auf diese Weise latinisiert hat, mit "animae harmonia" als angebautem ablativus limitationis. Aber im Ernst, elegantes Latein ist das nicht... Grüße Dumbox (Diskussion) 16:37, 11. Jan. 2016 (CET)
Kanada Einwanderung Auskunft
Hallo, also wir hatten Verwandte, die in 1930er Jahren aus dem Sudetenland nach British Columbia in Kanada ausgewandert sind. Bis zu ihrem Tod hatten wir mit ihnen noch Kontakt, sie hatten auch Kinder gehabt, mit denen haben wir leider keinen Kontakt mehr. Daher zu meiner Frage, gibt es in Kanada irgend eine Behörde, bei der man Anfragen kann, wo diese eventuell gemeldet sind? --Gruß, dersachse95 • You can say you to me! 21:56, 9. Jan. 2016 (CET)
- Das erste was ich probieren würde, ist das Telefonbuch. Die Namen sollte man aber natürlich wissen und dann einfach macl sich höflich vorstellen und nachfragen. Bestimmte deutsche Namen sind nämlich nicht sehr häufig im Ausland, so dass man auf diese Weise die Chance hat jemand zu finden. Denke auch an die Möglichkeit, dass die den Namen etwas abgewandelt haben zwecks erleichterter Aussprache. In Canada ist man für gewöhnlich bei solchen Sachen recht offen und hilfsbereit. Falls da nichts rauskommt, müsstest du dort vorsprechen, wo das Einwohnermeldeamt ist, die können dann deine Adresse an die Kinder weitergeben, dann bleibt nur zu warten, ob die an einem Kontakt interessiert sind. Es gibt auch in jeder größeren Stadt irgendwelche Stammtische, Treffen oder Vereine von Deutschstämmigen, auch da hat man die Chancen Personen oder zumindest Namen in Erfahrung zu bringen, natürlich nur, wenn diese Leute an solchen Sachen teilgenommen haben. --Giftzwerg 88 (Diskussion) 22:25, 9. Jan. 2016 (CET)
- Danke erstmal für die Infos, wir fahren im Sommer auch mal den Ort, von dem wir die letzte Adresse haben, vielleicht weiß dort irgendjemand noch was, meine Eltern waren das letzte mal 1989 dort. Also der Name ist eher Tschechisch, war ja alles Böhmen. Im Internet findet man die Todesdaten der Verwandten, aber halt auch nicht mehr. Wir werden es mal versuchen! --Gruß, dersachse95 • You can say you to me! 22:31, 9. Jan. 2016 (CET)
- Es wäre vielleicht effizienter, eine solche Anfrage in aller Freundlichkeit an die Zeitungsredaktion zu stellen, die diesen Ort mit einer Lokalzeitung bedient. Und schaden wird es garantiert nicht. Journalisten kennen sich vor Ort am besten aus, es gibt vielleicht sogar eine schöne Story (die europäischen Wurzeln auf der Suche... oder so). Und die Tipps zum Vorgehen nach der Suche sind sicher substantieller als auf der de.wp-Auskunft zu fragen. Und wenn es schon Wikipedia-Bezug haben soll: die en.wp hat soch auch ein Auskunftssystem, oder? --2003:45:467E:DC00:D8F1:5D96:4A63:69CA 22:46, 9. Jan. 2016 (CET)
- Auch eine (Internet-)Recherche in Genealogie-Dateien könnte was bringen, zB.in family-search oder auch eine Anfrage in einem genealogischen Board. Gerade die Sudeten haben da ja einiges. In den USA sind sehr viele Verstorbene über findagrave.com zu finden, einfach mal die Namen und ggf. Geburtsjahre eingeben. --Hachinger62 (Diskussion) 18:49, 10. Jan. 2016 (CET) Oh, Zwischentext nicht gelesen, aber dennoch für andere evtl. sinnvoll.
- Wenn man „die Todesdaten der Verwandten“ im Internet findet, könnte man dieser Spur nachgehen, und den Eigentümer des Grabes oder den Aufgeber der Todesanzeige ermitteln. Eine „brute force“-Suche mit Canada411 könnte Adressen der Kinder liefern. Man könnte den Nacheigentümer des Hauses (falls Eigenheim) ermitteln und dort anrufen (lassen). --Pp.paul.4 (Diskussion) 15:10, 11. Jan. 2016 (CET)
- Danke erstmal für die Infos, wir fahren im Sommer auch mal den Ort, von dem wir die letzte Adresse haben, vielleicht weiß dort irgendjemand noch was, meine Eltern waren das letzte mal 1989 dort. Also der Name ist eher Tschechisch, war ja alles Böhmen. Im Internet findet man die Todesdaten der Verwandten, aber halt auch nicht mehr. Wir werden es mal versuchen! --Gruß, dersachse95 • You can say you to me! 22:31, 9. Jan. 2016 (CET)
Lateinamerika Katalog des Bibliotheksnetzwerks?
Wie finde ich den gemeinsamen Katalog des lateinamerikanischen Bibliotheksnetzwerks? Danke --C.Koltzenburg (Diskussion) 22:04, 9. Jan. 2016 (CET)
- Meinst Du den Bibliothekskatalog des Instituto Cervantes? --Rôtkæppchen₆₈ 00:05, 10. Jan. 2016 (CET)
- Was genau meinst du mit "lateinamerikanischen Bibliotheksnetzwerks" Wenn es Iberialiber, der ersten GoogleTreffer ist, dann kannst du ja den KVK verwenden, aber bzgl. Deutschlnad dürfte die Bibliotek des IAI dem doch überlegen sein.--Antemister (Diskussion) 11:30, 10. Jan. 2016 (CET)
10. Januar 2016
Kamera gesucht
Ich suche was, was es nicht geben kann - aber vielleicht etwas, was dem nahekommt? Kompaktkameras haben kleine Sensoren und kleine Objektive, deshalb kann die Qualität nie die von SLR erreichen, das weiß ich. Vor allem die winzigen Sensoren taugen nicht viel. Nin gibt es bei Bridge aber Modelle, die (z. B.) APS-C-Sensoren haben, die auch in Spiegelreflex verbaut werden - so wie Fujifilm X-Serie. Beim Stöbern auf Amazon finde ich jedoch seltenst Angaben über den Sensor, dort wird nur mit Megapixeln geprotzt, die aber egal sind. Gibt es Kompaktmodelle mit größeren Sensoren, wie sucht und findet man die? Mein Traummodell wäre: APS-C-Sensor oder etwas kleiner, R6-Batterien, lichtstarkes Objektiv. --Pölkkyposkisolisti 00:10, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn Du sie kühlst, rauscht der Bildsensor weniger. Sonst siehe http://www.dpreview.com/ --Hans Haase (有问题吗) 00:18, 10. Jan. 2016 (CET)
- Klar, am Nordpol kann man jede Knipse nehmen - aber da macht man selten Urlaub. Soll für meine Frau sein. Und Leica D-Lux ist dann aber doch ein wenig außerhalb meiner finanzieller Vorstellungen :( --Pölkkyposkisolisti 00:20, 10. Jan. 2016 (CET)
- http://www.dpreview.com/reviews?category=compacts ← die Kompakten sind dort. Für einen attraktiven Preis musst Du wohl 2 bis 3 Jahre alte Modelle heranziehen. Die Akkus gibt es da nachzukaufen. Canon PowerShot SD 4000 IS hat eine kleine Linse aber einen relativ großen Sensor und kann man sich im Urlaub auch mal stehlen lassen. Beides größer hat die PowerShot SX260 HS. Von den Bilder hat mich die Panasonic Lumix DMC-FZ150 nicht überzeucgt, aber sie kann wohl für einen Foto relativ gut HD-Videos mit 50 fps filmen und ist fernauslösbar. Sony Cyber-shot DSC-HX200V ist etwas größer aber im Schärfenvergleich mE nicht besser. Mit der Canon PowerShot G1 X (Mark II) ist Dein Wunsch nach Qualität und Preis vllt vereinbar. --Hans Haase (有问题吗) 01:30, 10. Jan. 2016 (CET)
- Klar, am Nordpol kann man jede Knipse nehmen - aber da macht man selten Urlaub. Soll für meine Frau sein. Und Leica D-Lux ist dann aber doch ein wenig außerhalb meiner finanzieller Vorstellungen :( --Pölkkyposkisolisti 00:20, 10. Jan. 2016 (CET)
- Etwas kleiner als APS-C wäre der Four-Thirds-Sensor. Ich persönlich bin vernarrt in die Olympus-OM-D-Serie, die stehen APS-C in der Bildqualität in absolut nichts nach, sind handlich und durchdacht und bieten vor allem eine breite Palette guter lichtstarker Optiken. Wenn OM-D schon zu groß ist, schau dir die PENs an – gleiches System ohne festen Sucher, daher kleiner. Würde ich heute was Kompaktes kaufen wollen, wäre es eine PEN plus das M.Zuiko Pancake 14–42. In der Größenklasse dürfte es kaum was Besseres geben. Aber Kameras, die mit AA-Zellen laufen, findest du da wahrscheinlich nicht. Die werden auf Kleinheit getrimmt, da bietet nur LiIon ein brauchbares Ladungs-Volumen-Verhältnis. Bei Reisekameras ist mir wichtig, daß ich sie per USB in der Kamera laden kann und nicht noch ein extra Ladegerät mitschleppen muß.
- Aber für Kameras gilt heute: Richtig schlechte gibt es nicht, es kommt auf a) den Einsatzzweck und b) die subjektive Bedienbarkeit für dich an. Die Kamera, mit der du am besten klarkommst, ist die beste für dich. --Kreuzschnabel 07:45, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wie findet man sowas? Hier gewünschte Sensorgröße(n), "kompakte" Länge/Breite/Höhe, gewünschte Lichtstärke, gewünschten Preis eingrenzen und kucken, was übrigbleibt. --Eike (Diskussion) 11:36, 10. Jan. 2016 (CET)
- Guter Vergleich, die gefundenen Modelle kann man dann mit den Beispielbildern des Falschenetiketts beim DPReview (oben verlinkt) vergleichen. --Hans Haase (有问题吗) 17:44, 10. Jan. 2016 (CET)
- Danke, dieser Vergleich ist sehr hilfreich. --Pölkkyposkisolisti 08:56, 11. Jan. 2016 (CET)
- Dieser Vergleich sagt dir, wie scharf bzw. gut aufgelöst die Bilder sind, die die Kameras unter den dort gegebenen Studiobedingungen liefern. Du willst aber eine Kamera, die unter den von dir gesetzten Bedingungen gute Bilder liefert (und hohe Auflösung und Schärfe sind nur kleine Teilaspekte von „gut“). Da spielen sehr viele Faktoren mit rein – was nützt einem z.B. bei der Bühnenfotografie, wo alles auf den richtigen Moment ankommt, eine Kamera, die man vom Auge absetzen muß, um wichtige Einstellungen zu ändern oder zu überprüfen? Was nutzt einem in der Porträtfotografie ein 20-fach-Telezoom, das zwar jede Pore phantastisch nachzeichnet, aber eine total häßliche Unschärfe in den Hintergrund zeichnet? Was nutzen einem in der Landschaftsfotografie Sensoren mit 36 Megapixel Auflösung, wenn das Rauschen von einer Software weggeschmiert werden muß, was bei 12 oder 18 Megapixel nicht nötig gewesen wäre, weil größere Pixel einfach mehr Rauschabstand bieten? Daher immer mein Hinweis: Es gibt keine absolut beste Kameraausrüstung, aber es gibt eine beste Kameraausrüstung für das, was du damit machen willst. Und da hilft meist nur: ausprobieren. --Kreuzschnabel 08:02, 12. Jan. 2016 (CET)
- Danke, dieser Vergleich ist sehr hilfreich. --Pölkkyposkisolisti 08:56, 11. Jan. 2016 (CET)
- Guter Vergleich, die gefundenen Modelle kann man dann mit den Beispielbildern des Falschenetiketts beim DPReview (oben verlinkt) vergleichen. --Hans Haase (有问题吗) 17:44, 10. Jan. 2016 (CET)
Das Ultimative zurzeit soll ja die Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV sein mit einem 1 Zoll Exmor RS CMOS Sensor (keine Ahnung) (1000 Euro) (Beispielbilder). Daneben gibt es deren Vorgängermodell die Sony Cyber-shot DSC-RX100 III (Beispielbilder), die dem Nachfolgemodell fotografisch eigentlich nicht nachstehen soll (wohl so 650 Euro), ebenso die anderen Vorgängermodelle II und I sollen sehr gut sein. Denke ich auf jeden Fall mal einen Blick wert. --87.140.194.4 03:38, 11. Jan. 2016 (CET)
Panieren: durchgegartes Fleisch ohne "schwarze" Panierung?
(Hat ja auch was von Physik und Chemie.) Wenn man die Panierung nicht verbrannt haben möchte, aber sicher sein will, dass das Fleisch durchgegart ist (auch bei Verwendung von Tiefkühlkost), sollte man es dann vorher anbraten und anschließend mit der Panierung durchbraten?--Wikiseidank (Diskussion) 11:35, 10. Jan. 2016 (CET)
- Nein. Die Panierung ist ja nicht nur optisch begründet sondern sie hält auch den Saft im Fleisch. Die Regulierung der Garstufen erfolgt über die Fleischdicke. max 1/2 cm dann ist das Fleisch durch und die Panade nicht verbrannt. Aber nicht vergssen "Schnitzel muss schwimmen" TK im übrigen bitte nicht und wenn, nach Packungsanweisung.--Graf Umarov (Diskussion) 11:53, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn das Fleisch noch nicht gar, die Panierung aber schon angebrannt ist, war die Pfanne zu heiß. Du musst paniertes Fleisch in tiefem Fett, z. B. Butterschmalz, so mittelheiß braten bis es schön goldbraun ist. Dan ist es auch gar. Vorausgesetzt natürlich, es ist kein zu dickes Stück. Rainer Z ... 11:58, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn die Panade schwarz wird, ist das Fett/Öl zu heiss. Meist benutzt man auch zuwenig davon, die Stücke müssen eigentlich darin schwimmen können (Soll heissen das Fleisch sollte nicht auf dem Boden der Pfanne aufliegen). Das überschüssige Fett kriegt man danach weg, in dem man das gegarte Stück kurz auf Kuchenkrepp/-papier legt. --Bobo11 (Diskussion) 12:07, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ja so ist es, das Fett leitet die Wärme besser als Luft und bringt sie durch die
PanadePanierung ins Fleisch. Diese Öko-Fettvermeider und Sparer am falschen Platz predigen immer wenig Öl. Da brennt diePanadePanierung an, ist dennoch voller Öl oder Fett, das das Paniermehl aufgesaugt hat und das Fleisch ist nicht nicht gegart. Ob panierter Camembert, Chicken Nuggets oder andere Hühnerteile bei KFC, alles wird in derPanadePanierung frittiert. In der chinesischen Küche gibt es in an diePanadePanierung angelehnten ähnlichen Teig auch Frittiertes. Da darf das Schnitzel hinterher auch abtropfen, wenn es aus der Pfanne kommt. Die Temperaturschwankungen schluckt die Fritteuse mit der Masse der Fettmenge besser als eine Pfanne. --Hans Haase (有问题吗) 12:18, 10. Jan. 2016 (CET)- Öko-Fettvermeider? Was hat "Fettvermeidung" mit "öko(logischem Anbau)" zu tun? Man kann auch mit viel ökologischem Öl sein Schnitzel aus einer Biolandwirtschaft schwimmen lassen. Mir geht die Diskreditierung ökologischer Lebensweisen langsam ziemlich auf den Sack. 90.184.23.200 14:00, 10. Jan. 2016 (CET)
- Du siehst wo das Fett dennoch hingelangt, ob viel oder zu wenig. Es wird mitgegessen, nur hat es seinen Zweck verfehlt wenn nicht genügend davon benutzt wird. Diese Vermeidungszwänge sind eine deutsche Krankheit, eine Missliebigkeit ohne nachweisbaren gegenwert, wenn bereits nachgewiesen ist, was außer Acrylamid da noch so alles entsteht. Die USA beschäftigen rund die Hälfte der deutschen Wissenschaftler, weil es diese sinnfreien Sparzwänge dort nicht gibt. Wer sie sucht, kann ja irgendwelchen Sekten beitreten. Ein weiteres Beispiel ist Adolf Hitler, der sich aus Prinzip falsch ernäherte und seine der Parkinson-Krankheit gleichenden Symptome des Zitterns der Hände, das auch in der Sprache zu hören war mit hoher Wahrscheinlichkeit erst hervorrief. Hätte er das abgestellt, wäre er vielleicht auf normale Gedanken gekommen. Stattdessen beute er einen Verwaltungswasserkopf zur Vernichtung seiner Sündenböcke auf und folgte damit allenfalls dem Parkinsonschen Gesetz. Wer so spart, spart zuerst am Verstand, dann am Wissen und gewinnt damit allenfalls den Darwin Award. Der Geisteskranke aus Braunau nahm noch Millionen seiner Spezies mit in den Tod. Das angebrannte Essen ist kein Garant alt zu werden, aber nicht ausreichend sicher, die Rentenkasse zu entlasten. Spare am richtigen Platz, und du kommst persönlich viel weiter. Unser Duales Ausbildungssystem reduziert sich grade wieder auf auf die Produktion von Pappenheimern. Es erfindet neue Einwegsqualifikationen, die den Auszubildenden nicht bis zur Rente reicht. Das Handweg klagt über Nachwuchssorgen, die Ansprüche der Schulbildung werden heruntergeschraubt, die Presse vermeidet es, die unangenehme Wahrheit auszusprechen, ohne Studium bist Du kein anständiger Mensch. Die Politik verkündet, das ihr duales Ausbildungssystem weltweit Nachahmung finden würde und redet bei Flüchtlingen von ausgebildeten Fachkräften, während sie bisher der Qualifikation der eigenen Bevölkerung Steine in den Weg legte. Selbst der «Terrorfreund» Gadaffi zahlte den Studierenden das Studium und vergab das Startkapital zur Eröffnung von Betrieben. In Deutschland ist Sozialhilfe mit den Studium unvereinbar. Man beschäftigte sich stattdessen damit, dass Maler und Stukkateure, die bisher ihre Gerüste selbst aufbauten, den neu erfundenen Beruf des Gerüstbauers erlernen mussten. Dasselbe Märchen durften KFZ-Mechaniker anhören, die nun Mechatroniker werden mussten aber von Elektronik keine Ahnung hatten. Den Heizungsbauern, die an der Steuerung modernden Anlagen verzweifelten, genehmigte man dafür das Verlegen von Abwasserleitungen. Arbeitgeber und Politiker lamentierten über den Frachkräftemangel, den sie bis dahin selbst verursacht hatten. Auch ist den Kultusministerien die Gedichtsinterpretation wichtiger als Grundlagenwissen, kaufmännische Allgemeinbildung und Betriebswirtschaft. Danach erzählt man der arbeitenden Bevölkerung, dass sie Verantwortung für ihren Nachwuchs zu übernehmen hätten als ob sie das nicht von selbst tun würden und stellt sie nicht nur auf sich selbst, sondern zockt sie noch ab. Die Abgaben sind da vielseitig und die Steuern absichtlich kompliziert. Die Politik religiös betrachtet: Es grenzt an Gotteslästerung, das von Gott gegebene Hirn nicht richtig einzusetzen. Daher bleibt zusagen: Nicht drüber aufregen, sondern draus lernen und nicht den Binsenweisheiten folgen. --Hans Haase (有问题吗) 17:29, 10. Jan. 2016 (CET)
- Die ökologische Lebensweisen propagierenden Protagonisten sorgen doch selbst für dieses Image, indem sie ab und zu „vorschlagen“ irgendwelche in ihren Augen unökologische Dinge gesetzlich zu regeln und dann nach einem gesellschaftlichen Shitstorm kleinlaut zurückrudern. Wer ist denn auf die Idee gekommen, an einem Tag in der Woche Fleischkonsum zu verbieten? Wer ist denn auf die Idee gekommen, die Strompreise durch Zwangsvermarktung nachhaltiger Energien dauerhaft zu erhöhen? Wer ist denn auf die Idee gekommen, man könne durch Alkoholverkaufsverbote Jugendliche davon abhalten, sich zu betrinken? Wer ist denn auf die Idee gekommen, Fleischkonsum sei böse und propagiert die ideologisch motivierte Irrlehre, eine Ernährung ohne tierische Bestandteile sei nachhaltig, umweltfreundlich und gesund? --Rôtkæppchen₆₈ 14:31, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich bin auch manchmal genervt von missionarischen Ökos. Ein Fleischverbot haben die Grünen aber nie vorgeschlagen, es wurde nur genüsslich so ausgelegt. Hat aber alles eh nichts mit der Frage zu tun. Rainer Z ... 14:56, 10. Jan. 2016 (CET)
- Schon allein der Gedanke, Fleisch- und Gemüsekonsum gesetzlich regeln zu wollen, zeugt vom überbordenden Bevormundungswahn mancher Politiker. --Rôtkæppchen₆₈ 15:11, 10. Jan. 2016 (CET)
- Nunja, wenn man allerdings solche Untersuchungen sieht, die zeigen, dass, wenn alle so weiter Fleisch konsumieren wie sie wollen, wir den Klimawandel nicht abwenden können: http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-014-1197-x und noch besser: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1104-5 Insofern ist wären entsprechende Regelungen keine Bevormundung, sondern eine Abwägung kurzfristige Konsumegoismen der aktuellen Generationen vs. Klimasitation der nachfolgenden Generationen. Zukunftigere Generationen können sich halt noch nicht äussern. Da ist es doch nut begrüssenswert, wenn jemand ihre Stimme für sie erhebt. 90.184.23.200 16:01, 10. Jan. 2016 (CET)
- Öhm, du glaubst ernsthaft, dass es für öffentliche Kantinen und Schulen jetzt keine Vorgaben gibt, was die machen dürfen und sollen? Tatsächlich. -- southpark 16:06, 10. Jan. 2016 (CET)
- Schon allein der Gedanke, Fleisch- und Gemüsekonsum gesetzlich regeln zu wollen, zeugt vom überbordenden Bevormundungswahn mancher Politiker. --Rôtkæppchen₆₈ 15:11, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich bin auch manchmal genervt von missionarischen Ökos. Ein Fleischverbot haben die Grünen aber nie vorgeschlagen, es wurde nur genüsslich so ausgelegt. Hat aber alles eh nichts mit der Frage zu tun. Rainer Z ... 14:56, 10. Jan. 2016 (CET)
- Öko-Fettvermeider? Was hat "Fettvermeidung" mit "öko(logischem Anbau)" zu tun? Man kann auch mit viel ökologischem Öl sein Schnitzel aus einer Biolandwirtschaft schwimmen lassen. Mir geht die Diskreditierung ökologischer Lebensweisen langsam ziemlich auf den Sack. 90.184.23.200 14:00, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ja so ist es, das Fett leitet die Wärme besser als Luft und bringt sie durch die
- Wenn die Panade schwarz wird, ist das Fett/Öl zu heiss. Meist benutzt man auch zuwenig davon, die Stücke müssen eigentlich darin schwimmen können (Soll heissen das Fleisch sollte nicht auf dem Boden der Pfanne aufliegen). Das überschüssige Fett kriegt man danach weg, in dem man das gegarte Stück kurz auf Kuchenkrepp/-papier legt. --Bobo11 (Diskussion) 12:07, 10. Jan. 2016 (CET)
"Panierung"?--Heletz (Diskussion) 14:05, 10. Jan. 2016 (CET) Das heißt doch Panade?
- Ne. Panierung wird knusprig. Panade ist Pampe. Geoz (Diskussion) 14:17, 10. Jan. 2016 (CET)
- Also, ich glaube, die Pampe Panade wird durch Einlegen in heißes Fett knusprig. --Heletz (Diskussion) 14:37, 10. Jan. 2016 (CET)
- Lies die Artikel Panieren und Panade und lass Dich vom Gegenteil überzeugen. --Rôtkæppchen₆₈ 14:41, 10. Jan. 2016 (CET)
- Umgangssprachlich sagen die meisten Panade. Küchensprachlich korrekt ist aber Panierung – der Eindeutigkeit wegen. Rainer Z ... 14:56, 10. Jan. 2016 (CET)
- Die Panierung (Vorgang und Resultat) ist das Ergebnis der Behandlung des Fleisches mit Panade (Mittel) - auch hier. Play It Again, SPAM (Diskussion) 15:22, 10. Jan. 2016 (CET)
- Klar, aber warum findet man im Netz praktisch kein Panademehl, aber sehr wohl Paniermehl? Geoz (Diskussion) 17:38, 10. Jan. 2016 (CET)
- Die Panierung (Vorgang und Resultat) ist das Ergebnis der Behandlung des Fleisches mit Panade (Mittel) - auch hier. Play It Again, SPAM (Diskussion) 15:22, 10. Jan. 2016 (CET)
- Umgangssprachlich sagen die meisten Panade. Küchensprachlich korrekt ist aber Panierung – der Eindeutigkeit wegen. Rainer Z ... 14:56, 10. Jan. 2016 (CET)
- Lies die Artikel Panieren und Panade und lass Dich vom Gegenteil überzeugen. --Rôtkæppchen₆₈ 14:41, 10. Jan. 2016 (CET)
- Also, ich glaube, die Pampe Panade wird durch Einlegen in heißes Fett knusprig. --Heletz (Diskussion) 14:37, 10. Jan. 2016 (CET)
Info: Nicht alles was in Wikipedia steht ist richtig. Dafür war das annerkannte Wissen der Welt historisch schon viel zu oft Humbug. --Graf Umarov (Diskussion) 15:38, 10. Jan. 2016 (CET)
- Selbstverständlich habe ich vorher den Artikel gelesen, daher Panierung. Öko nein, aber fettvermeidend ja. Aber dann geht - wie bei vegetarischer Ernährung - eben keine (vernünftige) Panierung.--Wikiseidank (Diskussion) 16:46, 10. Jan. 2016 (CET)
Bürgermeister von Dülken
Hi! Kriegt jemand raus, wer im Jahre 1936 in Dülken Bürgermeister war und vielleicht auch, von wann bis wann? Danke vielmals, – Doc Taxon • Diskussion • Wiki-MUC • Wikiliebe?! • 14:13, 10. Jan. 2016 (CET)
- Mit zitternden Händen setze ich 5 Millionen Reichsmark auf Ludwig Simon als Bürgermeister von Viersen-Dülken. Play It Again, SPAM (Diskussion) 14:33, 10. Jan. 2016 (CET)
- Könnte aber auch Dr. Gustav Mertens gewesen sein... Play It Again, SPAM (Diskussion) 14:59, 10. Jan. 2016 (CET)
- ... und was machen wir hieraus? Play It Again, SPAM (Diskussion) 15:01, 10. Jan. 2016 (CET)
- Nee, nee, nee! Hier ist Karlheinz Fischer-Fürwentsches bestätigt, also Simon wars. Play It Again, SPAM (Diskussion) 15:05, 10. Jan. 2016 (CET)
- ... und was machen wir hieraus? Play It Again, SPAM (Diskussion) 15:01, 10. Jan. 2016 (CET)
- Könnte aber auch Dr. Gustav Mertens gewesen sein... Play It Again, SPAM (Diskussion) 14:59, 10. Jan. 2016 (CET)
Wissenschaftssprache
Wann haebn deutsche (Natur-)wissenschaftler aufgehört, auf Deutsch zu publizieren bzw. allgemeiner, ab wann wird nur noch auf Englisch publiziert? Gibt es denn heute noch Fälle, wo Originalarbeiten nicht auf Englisch sind?--Antemister (Diskussion) 15:20, 10. Jan. 2016 (CET)
- Artikel Wissenschaftssprache gelesen? --Buchling (Diskussion) 15:26, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ja, aber der beantwortet die Frage ja nicht.--Antemister (Diskussion) 15:31, 10. Jan. 2016 (CET)
- Hier ein paar Zahlen, Argumente und Situationsberichte (der Artikel ist in Deutsch). Play It Again, SPAM (Diskussion) 15:41, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ja, aber der beantwortet die Frage ja nicht.--Antemister (Diskussion) 15:31, 10. Jan. 2016 (CET)
Zumindest bei uns in den Wirtschaftswissenschaften gibt es heute noch Fachzeitschriften auf Deutsch. Seit etwa wohl zehn Jahren nimmt deren Bedeutung aber rapide ab. Ich habe im Hinterkopf, dass Deutsch spätestens mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch Englisch abgelöst wurde. Einstein hat seine Artikel zuvor ja noch auf Deutsch publiziert, was es und heute ermöglicht seine Gedanken in unserer Muttersprache zu lesen. 90.184.23.200 15:55, 10. Jan. 2016 (CET)
- In der Rechtswissenschaft (gehört zugegebenermaßen eher weniger zu den Naturwissenschaften...) gibt es natürlich auch englischsprachige Artikel - aber die beziehen sich meist nicht auf das deutsche Recht. Fachliteratur zur deutschen Rechtswissenschaft ist fast ausschließlich in deutscher Sprache geschrieben. --Snevern 16:30, 10. Jan. 2016 (CET)
- In den Geowissenschaften hat Deutsch seinen Vorrang als wichtigste Sprache seinen Vorrang wohl erst in den 60ern endgültig verloren, mit dem Paradigmenwechsel hin zur Plattentektonik. In der Physik (aber auch in der Psychologie) war aber sicherlich der Exodus der deutschen Wissenschaftler jüdischer Abstammung in der Nazizeit ausschlaggebend. Geoz (Diskussion) 18:33, 10. Jan. 2016 (CET)
- In vielen Geisteswissenschaften seit etwa 20 Jahren schleichend.. --Hachinger62 (Diskussion) 18:51, 10. Jan. 2016 (CET)
- In vielen Wissenschaften schleichend (nicht nur Geistes-w) und auf "seit" kann ich mich nicht festlegen. Aber mit dem Bologna-Prozess erreichte dies wohl schon einen ersten Höhepunkt. Mittlerweile werden viele (von den Amis abgekupferte) Graduate Schools schon auf Englisch gehalten. Mein Filius (Sohn) hat in einer intern. Studiengruppe seine Bachelor-Arbeit bereits freiwillig auf Englisch geschrieben (Theoretische Physik), obwohl die Vorlesungen da noch auf Dt. waren. Bei den Master-Studien und -arbeiten ist Englisch vorgeschrieben (Universität zu Köln)--G-Michel-Hürth (Diskussion) 19:10, 10. Jan. 2016 (CET)
- @Antemister: vielleicht bekommst Du hier eine Antwort auf Deine Frage. --91.89.10.94 23:05, 10. Jan. 2016 (CET)
- In vielen Wissenschaften schleichend (nicht nur Geistes-w) und auf "seit" kann ich mich nicht festlegen. Aber mit dem Bologna-Prozess erreichte dies wohl schon einen ersten Höhepunkt. Mittlerweile werden viele (von den Amis abgekupferte) Graduate Schools schon auf Englisch gehalten. Mein Filius (Sohn) hat in einer intern. Studiengruppe seine Bachelor-Arbeit bereits freiwillig auf Englisch geschrieben (Theoretische Physik), obwohl die Vorlesungen da noch auf Dt. waren. Bei den Master-Studien und -arbeiten ist Englisch vorgeschrieben (Universität zu Köln)--G-Michel-Hürth (Diskussion) 19:10, 10. Jan. 2016 (CET)
- Man kann ja über den Siegeszug des Englischen jammern, aber früher hätte man auf Latein publizieren müssen, um von der Wissenschaftsgemeinde rezipiert zu werden, sicher auch nicht leichter. Grüße Dumbox (Diskussion) 19:20, 10. Jan. 2016 (CET)
- Noch früher war Altgriechisch hip und es soll auch eine Zeitlang Arabisch lingua franca der Wissenschaft gewesen sein, aber weniger in Europa. --Rôtkæppchen₆₈ 22:33, 10. Jan. 2016 (CET)
- Hätte wohl besser die Klammern um (Natur-) weglassen sollen... Es war ja siche rnicht so das ab 1945 nichts mehr auf Deutsch publiziert wurden, sondern das eher allmählich auslief. Aber wann war das. Und klar, Publikationen zu deutschen Themen von deutschen Autoren werden auch in Zukunft meist auf deutsch geschrieben werden.--Antemister (Diskussion) 23:54, 10. Jan. 2016 (CET)
- Das kommt bestimmt auf das Fachgebiet an. In der organischen Chemie war die Wissenschaftssprache lange Zeit Deutsch. Erst als Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie zur englischen Sprache wechselte, wurde in der Chemie Englisch zur Wissenschaftssprache. Im Bereich Steuerrecht ist weltweit die meiste Fachliteratur auf Deutsch, weil das deutsche Steuerrecht das komplizierteste der Welt ist. --Rôtkæppchen₆₈ 01:52, 11. Jan. 2016 (CET)
- Hätte wohl besser die Klammern um (Natur-) weglassen sollen... Es war ja siche rnicht so das ab 1945 nichts mehr auf Deutsch publiziert wurden, sondern das eher allmählich auslief. Aber wann war das. Und klar, Publikationen zu deutschen Themen von deutschen Autoren werden auch in Zukunft meist auf deutsch geschrieben werden.--Antemister (Diskussion) 23:54, 10. Jan. 2016 (CET)
- Noch früher war Altgriechisch hip und es soll auch eine Zeitlang Arabisch lingua franca der Wissenschaft gewesen sein, aber weniger in Europa. --Rôtkæppchen₆₈ 22:33, 10. Jan. 2016 (CET)
- Für die Physik: Archiv der Zeitschrift für Physik A (Kernphysik): http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/218. 1960 noch alles deutsch, 1965 erste Artikel von deutschsprachigen Autoren auf englisch, 1970 etwa halb-halb, 1975 noch einige Artikel auf deutsch (für jedes Jahr eine Ausgabe willkürlich herausgesucht). Die anderen Teile der Zeitschrift für Physik (andere Fachgebiete) sind auch einsehbar. --BlackEyedLion (Diskussion) 10:36, 11. Jan. 2016 (CET)
Was hält son Betonrohr aus?
Hi! Also hier sagt der Onkel, dass es „283,3 Tonnen“ aushält. Das wäre dann ja (IIRC) auf der Erde eine Gewichtskraft von ≈2,8 Mega Newton. Aber: Kurz darauf ist ein Messgerät zu sehen, auf dem „283kN“ steht. Machen die ihre Versuche auf dem Mond mit nem nicht so ganz akkurat kalibrierten Messgerät? Oder hat dem Onkel n bächtig pöser Ingeniör den falschen Text souffliert? Thx. Bye. --Heimschützenzentrum (?) 17:40, 10. Jan. 2016 (CET)
- Der Druck auf dem Prüfstand ist das eine. Eingegraben drüfte das ganz anders aussehen, da der Drück weitergegeben werden kann. Auch Hobbymechaniker machen den Fehler, durch Hohlräume durch zuspannen. --Hans Haase (有问题吗) 17:48, 10. Jan. 2016 (CET)
- Links am Messgerät ist ein festgeklemmtes Kalibrierungspoti zu sehen. Es ist nicht auszuschließen, dass das Gerät nicht auf kN, sonderm auf 10 kN = 1,01972 Mp oder 1 Mp = 9,80665 kN kalibriert ist. --Rôtkæppchen₆₈ 18:02, 10. Jan. 2016 (CET)
- das wär ja ne Überraschung... da hätte man ja wenigstens „kN“ durchstreichen sollen... bei sowas soll schonmal jmd ne Hand verloren haben (ich mein: bei der Manipulation dieser Sicherheitsknöpfe an Stanzen/Pressen...)... --Heimschützenzentrum (?) 18:10, 10. Jan. 2016 (CET)
- Was soll denn daran nicht stimmen? 283 kN ist doch nicht viel. Was irritiert, ist die Tatsache, daß vorher die Produktion bewehrter Rohre gezeigt wird, geprüft wird ein unbewehrtes. Die 283 sind eher etwas knapp, ein Gabelstapler Gesamtmasse 13t (Tragfähigkeit 5t) hat eine zul. statische Achslast von 120kN. Brückenklasse 30/30 hat Achslast 130kN und 60/30 hat 200 kN. Da wäre dieses Rohr nicht mehr zugelassen. --Pölkkyposkisolisti 09:16, 11. Jan. 2016 (CET)
- naja... 283t bringen eben auf der Erde viel mehr als 283kN... oder verstehe ich wieder 'mal was falsch? --Heimschützenzentrum (?) 12:36, 11. Jan. 2016 (CET)
- Achsoooo, der Sprecher. Das ist natürlich falsch. --Pölkkyposkisolisti 15:27, 11. Jan. 2016 (CET)
- ich hab denen schon letztes Jahr ne eMail geschickt, aber die haben nich geantwortet... da dachte ich, dass ich was falsch verstanden haben könnte... aber ist wohl auch egal... ich lass die dann wohl in Ruhe... --Heimschützenzentrum (?) 16:08, 11. Jan. 2016 (CET)
- Es ist durchaus realistisch, daß Betonrohre dieser Dimension 300 Tonnen aushalten, dann aber bewehrt und mit hochfestem Beton, was in dem Video nicht der Fall ist. --Pölkkyposkisolisti 22:17, 12. Jan. 2016 (CET)
- ich hab denen schon letztes Jahr ne eMail geschickt, aber die haben nich geantwortet... da dachte ich, dass ich was falsch verstanden haben könnte... aber ist wohl auch egal... ich lass die dann wohl in Ruhe... --Heimschützenzentrum (?) 16:08, 11. Jan. 2016 (CET)
Nouvelle-Manche
In der fr:wp wird für die Völkerschlacht bei Leipzig ein teilnehmendes „1er régiment de cavalerie Landwehr Nouvelle-Manche“ genannt. Nouvelle-Manche habe ich in solch einem Zusammenhang noch nie gehört. Es handelt sich um ein preußisches Regiment. Kann da jemand etwas mit anfangen? --Centenier (Diskussion) 18:22, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich konnte nix finden mit Suchfunktion im Artikel, also selber suchen UND: Dragoner-Marschregiment
(Régiment des Dragons de Nouvelle Marche) fiel mir als erstes ins Auge. Das dann folgende 1er régiment de cavalerie Landwehr Nouvelle-Manche ist dann ein Tipp oder Lesefehler. Werde ich gleich korrigieren. --G-Michel-Hürth (Diskussion) 18:49, 10. Jan. 2016 (CET)
- Google Books => prussie "Nouvelle-Manche" <=
- Dann ebenso => Neumark "Nouvelle-Manche" <= Auch Neupreußische Heeresorganisation (Landwehr-Kavallerie Neumark...)
- Hilft das ? Play It Again, SPAM (Diskussion) 18:51, 10. Jan. 2016 (CET)
- Ich tippe auf Schreibfehler bei den Franzosen: Nouvelle Marche = Neumark (Brandenburg)--Hinnerk11 (Diskussion) 18:55, 10. Jan. 2016 (CET)
- Bei den meisten zitierten Stellen steht auch bei Eingabe von manche im Text marche. Laut Lexikon gibt manche in diesen Zusammenhängen auch keinen Sinn. --G-Michel-Hürth (Diskussion) 23:04, 10. Jan. 2016 (CET)
- Natürlich - Neumark bzw. „1. Neumärkisches Landwehr-Kavallerieregiment“ wir dumm von mir. Man dankt! -- Centenier (Diskussion) 08:09, 11. Jan. 2016 (CET)
Mathematische Disziplin gesucht
Es geht um Logistik: Gegeben sei ein verdichtetes Siedlungsgebiet (Kleinstadt, Stadtteil einer Großstadt o. ä.), in dem ein Lieferdienst (Post, Zeitungszustellung) die Zustellung organisieren will. Der muß dann genügend viele Zusteller beschäftigen, damit die ihr tägliches Pensum in einer gegebenen Zeit schaffen können. Dazu wird die Region in einzelne Zustellbezirke eingeteilt, die täglich von jeweils einem Zusteller bedient werden sollen.
Und die Frage ist jetzt, welche mathematische Disziplin sich mit dem Problem befaßt, die Zustellbezirke möglichst optimal zuzuschneiden, damit die Zustellung mit minimalem Personaleinsatz gewährleistet werden kann. Was gibt es denn dafür für Lösungsansätze bzw. -methoden?
(Die Randbedingungen kann man sich beliebig und einigermaßen praxisnah überlegen - Stichworte wären z. B. Bewohner bzw. Wohnungen/Briefkästen pro Zustelladresse, Weglänge zwischen einzelnen Adressen, Qualität der Zuwegungen (Pflasterung vs. "Stoppelacker"), Dichte der Wegeverbindungen, Anmarschweg vom Zustellstützpunkt usw.) (nicht signierter Beitrag von 92.228.251.119 (Diskussion) 18:24, 10. Jan. 2016 (CET))
- Mathematische Planungsrechnung (siehe dort "Teilgebiete") Play It Again, SPAM (Diskussion) 18:30, 10. Jan. 2016 (CET)
- Algorithmik von da geht es weiter und spezieller. (Ich nix verstehen) --G-Michel-Hürth (Diskussion) 18:36, 10. Jan. 2016 (CET)
Operations Research. 90.184.23.200 22:09, 10. Jan. 2016 (CET)
THX
Rumprobieren scheint die aussichtsreichere Vorgehensweise zu sein. (Die Sache ist natürlich mitbestimmungspflichtig. Aber der Betriebsrat hat auch keine Ahnung von Operations Research. Und läßt sich also relativ einfach dadurch austricksen, indem man ihm anbietet, er könne gerne einen besseren Vorschlag machen. Kann er eben nicht... (Und falls doch: Auch gut.)) (nicht signierter Beitrag von 92.224.73.76 (Diskussion) 22:33, 10. Jan. 2016 (CET))
Vielleicht hilft dir GraphHopper weiter. --GeorgDerReisende (Diskussion) 22:35, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn Du es schaffst, das aufzuteilende Gebiet auf dem PC mathematisch zu modellieren, kannst Du das Ausprobieren auch in Form einer Monte-Carlo-Simulation zufälliger Partitionierungen des aufzuteilenden Gebiets automatisieren. --Rôtkæppchen₆₈ 23:12, 10. Jan. 2016 (CET)
- Optimierung (Mathematik), wahrscheinlich sogar Lineare Optimierung. --BlackEyedLion (Diskussion) 10:40, 11. Jan. 2016 (CET)
- Modellierung geht eigentlich - ich habe bereits alle Straßen in Abschnitte zwischen Querstraßen oder Kreuzungen seitenweise aufgeteilt und die "Belegungsdichten" (Anzahl der Kunden) für jeden Einzelabschnitt, geographische Koordinaten ließen sich leicht ergänzen. Jetzt müßte ich mir nur noch Gütekriterien überlegen. (nicht signierter Beitrag von 92.224.159.94 (Diskussion) 14:22, 11. Jan. 2016 (CET))
- Wenn English OK ist: graph theory, travelling salesman problem. de:WP Äquivalente bestehen für beide Artikel, wenngleich etwas kürzer. --Cookatoo.ergo.ZooM (Diskussion) 11:29, 11. Jan. 2016 (CET)
- Vielleicht hilft Spionieren: Wie macht die Deutsche Post das denn eigentlich? (Mit Pech: Durch Ausprobieren - die seit Thurn und Taxis existierenden Zustellgebiete wurden nach und nach "gepatched", also graduell verändert, und sind wie das Eisenbahnnetz im Grunde historisch bedingt; das wäre plausibel, weil sich Siedlungsstrukturen meistens nur langsam verändern.)
- Inwiefern sollte GraphHopper von Nutzen sein? Es geht nicht darum, optimale Routen in einem Gebiet zu finden, sondern die Gebietseinteilung selbst. Deshalb ist Travelling salesman auch die falsche Baustelle. (nicht signierter Beitrag von 92.224.159.94 (Diskussion) 14:22, 11. Jan. 2016 (CET))
- War von mir nicht weit genug gedacht. Ich meinte dies hier: Open Door. --GeorgDerReisende (Diskussion) 16:34, 11. Jan. 2016 (CET)
- @92.224.159.94, was Dir zu Deiner Modellierung noch fehlt außer den Gütekriterien ist eine Adjazenzrelation, damit Du Dein Zustellgebiet in zusammenhängende Teilgebiete aufteilst. Du müsstest also zu Deiner Aufteilung in Straßenabschnitte noch eine Liste der Nachbarabschnitte hinzufügen. --Rôtkæppchen₆₈ 18:30, 11. Jan. 2016 (CET)
- Die Bezirksteile müssen nicht zwangsläufig zusammenhängen. Aber wenn sie zu weit voneinander entfernt liegen, dann werden die gesamten Weglängen zu hoch. Eine optimale Aufteilung braucht dennoch nicht aus zusammenhängenden Bezirken zu bestehen, weil dadurch die Weglängen in anderen Bezirken ggf. zunehmen. Beispiel: Eine lange Hauptstraße, zu der jeweils vorne und hinten je zwei Querstraßen, die die Hauptstraße kreuzen. Sinnvoll könnte ggf. eine Einteilung in drei Bezirke sein: Bezirk 1 ist die gesamte Hauptstraße, die anderen beiden sind je zwei Querstraßen vorne und hinten. Die letzten beiden Bezirke hängen nicht zusammen, aber die Wege zwischen den Teilstücken sind kurz. Der lange Weg entlang der Hauptstraße ist unvermeidlich, aber relativ leicht zu bewältigen: der Zusteller fängt an einem Ende auf der Straßenseite an, die mehr Zustelladressen hat, stellt bis zum Ende zu und anschließend die andere Straßenseite in Gegenrichtung. Diese Strecke kann nicht unterboten werden. Anders sieht das auf dem flachen Land aus, wo die Entfernungen zwischen den einzelnen Anwesen sehr hoch sind - mit Pech umfaßt ein Zustellbezirk nur eine Handvoll Adressen und erfordert trotzdem die gesamte Arbeitszeit eines Zustellers. (Ärgerlich für das Unternehmen: Es kann den unvermeidbaren hohenm Mehraufwand dem Auftraggeber normalerweise nicht in Rechnung stellen, weil es Pauschalpreise gibt und das halt durch eine Mischkalkulation aufgefangen werden muß.)
Umlaufgitter

Zählt dieses Bild entgegen der Beschreibung zu den Umlaufgittern? Mit Drängelgitter wird ähnliches gefunden, aber der Artikeltext beschreibt das Umlaufgitter mit „aus U-förmigen Teilen“. Ist da der Weg durch das Gitter oder die Rohrform des Gitters beim Bau gemeint? Der Z-förmige Weg ist ja bereits die wirksame Bremse für Passanten. --Hans Haase (有问题吗) 18:50, 10. Jan. 2016 (CET)
- GoogleBildersuche => Umlaufgitter <= bestätigt es. Play It Again, SPAM (Diskussion) 18:53, 10. Jan. 2016 (CET)
- Was sagt die DIN oder sonstige Richtlinie? --Hans Haase (有问题吗) 19:46, 10. Jan. 2016 (CET)
- Siehe Umlaufgitter#Mindestbreiten, dort verlinkte Artikel und in diesen Artikeln behandelte Werke. --Rôtkæppchen₆₈ 20:06, 10. Jan. 2016 (CET)
- Was sagt die DIN oder sonstige Richtlinie? --Hans Haase (有问题吗) 19:46, 10. Jan. 2016 (CET)
Russisches bekanntes Lied
Ich suche den Name ein russisches bekanntes Lied, aber ich finde es nicht. Vielleicht ihr könnt mir helfen. Teil des Liedes ist am Ende dieser Video zu hören, ab der 1:53:00. Kommt es euch bekannt?
--Leonprimer (Diskussion) 19:50, 10. Jan. 2016 (CET)
- Das ist Moskau (Lied) der deutschen Band Dschinghis Khan. --Komischn (Diskussion) 20:04, 10. Jan. 2016 (CET)
Danke dir. Leonprimer (Diskussion) 20:21, 10. Jan. 2016 (CET)
- Und es ist kein russisches Lied. --j.budissin+/- 20:33, 10. Jan. 2016 (CET)
@Leonprimer Ja am Schluss wird "Moskau" gespielt, aber in der Minute 1:53:00 höre ich Funiculì, Funiculà und If You're Happy and You Know It ... --King Rk (Diskussion) 08:12, 11. Jan. 2016 (CET)
Asylbewerberleistung
Was noch völlig im relevanten Artikel Asylbewerberleistungsgesetz fehlt, ist der Fall, daß das Asylverfahren bereits vor Ablauf der 15-Monats-Frist positiv beschieden wird. Werden dann die Leistungen automatisch von Asylbewerberleistung auf das höhere ALG II umgestellt (um arbeiten zu dürfen, kann ja erst nach 15 Monaten überhaupt erst eine Erlaubnis beantragt werden, die jedoch aufgrund von § 39 AufenthG wegen Vorrangigkeit von Arbeit für deutsche Staatsbürger grundsätzlich abgelehnt werden kann), oder ist die 15-Monats-Frist vorrangig? --79.242.220.27 21:38, 10. Jan. 2016 (CET)
- Mir wäre nicht bekannt dass Asylbewerber 15 Monate lang nicht arbeiten dürfen (es gab mal eine 12-Monats-Grenze, aber die wurde vor ein paar Jahren abgeschafft). Wo hast du das her? -- Liliana • 01:09, 12. Jan. 2016 (CET)
- Hm. Ich lese: „Am 11. November 2014 traten im Asylverfahrensgesetz und in der Beschäftigungsverordnung Rechtsänderungen in Kraft, die den Arbeitsmarktzugang für die Personengruppen deutlich verbessert haben: Zuvor galt für Asylbewerberinnen und -bewerber ein neunmonatiges und für Personen mit einem Duldungsstatus ein einjähriges Arbeitsverbot. Dieses wurde verkürzt auf drei Monate. Auch die Residenzpflicht wurde auf drei Monate gekürzt und stattdessen einer Wohnsitzauflage ersetzt. Zudem wurde die Vorrangprüfung von vier Jahren auf 15 Monate verringert.“ (BAMF: Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen, Stand: Juni 2015) --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 02:47, 12. Jan. 2016 (CET)
Mittels Duplicati verschlüsselte Daten vor Ransomware sicher?
Ich sichere meine Daten mittels Duplicati und einer AES-Verschlüsselung in einer Cloud. Nun stellte ich fest, dass das Passwort in Duplicati gespeichert wird und dies nicht geändert werden kann. Besteht dadurch die Gefahr, dass Ransomware die Daten in der Cloud ebenfalls befallen kann? --46.126.45.1 23:05, 10. Jan. 2016 (CET)
- 1. die Sicherheit von Advanced Encryption Standard beruht wie sooft auf Vermutungen, die man derzeit weder beweisen noch widerlegen kann... 2. hinzukommen diverse Sicherheitslücken/Schwächen... 3. in ner Cloud fügt man zu den normalen Risiken einen ganzen Sack neuer Risiken hinzu... selbst Yahoo!Mail ist/war davor nicht sicher... dafür kann man aber noch seine Daten benutzen, auch wenn einem das Haus ausgeräumt wurde... 4. Passwörter mag ich allgemein nicht, weil man sie vergessen und auch raten kann... --Heimschützenzentrum (?) 23:12, 10. Jan. 2016 (CET)
- Es ist für das Risiko egal, ob deine Daten in der Cloud von dir absichtlich verschlüsselt werden oder nicht - im Zweifel würden die verschlüsselten Daten von der Ransomware halt nochmal verschlüsselt. Es wäre gut, wenn du Backups verschiedenen Alters anlegen könntest (so dass im Zweifel noch etwas von vor dem Befall da ist) und wenn die Ransomware an die alten Backups nicht so einfach rankommt, sie also zum Beispiel nicht automatisch als Laufwerk eingebunden werden. --Eike (Diskussion) 23:16, 10. Jan. 2016 (CET)
Als Laufwerk eingebunden habe ich die Cloud nicht. Ich greife nur mit Duplicati darauf zu. Die Frage ist, ob die Ransomware die Software ebenfalls "bedienen" könnte. Auslesen sollte sie das Passwort m.W. nicht können.[22] 46.126.45.1 23:39, 10. Jan. 2016 (CET)
- Wenn eine Laufwerk als Laufwerk im Zugriff steht, wird es selbstverständlich von der Malware bearbeitet. Etwas anderes ist es, wenn die gesicherten Dateien nicht im Explorer erscheinen und nur über WWW oder eine spezielle Software gemanagt werden können. Inkrementelle Backups haben die Eigenschaft alte Versionen von Dateien aufzubewahren. Auf die noch nicht verschlüsselten gäbe es dann Zugriff. Die Verschlüsselten sind allenfalls exkrementelles Backup. An Deiner Stelle würde ich ein Betriebssystem benutzen und keine Laufzeit für Malware auf dem Computer installieren. --Hans Haase (有问题吗) 00:11, 11. Jan. 2016 (CET)

- Bei deinem letzten Satz verstehe ich Bahnhof. 46.126.45.1 01:24, 11. Jan. 2016 (CET)
- Distrowatch ist eine Übersicht über Betriebssysteme. --Hans Haase (有问题吗) 02:26, 11. Jan. 2016 (CET)
- Erinnert an einen Satz, der vor 15 Jahren oder so mal im Usenet stand: „Als erstes installierst du ein Betriebssystem. Achte aber darauf, wirklich ein Betriebssystem zu installieren und kein Grafikadventure.“ --Kreuzschnabel 08:24, 11. Jan. 2016 (CET)
- das kommt drauf an, wie „schlau“ die Ransomware ist, und wie sehr die Cloud mitmacht... lässt die Cloud denn verändernden Zugriff überhaupt zu? oder nur Lesen+Anhängen? --Heimschützenzentrum (?) 00:24, 11. Jan. 2016 (CET)
- Die Cloud[23] arbeitet mit WebDAV. 46.126.45.1 01:24, 11. Jan. 2016 (CET)
- Damit hätte die Ransomware Vollzugriff auf die Cloud, inklusive Löschen unverschlüsselter Dateien, sofern die Ransomware das WebDAV-Kennwort abgreifen konnte. --Rôtkæppchen₆₈ 01:43, 11. Jan. 2016 (CET)
- Und, wenn sies denn überhaupt ?? 46.126.45.1 23:53, 12. Jan. 2016 (CET)
- Damit hätte die Ransomware Vollzugriff auf die Cloud, inklusive Löschen unverschlüsselter Dateien, sofern die Ransomware das WebDAV-Kennwort abgreifen konnte. --Rôtkæppchen₆₈ 01:43, 11. Jan. 2016 (CET)
- Die Cloud[23] arbeitet mit WebDAV. 46.126.45.1 01:24, 11. Jan. 2016 (CET)
Akutalisierung Firefox
Hallo, ich arbeite unter Vista mit Firefox, derzeit Version 43.0.1 . Angeblich sind Updates verfügbar (entspricht auch dem Stand im Artikel Firefox). Nur: ich komme an diese Updates nicht ran, auch nicht über die Seite [24] - da heißt es "Herzlichen Glückwunsch. Sie verwenden die neueste Firefox-Version." Unter [25] German Windows kann ich auch nur die 43.0.1 laden. Andererseits bekomme ich regelmäßig die Meldung, dass eine neue Version zur Verfügung stünde, die mangels entsprechender Rechte nicht aktualisiert werden könne. O. k. hier im Netz bin ich ohne Adminrechte unterwegs, aber die Situation ist mit einem Adminkonto auch keine andere. Ratlos! Was habe ich übersehen? --91.89.10.94 23:41, 10. Jan. 2016 (CET)
- http://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/43.0.4/win32/de/Firefox%20Setup%2043.0.4.exe Win32 DE Ver. 43.0.4 --Hans Haase (有问题吗) 00:06, 11. Jan. 2016 (CET)
- Mit diesem Link hat es funktioniert. Herzlichen Dank! --91.89.10.94 00:12, 11. Jan. 2016 (CET)
- Bittesehr. Achte aber darauf, dass die kommende Version nun automatisch Updated oder spätestens, wenn Du im Menü→Hilfe→Über Firefox auswählst, den Download beginnt, sonst rate ich zur De- und Neuinstallation nach vorheriger Sicherung des Benutzerprofils. --Hans Haase (有问题吗) 00:17, 11. Jan. 2016 (CET)
11. Januar 2016
Keine Bildvorschau/-galerie in ownCloud
Bei der App zum Zugriff auf ownCloud werden mir bei Android[26] eine Bildervorschau/-galerie angezeigt[27]. Bei iOS[28] kriege ich dies einfach nicht hin. Bin ich einfach zu doof oder ist dies dort tatsächlich nicht vorgesehen? Gibt's vielleicht für iOS eine Alternative mit Vorschaubildern? --46.126.45.1 01:39, 11. Jan. 2016 (MEZ)
Optimale Sonnenfalle berechnen
Hallo, ich würde mir gerne eine Sonnenfalle bauen. Möglichst einfach, natürlich, mit Materialien aus der Umgebung und die Möglichkeiten sehr ausschöpfend. Eigentlich nur zum eigenen Gebrauch, sprich ich möchte möglichst früh im Jahr raus und möglichst spät wieder rein. Nun denke ich, dass es am besten ist eine terrassenförmige nach Süden geöffnete Steinmauer zu errichten. Da stellt sich dann nun die Frage, welche Faktoren gilt es da alles zu beachten um ein optimales Ergebnis zu bekommen. Die Sonne soll also möglichst lange ihre Strahlen dort einbringen können. Also muss der Öffnungswinkel der Steinmauer so groß sein, dass die ersten und die letzten Strahlen des Tages dort reinkommen. Sprich die Mauer wird nicht mal ein Halbkreis, richtig? Was für ein Gefälle für die Steinmauer ist am sinnvollsten? Meinen Überlegungen nach richtet sich der Winkel danach, in welchem Winkel die Sonne zur Erde steht wenn sie senkrecht zum Mauerkreis steht oder? Ist es vielleicht sinnvoller, die Mauer nicht als (Halb)Kreis anzulegen sondern eher als (Halb)Oval? Was muss ich noch beachten? Was für eine Rolle spielt die Materialauswahl? Sandstein? Muschelkalk? Wie behalte ich die Steine möglichst einfach frei von Bewuchs?
Des Weiteren wird empfohlen mit sonnenstrahlenreflektierendem Wasser zu arbeiten, sprich ein Teich vor der Mauer, der die Sonnenstrahlen reflektiert und so zusätzliche Wärme bringt. Wie kann man so etwas möglichst einfach anlegen? Die Tiefe des Wasser dürfte doch keine Rolle spielen oder? Wie kann man die optimale Größe, Lage und Form des Teiches ermitteln?
Über gute Hinweise, Tipps und Ratschläge freue ich mich sehr. --87.140.194.4 03:22, 11. Jan. 2016 (CET)
- Den Sonnenstand für beliebige Orte und Zeiten kannst du dir auf http://heavens-above.com/ berechnen lassen (erst rechts oben den Ort wählen, dann auf „Sonne“ klicken). „Höhe“ ist die Höhe überm Horizont in Grad, also der Winkel der Sonnenstrahlen zur horizontalen Ebene. „Azimut“ ist der Winkel des Sonnenortes zur Nordrichtung (90°: im Osten, 180°: im Süden, usw). --Kreuzschnabel 10:00, 11. Jan. 2016 (CET)
- Vielleicht hilft dir diese Karte auch etwas. Gruss --Nightflyer (Diskussion) 11:32, 11. Jan. 2016 (CET)
- @„in welchem Winkel die Sonne zur Erde steht wenn sie senkrecht zum Mauerkreis steht“. Eine andere als Südausrichtung kommt für den Steinkreis IMHO nicht in Frage, da sonst die Mittagssonne nicht voll genutzt werden kann. Die maximale Höhe der Sonne hängt außer von der Jahreszeit von der geographischen Breite ab. Jeweils zur Tagundnachtgleiche (kalendarischer Frühjahrs- und Herbstanfang) entspricht der maximale Erhebungswinkel (Elevation) der Sonne zur Mittagszeit genau 90° minus geographischer Breite. Die Mittagszeit ist hier nur von der geographischen Länge, nicht aber von der gesetzlichen Uhrzeit abhängig, deshalb steht die Sonne um 12 Uhr MEZ/MESZ (außer in Görlitz zur Winterzeit) nicht exakt im Süden. Die maximale Elevation erreicht die Sonne zur Sommersonnenwende (kalendarischer Sommeranfang) mittags. Dann ist sie 90° plus Neigung der Erdachse (23,44 °) minus geographischer Breite. Analog ist die minimale Elevation zur Mittagszeit zur Wintersonnenwende (kalendarischer Winteranfang). Dann ist die Elevation 90° minus Neigung der Erdachse (23,44 °) minus geographischer Breite. --Rôtkæppchen₆₈ 18:16, 11. Jan. 2016 (CET)
- Ich glaube ja, unter praktischen Gesichtspunkten kommt es bei diesem Plan nicht so genau auf diesen oder jenen Winkel an. Klar, eine südliche Ausrichtung möglichst an einem Südhang wäre optimal. Aber auch ein gutes Absorbtions- und Speichervermögen der Mauer ist wichtig, Windschutz, Trockenheit. Rainer Z ... 23:30, 11. Jan. 2016 (CET)
Was ist eine Slack Pocket?
Schreibe gerade über englische Herrenanzüge, die sich durch die ihre "Slack pocket" mit einem Knopf auszeichnen. Aber was bitte ist das? -- southpark 08:59, 11. Jan. 2016 (CET)
Sicher, dass keine slash pockets gemeint sind? --Proofreader (Diskussion) 09:20, 11. Jan. 2016 (CET)
- Es gibt "slack pockets" (GoogleBooks), das hat aber nichts mit Hosen zu tun.
- GoogleBildersuche => slack(s) pocket button <= zeigt Bilder (a) von slacks, deren Hintertasche (für Brieftasche) mit einem Knopf verschlossen werden kann und (b) diese Idiotentaschen, die sich auf Höhe des Oberschenkels (oder noch weiter unten) befinden (auch mit Knopf).
- Es kommt also auf den weiteren Zusammenhang an. Play It Again, SPAM (Diskussion) 10:49, 11. Jan. 2016 (CET)
Für Kontext Mr. Carey, who serves as co-head cutter (with Dario Carnera) in addition to his role as creative director, is dedicated to the signature Huntsman aesthetic: a one-button slack pocket, strong but natural shoulder line and high-waisted jacket. - ich glaube Taschen auf Höhe des Oberschenkels kann man ausschließen :-) Wobei, um zur Verwirrung beizutragen, sie auch für One-Button Sakkos bekannt sind. -- southpark 17:20, 11. Jan. 2016 (CET)
- Aaaah! Jetzt wirds klar! Da fehlen Kommas.
- a one-button (Komma) slack pocket, strong but natural shoulder line (Komma) and high-waisted jacket. <= Alles (oB, sp, sbnsl, hw) bezieht sich ja NUR AUFS JACKET (wie du vermutetest).
- So sieht Dario Carnera Design aus. Play It Again, SPAM (Diskussion) 17:51, 11. Jan. 2016 (CET)
Bowies' Erkrankung
War bekannt, das David Bowie an Krebs erkrankt war? Mich traf die Nachricht seines Todes völlig unerwartet. Habe ich das verpasst oder wurde es nicht an die Öffentlichkeit getragen? --2003:76:E4C:F1AD:B556:EC5B:2329:49AF 09:05, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wurde es nicht. Holstenbär (Diskussion) 09:16, 11. Jan. 2016 (CET)
- Ich habe auf Google gesucht "David Bowie Krebs/Cancer" und auf Ergebnisse vor dem Todesdatum eingegrenzt ... Habe nix gefunden. --King Rk (Diskussion) 09:22, 11. Jan. 2016 (CET)
- Bowie hat nur ein weiteres shape-shifting durchgeführt - und wie immer, wenn er es gemacht hat, hat es die Leute hinterher völlig überrascht. Und man kann weiter denken und zwischen den Zeilen lesen und sich den Zeitpunkt vergegenwärtigen: Jemand, der sein Leben so kreativ und intensiv geplant und strukturiert hat, ist bestimmt nicht "an Krebs gestorben"... RIP and ride on, Major Tom. Play It Again, SPAM (Diskussion) 11:23, 11. Jan. 2016 (CET)
Dieser Beitrag war ebenso überflüssig wie geschmacklos. --Snevern 11:55, 11. Jan. 2016 (CET)- Ich bin auch noch bestürzt, deshalb gehe ich nur indirekt (thematisch) auf das Missverständnis ein. Etwas zu "rationalisieren" hilft dem Verständnis.
- Es wurde oben bestätigt, dass seine Erkrankung nicht vorher bekannt gemacht wurde.
- Warum war das so? (Das sollte mein Beitrag erklären).
- Wer meint, dass David Bowie "an Krebs gestorben" ist, versteht den Künstler Bowie nicht (das wäre so, als würde man sagen, dass Michelangelo Blähungen gehabt hätte...)
- Der Künstler Bowie hat jede Phase seines Lebens inszeniert, so wie vielleicht keiner vor ihm. Und wie er
sein Lebenseine Leben (Plural) und seine Kunst inszeniert hat, so hat er auch seinen Tod als Kunstwerk inszeniert. Jetzt bitte nicht nochmal aufregen! Sein in der Produktion vertrautester "Mitarbeiter" Tony Visconti (Space Oddity bis Blackstar) schrieb dazu: "He always did what he wanted to do. And he wanted to do it his way and he wanted to do it the best way. His death was no different from his life - a work of Art. He made Blackstar for us, his parting gift. I knew for a year this was the way it would be. ... For now, it is appropriate to cry." - Eine Krankheit, wie die derzeit diskutierte, hat keinen Platz in Bowies letztem Werk - und sie ist irrelevant (deshalb hat niemand davon erfahren). Sie hätte die Harmonie und den Rhythmus für das (vorläufige) Ende gestört.
- So, nun werden wir uns alle heute abend mit einem oder mehreren Gläsern Rotwein hinsetzen, werden Blackstar hören und auf die Texte achten. Und wenn wir dann im Bowie-Flow sind, lassen wir Major Tom noch einmal durch die Tür ins Ungewisse gehen und wenn wir danach in den Himmel schauen, werden wir feststellen, dass die Sterne heute very different aussehen. Play It Again, SPAM (Diskussion) 16:00, 11. Jan. 2016 (CET)
- Also ich hatte eher Die Reise ins Labyrinth vor. --192.91.60.10 16:32, 11. Jan. 2016 (CET)
- Der Musikexpress-Redakteur Stephan Rehm kommt zu einer ähnlichen Sicht wie der Graue: „Im Fall seines Todes kann man das ja nicht schöner ablesen. Also dass sein Tod ja offensichtlich, also vermutlich zumindest, stark inszeniert war. Dass das alles genau abgestimmt war, so, vor drei Tagen wird noch ein Video veröffentlicht, sein letztes Video, das zu Lebzeiten herauskam, Lazarus, also zur aktuellen Single, in der er seinen Tod inszeniert (...) Und das war sein letzter Gruß. Deswegen kann man die Privatperson, die ja gestorben ist, von der Kunstfigur garnicht trennen, weil sogar sein eigener Tod, also das ureigenste, was man im Leben noch hat, auch das mit seiner Kunstfigur so verknüpft war, dass er das immernoch zur Kunst gemacht hat, wie vielleicht nur Freddy Mercury bisher. Die Zeichen waren alle da, so, das ganze Album ist Schritt für Schritt ein Abschied. (...) Auch die Single Black Star, da wurde ja auch diskutiert, was ist denn dieser Black Star? und jetzt wird immer klarer, das ist wahrscheinlich sein Krebs und das ist alles so sein groß inszenierter Abgang.“ (Zum Tode von David Bowie - Stephan Rehm vom Musikexpress, Deutschlandfunk, Corso, 11. Januar 2016, Audio, 4:30). --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 16:39, 11. Jan. 2016 (CET)
- Also ich hatte eher Die Reise ins Labyrinth vor. --192.91.60.10 16:32, 11. Jan. 2016 (CET)
- Okay, ich nehme meine Bemerkung zurück, SPAM. Es war wohl anders gedacht als ich es verstanden habe. --Snevern 19:43, 11. Jan. 2016 (CET)
- Schon beim letzten Album, (wann war das, ein zwei Jahre her?) wirkte der Gesang und die Stimme Bowies irgendwie zerbrechlich, nicht mehr energiegeladen auch die Texte waren eher nachdenklich. Ich dachte, was ist mit dem los, der ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Mich hat diese Nachricht nicht wirklich überrascht.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 08:11, 12. Jan. 2016 (CET)
- Wenn du das vorgestern geschrieben hättest, wäre ich jetzt beeindruckt. ;) 89.14.13.38 08:40, 12. Jan. 2016 (CET)
- Schon beim letzten Album, (wann war das, ein zwei Jahre her?) wirkte der Gesang und die Stimme Bowies irgendwie zerbrechlich, nicht mehr energiegeladen auch die Texte waren eher nachdenklich. Ich dachte, was ist mit dem los, der ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Mich hat diese Nachricht nicht wirklich überrascht.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 08:11, 12. Jan. 2016 (CET)
- So, nun werden wir uns alle heute abend mit einem oder mehreren Gläsern Rotwein hinsetzen, werden Blackstar hören und auf die Texte achten. Und wenn wir dann im Bowie-Flow sind, lassen wir Major Tom noch einmal durch die Tür ins Ungewisse gehen und wenn wir danach in den Himmel schauen, werden wir feststellen, dass die Sterne heute very different aussehen. Play It Again, SPAM (Diskussion) 16:00, 11. Jan. 2016 (CET)
- Bowie hat nur ein weiteres shape-shifting durchgeführt - und wie immer, wenn er es gemacht hat, hat es die Leute hinterher völlig überrascht. Und man kann weiter denken und zwischen den Zeilen lesen und sich den Zeitpunkt vergegenwärtigen: Jemand, der sein Leben so kreativ und intensiv geplant und strukturiert hat, ist bestimmt nicht "an Krebs gestorben"... RIP and ride on, Major Tom. Play It Again, SPAM (Diskussion) 11:23, 11. Jan. 2016 (CET)
- Ich habe auf Google gesucht "David Bowie Krebs/Cancer" und auf Ergebnisse vor dem Todesdatum eingegrenzt ... Habe nix gefunden. --King Rk (Diskussion) 09:22, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wurde es nicht. Holstenbär (Diskussion) 09:16, 11. Jan. 2016 (CET)
Warum sollte jeman so etwas Intimes wie eine Krebserkrankung an die Öffentlichkeit tragen? Weil es den Boulevard interessiert? --Heletz (Diskussion) 08:44, 12. Jan. 2016 (CET)
- +1. Wahre Größe und Vorbild bis zum Schluss. Messen wir andere an ihm.--Wikiseidank (Diskussion) 21:05, 12. Jan. 2016 (CET)
- ARTE hat kurzfristig das Mittwochsprogramm dreifach bowiefiziert. Play It Again, SPAM (Diskussion) 19:11, 12. Jan. 2016 (CET)
Symbole zur Medienssteuerung
Ich wollte mich mal etwas systematisch mit den Symbolen (Piktogrammen?) zur Mediensteuerung (von Geräten und Software, nicht Mediensteuerung) befassen. Wer hat diese Symbole wann erfunden bzw. vorgeschlagen? Sind diese in einer DIN- oder ISO-Norm festgelegt, und seit wann? Nur zu einigen habe ich zufällig Zeichen gefunden (► ⏪ ⏩ ⏏), vermutlich Unicode-Zeichen. Gibt es da einen kompletten Satz Zeichen? --Ratzer (Diskussion) 11:31, 11. Jan. 2016 (CET)
- Keine Piktogramme, Symbole. Ich erinnere mich an (einige) dieser Zeichen aus den 1960er Jahren, als sie auf tragbaren Tonband-Recordern erschienen und wir die alte Keßler damit in den Wahnsinn getrieben haben... Bezüglich der Anfänge musst du also weit zurückgehen. Später kamen weitere Symbole hinzu. Play It Again, SPAM (Diskussion)
- Solche Teile. Kurze Suche nach solchen Geräten zeigt, dass die Urformen dieser Symbole sogar schon in den 1950ern aufkamen. Play It Again, SPAM (Diskussion) 11:50, 11. Jan. 2016 (CET)

- Danke. Naja, das Gerät rechts (frühe 1960er Jahre) hatte die Symbole noch nicht. Wahrscheinlich muss man unterscheiden zwischen erstem Auftauchen und Zeitpunkt einer Standardisierung und allgemeinen Akzeptanz und weiteren Verbreitung.--Ratzer (Diskussion) 12:01, 11. Jan. 2016 (CET)
- Der Unicodeblock Verschiedene technische Zeichen hat ganz am Ende die gesuchten Symbole als Zeichen. In dem Dokument, mit dem die Aufnahme dieser Zeichen in den Standard vorgeschlagen wurde, müssten sich brauchbare Quellen zur Verwendung dieser Zeichen geben, die Frage ist nur, ob das veröffentlicht wurde, und wenn ja wo. --Schnark 12:03, 11. Jan. 2016 (CET)
- Siehe auch hier --2003:76:E4C:F1AD:B556:EC5B:2329:49AF 12:03, 11. Jan. 2016 (CET)
- Yepp, danke, das spart mir die Suche im Archiv. Ich hatte damals auch noch auf einen Thread von 2011 zum Thema „Kassettenrekorder im Auto“ verwiesen, für den ich auch schon das Web umgegraben hatte. --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 13:37, 11. Jan. 2016 (CET)
- Siehe auch hier --2003:76:E4C:F1AD:B556:EC5B:2329:49AF 12:03, 11. Jan. 2016 (CET)
- Der Unicodeblock Verschiedene technische Zeichen hat ganz am Ende die gesuchten Symbole als Zeichen. In dem Dokument, mit dem die Aufnahme dieser Zeichen in den Standard vorgeschlagen wurde, müssten sich brauchbare Quellen zur Verwendung dieser Zeichen geben, die Frage ist nur, ob das veröffentlicht wurde, und wenn ja wo. --Schnark 12:03, 11. Jan. 2016 (CET)
- Danke. Naja, das Gerät rechts (frühe 1960er Jahre) hatte die Symbole noch nicht. Wahrscheinlich muss man unterscheiden zwischen erstem Auftauchen und Zeitpunkt einer Standardisierung und allgemeinen Akzeptanz und weiteren Verbreitung.--Ratzer (Diskussion) 12:01, 11. Jan. 2016 (CET)
- Die Symbole ⏮ und ⏭ sind imho erst im Kontext mit digitalen Medien entstanden. Sie ergeben ansonsten keinen vernünftigen Sinn. --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 15:33, 11. Jan. 2016 (CET)
- Es gab auch elektromechanische Geräte mit dieser Funktion. --Rôtkæppchen₆₈ 16:30, 11. Jan. 2016 (CET)
- Und wo war da der Unterschied zu Vorlauf und Rücklauf? In meinem Verständnis kommt da "Anfang" und "Ende" erst hinzu, wenn es einen Dateianfang und ein Dateiende gibt, an das man springen kann. Wenn gespult wird, wird gespult. Den einzigen Sinn könnte ich noch erkennen, wenn ein zeitlicher Anlauf unterbrochen und beendet oder neu begonnen wird. Kannst du die fraglichen Geräte präzisieren? --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 16:58, 11. Jan. 2016 (CET)
- Es gab Tonband-, Cassetten- und VHS-geräte, bei denen man einzelne Stücke maschinell suchen lassen konnte. Dazu musste man am Ende eines Stückes einen Knopf drücken, der auf dem Band einen (normalerweise) nicht hörbaren Ton auf dem Band speicherte. Gut, wenn das Band gerade eingelegt war und man wusste, dass das dritte Stück gespielt werden soll. Mitten im Band war das fast nutzlos. Das Band lief dann im Schnelldurchlauf, spielte aber immerhin bei jedem Signal das nächste Stück kurz an. Ich gehe jetzt aber nicht in den Keller, um entsprechende Geräte zu präzisieren. -- Ian Dury Hit me 17:33, 11. Jan. 2016 (CET)
- Bei Sharp gab es auch eine Suche über die Pausen zwischen den Musikstücken, das hieß APSS oder so. Quelle: Der 1980er-Jahre-Ghettoblaster meines Bruders und Google Sharp APSS. Bei Sony wurde eine Art Datenbank am Bandanfang angelegt, die zu Beginn der Wiedergabe eingelesen wurde. Das war dann aber nicht mehr rein elektromechanisch. --Rôtkæppchen₆₈ 18:00, 11. Jan. 2016 (CET)
- Danke für die Antworten. Das Aufkommen solcher Geräte würde also das Zeitfenster markieren, in dem die beiden Symbole zu den anderen (möglicherweise erst) hinzukommen. Läßt sich das vor den 1980er-Jahren grob eingrenzen? --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 19:26, 11. Jan. 2016 (CET)
- Zumindest bei den Sharp-Geräten gab es kein Symbol, sondern es gab mit APSS markierte Tastenkombinationen ⏵+⏪ (> + >>) und ⏵+⏩ (> + <<). Die Bildzeichen ⏮ und ⏭ (|<< und >>|) wurden wahrscheinlich erst mit dem CD-Spieler 1980 eingeführt. Google zufolge gab es Sharp APSS seit 1979. Mein Bruder hat seinen Sharp-Ghettoblaster Anfang der 1980er-Jahre von seinem Lehrlingsgehalt gekauft. --Rôtkæppchen₆₈ 00:37, 12. Jan. 2016 (CET)
- Danke für die Antworten. Das Aufkommen solcher Geräte würde also das Zeitfenster markieren, in dem die beiden Symbole zu den anderen (möglicherweise erst) hinzukommen. Läßt sich das vor den 1980er-Jahren grob eingrenzen? --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 19:26, 11. Jan. 2016 (CET)
- Bei Sharp gab es auch eine Suche über die Pausen zwischen den Musikstücken, das hieß APSS oder so. Quelle: Der 1980er-Jahre-Ghettoblaster meines Bruders und Google Sharp APSS. Bei Sony wurde eine Art Datenbank am Bandanfang angelegt, die zu Beginn der Wiedergabe eingelesen wurde. Das war dann aber nicht mehr rein elektromechanisch. --Rôtkæppchen₆₈ 18:00, 11. Jan. 2016 (CET)
- Es gab Tonband-, Cassetten- und VHS-geräte, bei denen man einzelne Stücke maschinell suchen lassen konnte. Dazu musste man am Ende eines Stückes einen Knopf drücken, der auf dem Band einen (normalerweise) nicht hörbaren Ton auf dem Band speicherte. Gut, wenn das Band gerade eingelegt war und man wusste, dass das dritte Stück gespielt werden soll. Mitten im Band war das fast nutzlos. Das Band lief dann im Schnelldurchlauf, spielte aber immerhin bei jedem Signal das nächste Stück kurz an. Ich gehe jetzt aber nicht in den Keller, um entsprechende Geräte zu präzisieren. -- Ian Dury Hit me 17:33, 11. Jan. 2016 (CET)
- Und wo war da der Unterschied zu Vorlauf und Rücklauf? In meinem Verständnis kommt da "Anfang" und "Ende" erst hinzu, wenn es einen Dateianfang und ein Dateiende gibt, an das man springen kann. Wenn gespult wird, wird gespult. Den einzigen Sinn könnte ich noch erkennen, wenn ein zeitlicher Anlauf unterbrochen und beendet oder neu begonnen wird. Kannst du die fraglichen Geräte präzisieren? --2003:45:463D:AD00:9138:4504:180A:DBE3 16:58, 11. Jan. 2016 (CET)
- Es gab auch elektromechanische Geräte mit dieser Funktion. --Rôtkæppchen₆₈ 16:30, 11. Jan. 2016 (CET)
Danke für alle Wortmeldungen. Frage am Rande. Bei mir wird nur vier der fraglichen Zeichen angezeigt, nämlich ⏩ ⏪ ⏫ ⏬, nicht aber ⏭ ⏮ ⏯ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺, bei letzteren sehe ich nur eine hochkant stehende Box. Daneben habe ich als "Play"-Symbol ► gefunden, das ich so natürlich sehe, aber das müsste doch das gleiche sein als ⏵, das ich nur als Box sehe.--Ratzer (Diskussion) 16:57, 11. Jan. 2016 (CET)
- Geht mir unter Windows auch so. Siehe Wikipedia:Unicode. --Eike (Diskussion) 16:59, 11. Jan. 2016 (CET)
Welches Betriebssystem/welcher Font?--Ratzer (Diskussion) 17:12, 11. Jan. 2016 (CET)
@Ratzer: BS: win10-64bit, FONT: standard-einstellung im aktuellen firefox (je nach situation: times new roman, arial, courier new) --JD {æ} 16:41, 12. Jan. 2016 (CET)
Ich suche ein Zitat ueber die Deutschen und den Verfasser
Google gibt leider nichts her.
Es lautet sinngemäß:
Wenn der Deutsche/die Deutschen die Wahl zwischen Chaos/Unordnung und Faschismus haben, werden sie den Faschismus wählen.
Besten Dank im vorraus --91.141.1.187 12:16, 11. Jan. 2016 (CET)
- Das ist zu speziell.
- Such mal mit: Wenn Menschen vor die Wahl zwischen Diktatur und Chaos gestellt würden, wäre Diktatur oft das kleinere Übel. (Ich stimme dem bei, weil es von einem Briten nachgewiesen wurde). So gesagt von "Joost Hiltermann" («Die Menschen hassen Chaos. Wenn sie zwischen Chaos und Diktatur wählen müssen, dann nehmen sie die Diktatur.»). Vielleicht ist ja durch seinen Nachnamen die Beziehung zum Faschismus entstanden? Kann aber auch schon so - in der generellen Aussage - viel früher (Rom, Griechen) gesagt worden sein. Play It Again, SPAM (Diskussion) 12:41, 11. Jan. 2016 (CET)
Auskunft über der den Autor des W.-Artikels zu Stefan Amzoll
Wer schrieb den Wikipedia-Artikel zu Stefean Amzoll und wann? Danke für die Nachricht und Gruss stefan amzoll
--80.142.238.177 14:31, 11. Jan. 2016 (CET)
- Klicke auf Versionsgeschichte. --Magnus (Diskussion) für Neulinge 14:34, 11. Jan. 2016 (CET)
Nachzulesen in der Versionsgeschichte des betreffenden Artikels ! --Hasselklausi (Diskussion) 14:45, 11. Jan. 2016 (CET)
- Beim Artikel über Stefan Amzoll ist die Versionsgeschichte noch recht kurz und übersichtlich: Ein vermeintlicher Hundeliebhaber hat ihn in dieser Version erstellt, ein Telefonierer ohne Vertragsbindung besserte etwas nach und jemand der am Diskriminator lauscht ergänzte eine Kategorie des Artikels. Zu vorsichtig für die Sichtweise zwischen ost und west ist der Artikel allemal geschrieben, lobenswert ist sie Übernahme des Suchwortes „suspendiert“ für den Text der Referenz, in dem es auch so gefunden wird. --Hans Haase (有问题吗) 15:03, 11. Jan. 2016 (CET)
- Laut dem Beleg im Artikel und laut Wikipedia-Gebrauch wäre der Geburtsort wie bei Anna Dünnebier als Stuhm anzugeben (amtliche Schreibweise zur Zeit der Geburt). --Pp.paul.4 (Diskussion) 15:38, 11. Jan. 2016 (CET)
Daten in Artikel verbessern, ohne Nutzer zu werden
Hallo, ich wohne in Oestrich-Winkel (Oestrich-Winkel) und habe festgestellt, dass bei den dazugehörigen Seiten der einzelnen Ortsteile
teilweise sehr alte Angaben vorhanden sind, was die Einwohnerzahl angeht. Ich habe mich daraufhin an die Stadtverwaltung gewandt und mir die aktuellen Zahlen zum Jahresende 2015 geholt. Ich würde gerne dazu beitragen, dass zukünftig diese neuen Einwohnerzahlen auf den 5 Seiten vorhanden sind. Die Daten liegen mir in einem pdf der Stadt vor. Gruß Markus --2A02:908:DC50:7340:DD96:C71C:6318:BD8E 18:00, 11. Jan. 2016 (CET)
- Hallo Markus, hier steht, wie Du Dich beteiligen kannst. vg -- Gerd (Diskussion) 18:54, 11. Jan. 2016 (CET)
Entlassungen im Rahmen des "Berufsbeamtengesetzes"
Hallo, meine Frage lautet, ob (nichtbeamtete) Ärzte, die 1933 an keiner Universität, sondern an Städtischen Krankenhäusern tätig waren, auch auf Grundlage des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" entlassen werden konnten oder ob es für diesen Fall weitere gesetzliche Regelungen gab. Vielen Dank! --131.188.230.53 18:04, 11. Jan. 2016 (CET) --131.188.230.53 18:04, 11. Jan. 2016 (CET)
- Aus dem Artikel ein erster Hinweis: "Die Bedeutung dieses Gesetzes reichte, soweit es Juden betraf, weit über den öffentlichen Dienst hinaus und diente als Richtmaß für die Ausübung von „Berufen, mit öffentlich-rechtlicher oder öffentlicher Wirksamkeit“ wie Notaren und Patentanwälten."--Wikiseidank (Diskussion) 15:36, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ob Ärzte dazu gehören? Immerhin, die Ausübung des Arztberufes als Privater haben die Nazis den Juden nie verboten - nur eingeschränkt (Juden durften nur Juden behandeln), und auch das erst 1938 (siehe Krankenbehandler).--Alexmagnus Fragen? 23:37, 12. Jan. 2016 (CET)
- Aus dem Artikel ein erster Hinweis: "Die Bedeutung dieses Gesetzes reichte, soweit es Juden betraf, weit über den öffentlichen Dienst hinaus und diente als Richtmaß für die Ausübung von „Berufen, mit öffentlich-rechtlicher oder öffentlicher Wirksamkeit“ wie Notaren und Patentanwälten."--Wikiseidank (Diskussion) 15:36, 12. Jan. 2016 (CET)
Warum wird immer Werbung eingeblendet, von Sachen die ich eh vorher gesucht hab.
Sogar von den gleichen Seiten die ich besucht habe. Was macht das für einen Sinn?--93.218.173.113 18:51, 11. Jan. 2016 (CET)
- Manchmal findet man etwas nicht auf Anhieb, und manchmal will man etwas mehrfach haben (mehr als ein Buch, mehr als ein Video etc.). Wenn jemand über längere Zeit bereit ist, für diese Art Werbung Geld auszugeben, kannst du sicher sein, dass sie sich unter dem Strich rechnet. Und dir fällt sie ja auch auf - das ist schon die halbe Miete. --Snevern 19:40, 11. Jan. 2016 (CET)
- Während Du Dich durch das Internet bewegst, wird im Hintergrund und von dir unbemerkt ein Profil erstellt und analysiert (Webtracking). Dieses wird in der Folge dazu genutzt, um Dich gezielt mit Werbung (sogenannte "personalisierte Werbung") zu versorgen. Diese Profile sollen verhindern, dass Du mit Werbung zu Produkten konfrontiert wirst, die dich nicht interessieren. Wenn das von Dir nicht erwünscht ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu unterdrücken (z. B. bestimmte Browsereinstellungen, Cookies nicht akzeptieren,...). --Blutgretchen (Diskussion) 19:54, 11. Jan. 2016 (CET)
- Google, Amazon und die meisten anderen Suchmaschinen analysieren zu Werbezwecken, was Du suchst und verkaufen diese Daten an Werbetreibende. Möchtest Du das nicht, empfehle ich, z. B. ixquick.de als Suchergebnis zu benutzen.
- Zu den schon genannten Möglichkeiten, Werbung auszuweichen: Die Möglichkeiten variieren, je nachdem, wie sehr Dich Werbung stört und wie weit Du bereit bist, evt. Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Die einfachste Variante wäre, sich einen Werbefilter anzuschaffen. Unter dem Stichwort "Adblocker" eröffnet Dir Deine Suchmaschine ganz neue Welten.
- Werbefilter arbeiten unter anderem mit einer sog. Blacklist. Der Nachteil an dem Konzept, einfach unerwünschte Quellen zu blockieren, besteht natürlich darin, dass nicht alle erkannt werden.
- Eine Alternative wäre, JavaScript abzuschalten. Da die meisten Werbeanzeigen mit JavaScript arbeiten (dynamisches Laden etc.) hast Du einen ziemlich großen Teil ausgesperrt. Dann musst Du aber auch für Dinge wie YouTube JavaScript wieder aktivieren. In Firefox wird diese Verwaltung von Addons wie beispielsweise NoScript erleichtert.
- Der Tor Browser ist auf Anonymität im Netz ausgerichtet. Wenn Du diesen Browser nutzt, wird Dein Internet-Verkehr über zufällig ausgewählte Computer geleitet, um so Deine IP-Adresse und andere Erkennungsmerkmale zu verbergen.
- Eine vierte hypothetische Möglichkeit wäre, einen textbasierten Browser wie Lynx zu verwenden. Bilder o. ä. sind dann allerdings nur noch vergleichsweise umständlich zu betrachten, dafür bist Du extrem schnell unterwegs.
- Um einfach das Anlegen von Benutzerprofilen zu erschweren, kommen noch andere Wege hinzu, wie das regelmäßige Löschen des Browser-Verlaufs (die Liste der Websites, die Du besucht hast), die Verwendung des privaten Modus, die Setzung der "Do not track"-Option, das Wechseln des Browser-"Fingerabdrucks", das strikte Abmelden nach der Benutzung von Facebook, Google etc.
- Letzter Tipp: Schau einfach mal in Deine Browser-Einstellungen und probier die Dir interessant erscheinenden Browser-Addons aus.
- PS: Falls Du auf Reisen mal anonym unterwegs sein möchtest, gibt es noch das Betriebssystem Tails. Es enthält u. a. den Tor Browser und passt auf einen USB-Stick.
- Viel Spaß beim anonymisierten Surfen wünscht Dir
- --217.237.164.210 21:18, 11. Jan. 2016 (CET)
- PPS: Wie kann man innerhalb eines eingerückten Beitrags Zeilen umbrechen und Absätze einfügen? Bei mir wird immer auf die erste Einrück-Ebene zurückgesetzt.
- Nach jedem Umbruch ein neuer Doppelpunkt (oder so viele, wie man halt grad braucht). --Eike (Diskussion) 21:51, 11. Jan. 2016 (CET) ^
- Danke! --217.237.164.210 22:24, 11. Jan. 2016 (CET)
- Nicht nur Cookies, auch Flash-Cookies! --Hans Haase (有问题吗) 23:30, 11. Jan. 2016 (CET)
- Danke! --217.237.164.210 22:24, 11. Jan. 2016 (CET)
- Nach jedem Umbruch ein neuer Doppelpunkt (oder so viele, wie man halt grad braucht). --Eike (Diskussion) 21:51, 11. Jan. 2016 (CET) ^
SMS mit Signal versenden - wie?
Hallo, seit kurzem nutze ich die Signal-App auf meinem Smartphone. Ich habe es so eingestellt, dass auch die SMS darüber empfangen und verschickt werden. Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich jemandem eine SMS schicken kann, der auch die Signal-App nutzt. Die App will natürlich standardmäßig eine Signal-Nachricht schicken, ich würde aber gerne eine SMS senden. Wie geht das? --87.140.193.18 19:42, 11. Jan. 2016 (CET)
- Den Sende-Button gedrückt halten, dann ploppt ein Menü auf. --FGodard|✉|± 20:25, 11. Jan. 2016 (CET)
- Vielen Dank Godard, das war die Lösung. wäre ich wohl nie drauf gekommen. --87.140.193.1 21:20, 11. Jan. 2016 (CET)
Autoradio, Navi und CB-Funk vs. Telefon am Steuer
Telefonieren als Fahrer ist nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt, Radiobedienung und CB-Funk jedoch erlaubt. Bedienung des Navi ist auch erlaubt. Aber es gibt doch keinen Unterschied, ob man ein Telefon oder ein Navi bedient? Auch bei CB und Radio muß man den Blick von der Fahrbahn auf das Gerät wenden und wird abgelenkt. Was ist, wenn man das Telefon als Navi benutzt und es in einer Halterung steckt? Hier hinkt doch irgendwie die Gesetzgebung hinter dem Stand der Technik her, wird das nicht korrigiert? Google ist mittlerweile auch per Sprache bedienbar, wird das auch bestraft? --2003:88:6A65:E737:9972:CDC0:E49F:BE4 20:03, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wer ein Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Autotelefon nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen oder gehalten werden muss. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist (§ 23 StVO). Du darfst ein Handy also nicht in der Hand haben. Insbesonders, wenn es in einer Halterung steckt, darf man es aber benutzen, so wie man ja auch am Radio Knöpfe drücken darf.--Wicket (Diskussion) 21:02, 11. Jan. 2016 (CET)
- Also darf man CB, Landkarte oder Computer mit Navi in der Hand haben, nur kein Telefon? --2003:88:6A65:E737:9972:CDC0:E49F:BE4 22:25, 11. Jan. 2016 (CET)
- Macht es eigentlich rechtlich einen Unterschied ob auf dem Computer Skype installiert ist oder nicht? Bei Mobiltelefonen haben Gerichte mehrfach klargestellt, dass die auch Nichttelefonienutzung, beispielsweise die Bedienung der Navi- oder Musikwiedergabefunktion unter das Mobiltelefonindiehandnehmverbot fällt, sofern das in die Hand genommene Gerät Telefoniefunktion besitzt, auch wenn diese nicht genutzt wird. --Rôtkæppchen₆₈ 01:56, 12. Jan. 2016 (CET)
- Naja, der Gesetzgeber hat bisher nicht alles einzeln reglementiert. Ich habe bislang aber auch noch nie jemanden gesehen, der beim Autofahren einen Computer in der Hand hatte. Habe ich auch noch nie gemacht (und dabei ich bin erfinderisch). Sollte das aber Überhand nehmen, bin ich mir sicher, dass die Legislative da einschreitet. --Wicket (Diskussion) 23:13, 12. Jan. 2016 (CET)
- Macht es eigentlich rechtlich einen Unterschied ob auf dem Computer Skype installiert ist oder nicht? Bei Mobiltelefonen haben Gerichte mehrfach klargestellt, dass die auch Nichttelefonienutzung, beispielsweise die Bedienung der Navi- oder Musikwiedergabefunktion unter das Mobiltelefonindiehandnehmverbot fällt, sofern das in die Hand genommene Gerät Telefoniefunktion besitzt, auch wenn diese nicht genutzt wird. --Rôtkæppchen₆₈ 01:56, 12. Jan. 2016 (CET)
- Also darf man CB, Landkarte oder Computer mit Navi in der Hand haben, nur kein Telefon? --2003:88:6A65:E737:9972:CDC0:E49F:BE4 22:25, 11. Jan. 2016 (CET)
Fehlbuchung
Ich habe soeben eine Flugverbindung gebucht. Einen Augenblick später realisierte ich, dass der Zielort (a) der falsche ist und (b) der andere Zielort von der Fluggesellschaft Ryanair gar nicht angeflogen wird. Was kann ich nun tun? Die Hotline ist gegenwärtig nicht zu erreichen (außerdem eine teure 0900er Nummer), in meiner Not habe ich eine Mail verfasst und abgeschickt, Wortlaut ähnlich wie diesem hier. Noch irgendwelche Tipps? Gibt es Anlass auf Hoffnung, dass man (abgesehen von der Steuer, die man auf Antrag rückerstattet bekommen könnte) den Betrag des Tickets zurückbekommt? --193.175.73.219 21:22, 11. Jan. 2016 (CET)
- 1. schlägt Ryanair nach Eingabe des richtigen Zielortes den falschen als „Ersatz“ vor? wenn ja: dann ist das schon irgendwie auch deren Schuld... 2. Rücktrittsrecht hat man bei sowas wohl nicht, oda? schließlich ändern sich die Preise ja stündlich... glaub ich... --Heimschützenzentrum (?) 21:45, 11. Jan. 2016 (CET)
- Was steht den in den AGBs dazu? --87.148.75.52 21:49, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wenn sie nicht mitmachen wollen sollte man andeuten, dass es viele Fluggesellschaften gibt, und in Zukunft eine bei der Auswahl keine Rolle mehr spielen wird. Gilt natürlich auch für alle deine Freunde und Verwandte.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 23:25, 11. Jan. 2016 (CET)
- Reiner, oder wie die Fluggesellschaft heißt, macht das sicher gerne, aber nur, wenn der Fluggast eine saftige Umbuchungsgebühr abdrückt. In Deutschland kann sich der Fluggast auf sein Rücktrittsrecht per Fernabsatzgesetz bzw Nachfolgeparagraphen §§ 312b bis 312f BGB berufen. In der restlichen EU gibt es durch die Richtlinie 2011/83/EU (Verbraucherrechte-Richtlinie) vergleichbares Recht. --Rôtkæppchen₆₈ 02:01, 12. Jan. 2016 (CET)
- Funktioniert in der Regel nicht. Die Umbuchungsgebühr ist meist teurer als eine neue Buchung. Wenn die Fluggesellschaft jedoch aktuell gerade Probleme auf der Homepage hat und sich die Beschwerden häufen, dann klappts auch bei Ryanair problemlos, hab ich hinter mir. Ich habedoppelt gebucht, weil deren Homepage gesponnen hat. Die Hotline wußte Bescheid und hat unkompliziert geholfen. Hat man selbst nicht aufgepaßt, hat man selbst den Fehler gemacht und dann kann man nur auf Kulanz hoffen. --Pölkkyposkisolisti 22:23, 12. Jan. 2016 (CET)
- Reiner, oder wie die Fluggesellschaft heißt, macht das sicher gerne, aber nur, wenn der Fluggast eine saftige Umbuchungsgebühr abdrückt. In Deutschland kann sich der Fluggast auf sein Rücktrittsrecht per Fernabsatzgesetz bzw Nachfolgeparagraphen §§ 312b bis 312f BGB berufen. In der restlichen EU gibt es durch die Richtlinie 2011/83/EU (Verbraucherrechte-Richtlinie) vergleichbares Recht. --Rôtkæppchen₆₈ 02:01, 12. Jan. 2016 (CET)
- Wenn sie nicht mitmachen wollen sollte man andeuten, dass es viele Fluggesellschaften gibt, und in Zukunft eine bei der Auswahl keine Rolle mehr spielen wird. Gilt natürlich auch für alle deine Freunde und Verwandte.--Giftzwerg 88 (Diskussion) 23:25, 11. Jan. 2016 (CET)
Zeit/Datumsangabe
Was bedeutet die Angabe "FRIDAYS 10/9C" auf dieser Webseite:
http://ilarge.lisimg.com/image/8438360/1024full-traylor-howard.jpg
79.224.213.213 21:44, 11. Jan. 2016 (CET) --79.224.213.213 21:44, 11. Jan. 2016 (CET)
- 10:00 PM Eastern Time / 9:00 PM Central Time --Blutgretchen (Diskussion) 21:47, 11. Jan. 2016 (CET)
- Vielen Dank! 79.224.213.213 22:15, 11. Jan. 2016 (CET)
Schöner Artikel. Es steht aber nicht drin, wie lange eine klassische Massagetherapie auf Rezept überhaupt dauert. Ich habe ein Rezept vom Hausarzt wegen Verspannungen im Rücken und weiß nicht, was normal, üblich oder vorgeschrieben ist. 10, 20, 30 Minuten? --31.17.132.2 21:58, 11. Jan. 2016 (CET)
- Setz diesen Beitrag so, wie er ist, auf die Diskussionsseite des Artikels (oben auf „Abschnitt hinzufügen“ klicken), denn da gehört er hin. Da hast du auch eine realistische Chance, daß die Leute, die am Artikel gearbeitet haben, deine Anregung zu lesen bekommen. --Kreuzschnabel 06:44, 12. Jan. 2016 (CET)
- Wie meist im Leben: Es kommt drauf an: Hier ein paar Zahlen (für die Schweiz).
- Für Freunde der Extrem-Massage: Ich habe Mini-Massagen von 5-10 s (!) gefunden; maximal ist so 90 Min. Play It Again, SPAM (Diskussion) 09:06, 12. Jan. 2016 (CET)
Wermut ab 16? und anderes
Ist das Getränk Wermut ab 16? Laut dem Jugendschutzgesetz sind ja Branntweine und branntweinhaltige Getränke erst ab 18 (§9 JuSchG). Wermut ist laut dem Wikipedia-Artikel ein Wein mit Zusätzen (grob gesagt) und damit gegoren statt destilliert. Allerdings kann der Alkoholgehalt ziemlich hoch werden (bis zu 21,5 %). Daher rührt meine Titelfrage. Und warum wurde nicht gleich ein Höchstprozentwert für nicht unerhebliche Zutaten festgelegt? (Und ja, ich habe die Hinweise zu Rechtsthemen gelesen!) Zweites Thema: Angenommen, in einem Vertrag werden Fehler entdeckt (Rechtschreibfehler, grammatikalische Fehler (Kommasetzung) u. Ä.). Wie sieht es in der Praxis mit stillschweigenden Abänderungen aus? Oder müssen bei wirklich jeder Textänderung alle Vertragspartner ihr Einverständnis signalisieren? Drittes Thema (rein hypothetisch): Mieter A möchte den Telefonanschluss wechseln. Vermietervertreter B ist der Vertrag aber nicht bekannt. Welche Auskunftspflichten hat der Vermieter? Darf ein Wechsel ohne Einverständnis vorgenommen werden? Viertes Thema: Wie funktioniert die Versionsverwaltung bei Gesetzen? Wenn viele Teile entfallen, hat man ja quasi nur noch ein "Gesetzes-Skelett". Viele Hinzufügungen blähen aber bestehende Paragraphen auf (alles unter Annahme der Nummerierungswahrung). Wird ein Gesetz also nur bei Novellen "entschlackt"? Fünftes Thema: Angenommen, in einem Gesetz sind Auflistungen von Kriterien als durchnummerierte Liste ohne Angabe der Konjunktion (Verknüpfung der Punkte mit "und" oder "oder") enthalten. Ist irgendwo festgelegt, welche Konjunktion dann gilt, oder folgt das allgemein akzeptiert und von Gerichten eingefordert aus dem Kontext?
Ich freue mich auf Antworten (bin absoluter Jura-Laie) --217.237.164.210 22:21, 11. Jan. 2016 (CET)
- Meinst du Absinth ? --Bernello (Diskussion) 22:31, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wermut ist in der Regel aufgespritet, also branntweinhaltig, also ab 18. Grüße Dumbox (Diskussion) 22:45, 11. Jan. 2016 (CET)
- zu 2: Es kommt drauf an. Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler werden in der Praxis überhaupt nicht korrigiert. Wenn tatsächlich etwas am Text verändert werden soll, müssen aber tatsächlich alle Vertragspartner mitwirken.
- zu 3: Es kommt drauf an, und zwar hier in erster Linie darauf, wer Vertragspartner ist. Ist der Vermieter Vertragspartner, kann der Mieter ohne dessen Mitwirkung den Telefonanbieter gar nicht wechseln; ist der Mieter dagegen selbst Partei, kann er es; und er weiß spätestens ab der nächsten Abrechnung auch, wer sein Vertragspartner ist.
- zu 4: Umnummerierungen sind eher selten - wenn ein Paragraph mal mit einem Inhalt "belegt" war und frei geworden ist, wird er manchmal mit neuem Inhalt gefüllt. Ansonsten aber gibt es manchmal riesige Lücken (man betrachte zum Beispiel die Reichsversicherungsordnung, die bis auf ein paar Reste komplett außer Kraft getreten ist - der Text besteht überwiegend aus Überschriften), während andernorts ganze Abschnitte eingefügt werden, die dann "Zwischen-Paragraphen-Nummern" mit Buchstaben kriegen (Beispiel Reisevertragsrecht im BGB, § 651a bis § 651 m).
- zu 5: Es ergibt sich aus dem Kontext, ob eine und- oder eine oder-Verknüpfung vorliegt. Wenn es nicht ausdrücklich im Text steht, dann steht meist vor der letzten aufgelisteten Bedingung entweder ein "und" oder ein "oder". Sollte es mal wirklich zu einem missverständlichen Text kommen, wird das damit befasste Gericht den Text auslegen, und dabei wird durchaus auch der Wille des Gesetzgebers erforscht, wie er zum Beispiel in Parlamentsunterlagen zum Ausdruck kommt. --Snevern 23:04, 11. Jan. 2016 (CET)
- Zu 3. ich habe es einmal erlebt, dass der Telefonanbieter eines ganzen Wohn- und Geschäftsviertel durch Kommunalsatzung festgelegt wurde. Als der ausgewählte Dienstleister durch nachhaltige Schlechtleistung glänzte, durften die betroffenen Kunden den Anbieter nicht wechseln, was die Attraktvität des Wohn- und Geschäftsviertels deutlich beeinträchtigte. --Rôtkæppchen₆₈ 23:13, 11. Jan. 2016 (CET)
- Spannender Fall. Wann und wo war das? --Snevern 23:15, 11. Jan. 2016 (CET)
- Flugfeld (Stadtteil). --Rôtkæppchen₆₈ 23:18, 11. Jan. 2016 (CET)
- Für mich schwer nachvollziehbar, wie sie so etwas rechtswirksam hingekriegt haben. Wenn es noch vor der Liberalisierung des Telefonmarktes war, wäre es gar nicht nötig gewesen, und danach nicht ohne weiteres möglich.
- Vielleicht lief es so, wie es manchmal bei Wohnungseigentumsgemeinschaften läuft: Der Eigentümer schließt langfristige Verträge und teilt sein Haus erst danach in Eigentumswohnungen auf. --Snevern 23:28, 11. Jan. 2016 (CET)
- Ein kommunales Versorgungsunternehmen, das bis dahin nur mit Gas, Strom und Fernwärme versorgt hat, durfte das neu zu bauende Wohn- und Geschäftsviertel mit einem Glasfasernetz vernetzen und über dieses Netz Telefon, Internet und Kabelfernsehen anbieten. Als Konsequenz gab es keine ISDN-Anschlüsse, weil die vom Wasserwerk eingekauften Netzabschlussgeräte nur max. zwei Analogtelefone, Ethernet und Kabelfernsehen konnten. Bisherige ISDN-Kunden mussten zwangsweise auf Analogtelefon umstellen und alle MSNs bis auf zwei aufgeben, die zudem auf verschiedenen Telefonen auflaufen mussten. Das Glasfaserinternet hatte zwar nominell 50 Mb/s, war aber tatsächlich vollkommen überlastet, sodass die tatsächlich erreichbare Datenrate von Moment zu Moment stark schwankte. Viele Kunden dieses Wasserwerks versuchten deswegen, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Es stellte sich heraus, dass das nicht möglich war, denn es gab keine Kupferverkabelung und Entbündelung war bei diesem Glasfaserwasserwerksanschluss nicht möglich. Der Rosa Riese hätte auch keine Genehmigung zur Verlegung eigener Kabel bekommen. Einige Gewerbekunden sind dann zu teurem Satelliten- oder LTE-Internet gewechselt. --Rôtkæppchen₆₈ 23:52, 11. Jan. 2016 (CET)
- Böblingen und Sindelfingen sind Stadtteile von Schilda, oder? --Snevern 07:34, 12. Jan. 2016 (CET)
- Jepp. aber nicht das komplette Stadtgebiet. In anderes Stadtteilen gibt es Glasfaserinternet von Telekom oder Unitymedia mit 100 oder 200 Mb/s ohne Aussetzer. --Rôtkæppchen₆₈ 07:53, 12. Jan. 2016 (CET)
- Böblingen und Sindelfingen sind Stadtteile von Schilda, oder? --Snevern 07:34, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ein kommunales Versorgungsunternehmen, das bis dahin nur mit Gas, Strom und Fernwärme versorgt hat, durfte das neu zu bauende Wohn- und Geschäftsviertel mit einem Glasfasernetz vernetzen und über dieses Netz Telefon, Internet und Kabelfernsehen anbieten. Als Konsequenz gab es keine ISDN-Anschlüsse, weil die vom Wasserwerk eingekauften Netzabschlussgeräte nur max. zwei Analogtelefone, Ethernet und Kabelfernsehen konnten. Bisherige ISDN-Kunden mussten zwangsweise auf Analogtelefon umstellen und alle MSNs bis auf zwei aufgeben, die zudem auf verschiedenen Telefonen auflaufen mussten. Das Glasfaserinternet hatte zwar nominell 50 Mb/s, war aber tatsächlich vollkommen überlastet, sodass die tatsächlich erreichbare Datenrate von Moment zu Moment stark schwankte. Viele Kunden dieses Wasserwerks versuchten deswegen, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Es stellte sich heraus, dass das nicht möglich war, denn es gab keine Kupferverkabelung und Entbündelung war bei diesem Glasfaserwasserwerksanschluss nicht möglich. Der Rosa Riese hätte auch keine Genehmigung zur Verlegung eigener Kabel bekommen. Einige Gewerbekunden sind dann zu teurem Satelliten- oder LTE-Internet gewechselt. --Rôtkæppchen₆₈ 23:52, 11. Jan. 2016 (CET)
- Flugfeld (Stadtteil). --Rôtkæppchen₆₈ 23:18, 11. Jan. 2016 (CET)
- Spannender Fall. Wann und wo war das? --Snevern 23:15, 11. Jan. 2016 (CET)
- Zu 3. ich habe es einmal erlebt, dass der Telefonanbieter eines ganzen Wohn- und Geschäftsviertel durch Kommunalsatzung festgelegt wurde. Als der ausgewählte Dienstleister durch nachhaltige Schlechtleistung glänzte, durften die betroffenen Kunden den Anbieter nicht wechseln, was die Attraktvität des Wohn- und Geschäftsviertels deutlich beeinträchtigte. --Rôtkæppchen₆₈ 23:13, 11. Jan. 2016 (CET)
- ad 1: Wermut iSd. EU-Spirituosenverordnung, der auf der Flasche folglich auch als solcher deklariert ist, darf tatsächlich erst ab 18 abgegeben werden, da stets Branntwein enthalten ist. Interessanterweise trifft das auf einige sehr bekannte Wermut-Marken aber gar nicht mehr zu. So werden beispielsweise "Martini" und "Cinzano" seit einiger Zeit nicht mehr aufgespritet (und sind folglich kein Wermut mehr im Sinn der Verordnung), trotz nach wie vor vergleichweise hohen Alkoholgehalts. Als "aromatisiertes weinhaltiges Getränk" dürfen diese, ich nenne sie mal "unechten Wermuts", damit schon ab 16 abgegeben werden. Insofern ist auch §9 JuSchG ein Beispiel für die ziemlich inkosequente und unlogische Gesetzgebung im Alkoholbereich in Deutschland, bei der Wein und Bier grundsätzlich privilegiert werden.--Mangomix 🍸 12:36, 12. Jan. 2016 (CET)
Fourierzerlegung Stromsignal
Sind bei einem verzerrtem Strom alle möglichen Frequenzen vertreten oder nur die Netzfrequenz und Harmonische davon? Oder ist die Fourierzerlegung gar nicht eindeutig, und man wählt nur die Lösung mit der Netzfrequenz und deren Harmonischen, weil es praktisch ist? --89.204.137.126 22:27, 11. Jan. 2016 (CET)
- Wenn man entsprechend lange Abtastzeiträume wählt, kann man auch Frequenzen darstellen, die unter der Netzfrequenz liegen. Mein Universalmessgerät bietet in der Auswahl der Messwerte nur Vielfache (Harmonische) der Netzfrequenz an. --Rôtkæppchen₆₈ 22:45, 11. Jan. 2016 (CET)
- Treten solche Frequenzen denn tatsächlich auf?--89.204.137.126 23:11, 11. Jan. 2016 (CET)
- Diese Frequenzen treten auch auf, beispielsweise bei Elektrogeräten, die periodisch ein- und ausgeschaltet werden (Mikrowellenherd). Sie machen sich durch entsprechend periodisch schwankende Messwerte bei Grundfrequenz oder Gleichanteil bemerkbar. --Rôtkæppchen₆₈ 23:17, 11. Jan. 2016 (CET)
- Danke. Das mit dem Gleichanteil leuchtet mir ein. Demnach müsste es aber auch möglich sein, z.b. bei einer Netzfrequenz von 50 Hz (durch ensprechend getaktetes Schalten) "krumme" Frequenzen wie etwa 75 Hz zu erzeugen. Wenn man anschließend eine Fourieranalyse des Stroms macht und einer einer Frequenz der Grundschwingung von 50 Hz ausgeht, werden diese krummen Frequenzen doch gar nicht eingerechnet. Das ist doch dann nicht korrekt, richtig?
- Und noch eine Frage: Kann es sein, dass die Stromanteile mit dieser Frequenz keinen Wirkanteil haben, nicht nicht gleichfrequent zur Netzspannung sind (dabei sei unterstellt, dass die Netzspannung annähernd sinusförmig ist).--89.204.137.126 23:36, 11. Jan. 2016 (CET)
- Nein, Wirkanteil setzt nur voraus, dass |Stromzeiger*Spannungszeiger| != 0. Da ist immer ein Wirkanteil, sobald der Winkel zwischen beiden nicht 90° ist. Bei gepulstem, phasenrichtigem Strom ist der Winkel immer 0°. -- Janka (Diskussion) 00:43, 12. Jan. 2016 (CET)
- Diese Frequenzen treten auch auf, beispielsweise bei Elektrogeräten, die periodisch ein- und ausgeschaltet werden (Mikrowellenherd). Sie machen sich durch entsprechend periodisch schwankende Messwerte bei Grundfrequenz oder Gleichanteil bemerkbar. --Rôtkæppchen₆₈ 23:17, 11. Jan. 2016 (CET)
- Treten solche Frequenzen denn tatsächlich auf?--89.204.137.126 23:11, 11. Jan. 2016 (CET)
- 1. die Fourierreihe von dem Signal kriegt man sowieso nie raus... man rechnet ja nur numerisch mit irgendwelchen Schätzwerten zu irgendwelchen geschätzten Zeitpunkten (Heisenbergsche Unschärferelation... oda?)... 2. und wie das Gezappel entsteht, weiß man ja nie... es könnte ja sein, dass da n DAC drin ist, der genau dieses Gezappel ausgibt... *kicher* --Heimschützenzentrum (?) 23:40, 11. Jan. 2016 (CET)
- Hä? Quantenphysikalische Betrachtung von Wechselgrößen? Eine Fourierzerlegung ist eine rein mathematische Sache, wie bringst du Heisenberg da rein? Das wär ’ne neue Idee für Matheprüfungen: „Ich konnte x nicht exakt berechnen, wegen der Heisenbergschen Unschärferelation …“ --Kreuzschnabel 06:51, 12. Jan. 2016 (CET)
- kann man den Strom und Spannung und die jeweiligen Zeitpunkte genau bestimmen? nö, oda? woher kommt denn diese Art „Unschärfe“? da fiel mir nur der Heisenberg ein... --Heimschützenzentrum (?) 08:16, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ja, das ist schon richtig, bei jeder Fourier-Transformation gilt eine Unschärferelation. Ich wundere mich etwas, dass in Fourier-Transformation gar nichts dazu steht, darum hier: en:Fourier transform#Uncertainty principle. Ort und Impuls in der Quantenmechanik sind ja ein spezielles Fourier-Transformationspaar. -- HilberTraum (d, m) 08:26, 12. Jan. 2016 (CET)
- Unschärfe in der Messung der Frequenz des elektrischen Stroms (zum Beispiel mit Zungenfrequenzmessern): Resonanz#Halbwertsbreite und Gütefaktor. --BlackEyedLion (Diskussion) 09:50, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ja, das ist schon richtig, bei jeder Fourier-Transformation gilt eine Unschärferelation. Ich wundere mich etwas, dass in Fourier-Transformation gar nichts dazu steht, darum hier: en:Fourier transform#Uncertainty principle. Ort und Impuls in der Quantenmechanik sind ja ein spezielles Fourier-Transformationspaar. -- HilberTraum (d, m) 08:26, 12. Jan. 2016 (CET)
- Warum sollten in der Netzspannung nicht beliebige Frequenzen auftreten können. Beispielsweise kann hochfrequente Strahlung eingefangen werden (ich habe hier Schwingungen von mehreren hundert kHz in einer Leitung). Oder der Energieversorger selbst sendet eine zusätzliche Frequenz: Signal für den Beginn des Niedertarifs. --BlackEyedLion (Diskussion) 09:50, 12. Jan. 2016 (CET)
- Hier muss zwischen Strom und Spannung unterschieden werden. Der Energieversorger überlagert seine hochfrequenten Rundsteuerimpulse der Netzspannung (und stört dabei ADSL-Anschlüsse in der Nachbarschaft). Manche Verbraucher entnehmen einen nichtsinusförmigen Strom mit Oberwellenanteilen, beispielweise Dimmer, einfache Schaltnetzteile, defekte Leuchtstofflampen mit Quecksilberdampfgleichrichtereffekt, Hausgeräte mit Kleinleistungsstufe per Einweggleichrichtung. Diese Oberwellen sind Vielfache der Netzfrequenz. --Rôtkæppchen₆₈ 17:29, 12. Jan. 2016 (CET)
12. Januar 2016
Warum muß man sich in schnellfahrenden Zügen nicht anschnallen, jedenfalls in Deutschland?
Z.B. sind ICE-Züge oft 200 km/h schnell und bei einem Unfall würden die Passagiere "herumpurzeln". --77.4.193.88 00:19, 12. Jan. 2016 (CET)
- Kommt wohl weniger auf die Geschwindigkeit an (zumindest ab einer deutlich niedrigeren macht es nicht mehr so einen Unterschied) als auf die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen. --Chricho ¹ ³ 00:29, 12. Jan. 2016 (CET)
- (BK)Gegenüber dem Straßenverkehr ist die Unfallwahrscheinlichkeit vernachlässigbar. Im Flugverkehr herrscht nur bei Start und Landung und wenn der Flugzeugführer es sonst für notwendig erachtet Anschnallpflicht. Im Omnibus-Nahverkehr wirkt sich eine Anschnallpflicht negativ auf die Fahrgastwechselzeiten aus. Deswegen gibt es dort keine Anschnallpflicht. Die Fahrzeuge sind als Ausgleich dafür teilweise mit Prallpolstern versehen und außerdem gibt es während der Fahrt ein Aufenthaltsverbot vor der vorderen Schranke, um bei Gefahrenbremsung oder Frontaufprall die Verletzungsgefahr durch eine berstende Windschutzscheibe zu vermindern. --Rôtkæppchen₆₈ 00:29, 12. Jan. 2016 (CET)
- Und wenn der Zug jetzt plötzlich mal einem Reh ausweichen muss und deswegen gegen einen Baum prallt? --2003:76:E4C:F1AD:818:7962:1AE2:4287 00:57, 12. Jan. 2016 (CET)
- Rehen darf in Deutschland nicht ausgewichen werden. Tut der Fahrzeugfahrer es dennoch und verursacht dabei einen über den Wildunfall hinausgehenden Verkehrsunfall, ist es sein eigenes Verschulden, siehe Wildunfall#Schadenabwicklung. --Rôtkæppchen₆₈ 01:22, 12. Jan. 2016 (CET)
- Du hast den Witz verpaßt. „Und wenn der Zug …“ --Kreuzschnabel 06:53, 12. Jan. 2016 (CET)
- Nö, du hast den Witz seiner Erwiderung verpasst... --Jossi (Diskussion) 16:38, 12. Jan. 2016 (CET)
- Du hast den Witz verpaßt. „Und wenn der Zug …“ --Kreuzschnabel 06:53, 12. Jan. 2016 (CET)
- Rehen darf in Deutschland nicht ausgewichen werden. Tut der Fahrzeugfahrer es dennoch und verursacht dabei einen über den Wildunfall hinausgehenden Verkehrsunfall, ist es sein eigenes Verschulden, siehe Wildunfall#Schadenabwicklung. --Rôtkæppchen₆₈ 01:22, 12. Jan. 2016 (CET)
- Und wenn der Zug jetzt plötzlich mal einem Reh ausweichen muss und deswegen gegen einen Baum prallt? --2003:76:E4C:F1AD:818:7962:1AE2:4287 00:57, 12. Jan. 2016 (CET)
- Man muss sich in schnellfahrenden Zügen nicht anschnallen, weil ganz einfach keine Anschnallgurte vorhanden sind. --Ledderhoes (Diskussion) 01:30, 12. Jan. 2016 (CET)
- Das sehe ich nicht so. Wären sie vorgeschrieben, so müssten die Eisenbahnverkehrsunternehmen für Sicherheitsgurte sorgen. Bei PKW und Fernbussen war es ähnlich. Die wurden auch erst mit Sicherheitsgurten ausgestattet, nachdem es Pflicht war. Zuvor waren bei einigen PKW- und Fernbusherstellern Sicherheitsgurte nur als aufpreispflichtige Sonderausstattung zu haben. Bei einigen PKW musste sogar zuerst die Karosserie- und Sitzkonstruktion verstärkt werden, um überhaupt Sicherheitsgurte anbieten zu können. --Rôtkæppchen₆₈ 01:40, 12. Jan. 2016 (CET)
- Im Flugzeug sind nur Gurte wegen Luftlöchern und für unsanfte Landungen oder Problemen beim Start vorhanden. Was Bruchlandungen angeht, so sind im Flugzeug die Sitze auf einem verformbaren Gestell aufgebaut. Die dabei auftretende Verzögerung lässt einen PKW so aussehen, als wäre die Schrottpresse gelaufen. ZU den Crashtests von Zügen gibt es einen interessanten Fünfteiler auf YouTube. Die Zugsicherung soll dabei das wesentliche tun. --Hans Haase (有问题吗) 01:55, 12. Jan. 2016 (CET)
- Och bitte – können wir nicht wenigstens hier bei WP den Unsinn mit den Luftlöchern außen vor lassen? In der Luft sind keine Löcher. --Kreuzschnabel 06:55, 12. Jan. 2016 (CET)
- Stelle am besten schon mal LA auf Luftloch. --Rôtkæppchen₆₈ 07:14, 12. Jan. 2016 (CET)
- Da steht ja, daß es Unsinn ist, das rettet den Artikel knapp :-) --Kreuzschnabel 09:15, 12. Jan. 2016 (CET)
- Stelle am besten schon mal LA auf Luftloch. --Rôtkæppchen₆₈ 07:14, 12. Jan. 2016 (CET)
- Och bitte – können wir nicht wenigstens hier bei WP den Unsinn mit den Luftlöchern außen vor lassen? In der Luft sind keine Löcher. --Kreuzschnabel 06:55, 12. Jan. 2016 (CET)
"Herumpurzeln" hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit Verzögerung. Und die ist nicht bei hohen Geschwindigkeiten am größten, sondern bei niedrigen. Der häufigste Fall, bei denen man sich bei der Zugreise durch das Bremsen verletzen kann ist, ganz ohne Unfall, das Stehen ohne sich festzuhalten kurz bevor der Zug stoppt. Da ist die Verzögerung nämlich höher als während der ganzen Bremsung zuvor. Wenn ein Zug gegen eine Wand, Brückenpfeiler oder sonstwas fährt, ist die Geschwindigkeit auch ziemlich wumpe. Oberhalb von 30km/h sind die Passagiere so oder so platt, weil der hintere Waggon nachschiebt. -- Janka (Diskussion)
- Zug Auto vergleich ist jetzt wirklich Birnen mit Äpfel verglichen. Die typische Unfälle, bei denen im Auto Sicherheitsgurte was bringen, gibt es bei der Bahn in der Form gar nicht. Denn die Bahn arbeit nach dem Grundsatz der „aktiver Sicherheit“. Und bei spurgebundenen Fahrzugen udn Raumüberwachung, sind passive Sicherheitssystem -zu denen auch der Sicherheitsgurt gehört- dann gar nicht merh gefragt.
- Janka hat da nicht ganz unrecht, auch wenn das 30km/h nicht ganz stimmt, es wären 36 km/h. Die aktuelle Bahn Crash-Norm geht von „Zusammenstoß mit einem stehenden baugleichen Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 36 km/h“ bzw. „Aufprall auf einen stehenden Güterwagen mit einer Masse von 80 t bei einer Geschwindigkeit von 36 km/h“ aus, bei dem das fahrzug nur miniml verformt werden darf, oder so schön umschriben mit „ohne Beeinträchtigung des Überlebensraums von Fahrer und Fahrgästen“.[29] Über dieser Geschwindigkeit von 36 Km/h (Was in etwas dem entspricht womit noch auf Sicht gefahren werden darf) ist es wirklich so, dass da mehr oder weniger egal ist was da im Weg steht. Denn dafür ist das Eisenbahnfahrzeug nicht ausgelegt, und wenn es anfängt die Fahrgastzelle zu zerlegen, nützen Gurte nicht wirklich was. Die bringen nur was, wenn die Fahrgastzelle soweit intakt bleibt, dass ein Überlebesraum vorhanden ist. Dazu kommt wenn die Verzögerung zu gross ist, nützt dir übrigens auch ein Sicherheistgurt nichts, denn dann zerreisst es dich innerlich. Das übrings auch ein Problem, dass man bei gepanzerten Fahrzeugen kennt, ab einer gewissen Sprengladung schafft du es zwar noch, dass Fahrgastzelle noch intakt wäre. Nützr aber weil die Insassen würden trotzdem sterben. Dies schlichtweg weil durch die Explosion eine auf den Körper wirkende Beschleunigung statt findet, die zu gross ist.--Bobo11 (Diskussion) 05:36, 12. Jan. 2016 (CET)
- 36km/h sind es bei Regelfahrzeugen, bei den beliebten Leichttriebwagen ohne Zug-Stoßvorrichtung hat man den Wert der Ersparnis zuliebe auf 25km/h runtergesetzt. Das entspricht grob der halben Aufprallenergie. -- Janka (Diskussion) 08:46, 12. Jan. 2016 (CET)
- Hier ist ein Video das die Vollbremsung einer Lok mit einem PKW vergleicht. Mit Zug dahinter ist der Bremsweg noch mal länger und dadurch durch die Beschleunigungen im Zug geringer. --Mauerquadrant (Diskussion) 09:09, 12. Jan. 2016 (CET)
- Flugzeug am sichersten, Auto am unsichersten. In beiden Anschnallpflicht.
- Bahn irgendwo dazwischen. Keine Anschnallpflicht. Warum?
- Oben schon mal kurz angesprochen: Nicht alle sitzen, ein paar stehen (unkontrollierbar), Gepäck liegt und steht herum (unkontrollierbar). Wäre Riesenaufwand (und Geldverlust). Ergo: Viel Aufwand für "weniger". Play It Again, SPAM (Diskussion) 09:33, 12. Jan. 2016 (CET)
- Im ersten Semester des Ingenieurstudiums hieß es, dass ein Mensch aus eigener Kraft 40 km/h erreichen kann und damit einen ungebremsten Aufprall mit dieser Geschwindigkeit zwar verletzt ist, aber doch überleben kann. Ein weiterer Ingenieur-Grundsatz ist, dass - ob hohes oder niedriges Risiko - ein Unfall nie ausgeschlossen werden kann und Vorkehrungen zur Verletzungsminderung getroffen werden müssen. Da sieht es bei der Bahn mit ihren hohen Geschwindigkeiten tatsächlich mau aus. Offensichtlich hat das praktikable Gründe aus der Bandbreite der Passagiere vom Säugling, Kinder und Jugendliche, bis eben auch Alte und Behinderte. Eine weitere Ablehnungshaltung wird mit dem hohen Vandalismuspotential bei der Bahn begründet. Ich weiß, dass die Airbag-Industrie beim Eisenbahnbundesamt mal vorstellig wurde und mit den Horrorszenarien bei Fußballfan- und Schülertransporten verschreckt/abgewiesen wurde. Ich bin mal im TGV von Brüssel nach Paris mit 300 km/h gedüst und wäre angesichts der zappligen Fahrt auf den Schienen für jede Sicherungsvorrichtung dankbar gewesen, auch wenn das nur einen symbolischen Schutz geboten hätte.--87.162.243.114 10:17, 12. Jan. 2016 (CET)
- Hier ist ein Video das die Vollbremsung einer Lok mit einem PKW vergleicht. Mit Zug dahinter ist der Bremsweg noch mal länger und dadurch durch die Beschleunigungen im Zug geringer. --Mauerquadrant (Diskussion) 09:09, 12. Jan. 2016 (CET)
- 36km/h sind es bei Regelfahrzeugen, bei den beliebten Leichttriebwagen ohne Zug-Stoßvorrichtung hat man den Wert der Ersparnis zuliebe auf 25km/h runtergesetzt. Das entspricht grob der halben Aufprallenergie. -- Janka (Diskussion) 08:46, 12. Jan. 2016 (CET)
Die Negativbeschleunigung von Schienenfahrzeugen ist im Hochgeschwindigkeitsbereich so gering, daß keine Gurte nötig sind. Züge können einfach nicht stark genug bremsen. Das merkt man bei Vollbremsungen im ICE aus 250 km/h, erst kurz vor dem Anhalten wird die Bremskraft stark bemerkbar, da nimmt aber der Lokführer schon Kraft raus, weil das Hindernis längst überrollt ist. Selbst wenn der Zug mit blockierenden Rädern und Sand bremsen würde, sähe das nicht viel anders aus, nur daß dann sehr schnell die Reifen im Innenraum landen würden. Stahl auf Stahl bremst nunmal viel schlechter als Gummi auf Asphalt. Und die Magnetschienenbremse erreicht, so sie vorhanden ist, auch keine Werte von Gummi. Es werden meist nur -0,8 m/sek² erreicht, unter Idealbedingungen -1,2 m/sek². Das bedeutet einen Bremsweg von knapp 500 m aus 120 km/h. Autos erreichen weit über -10 m/sek² aus hohen Geschwindigkeiten. Erst bei Niedriggeschwindigkeiten kann das Schienenfahrzeug mithalten. --Pölkkyposkisolisti 11:56, 12. Jan. 2016 (CET)
- Du warst wohl noch nie in einer Straßenbahn, wenn die eine Vollbremsung macht, da küssen selbst sitzende Jungs die Oma gegenüber.--2003:75:AF47:C900:3186:9FC8:E427:525A 12:15, 12. Jan. 2016 (CET)
- Genau das habe ich geschrieben: Erst bei Niedriggeschwindigkeiten kann das Schienenfahrzeug mithalten. --Pölkkyposkisolisti 12:17, 12. Jan. 2016 (CET)
- Du warst wohl noch nie in einer Straßenbahn, wenn die eine Vollbremsung macht, da küssen selbst sitzende Jungs die Oma gegenüber.--2003:75:AF47:C900:3186:9FC8:E427:525A 12:15, 12. Jan. 2016 (CET)
- Das Bremsen ist IMHO nicht das Problem. Vor jedem Halt stehen aussteigewillige Fahrgäste auf und begeben sich in die Einstiegsräume, wo sie vollkommen ungesichert stehen. Das passiert ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, wo der Zug am stärksten verzögert. Die größere Verletzungsgefahr geht von Kollisionen aus. Aber die sind im Eisenbahnverkehr zum Glück sehr selten. Ich bezweifle außerdem, dass Sicherheitsgurte beispielsweise beim Unfall von Eschede nützlich gewesen wären. --Rôtkæppchen₆₈ 12:08, 12. Jan. 2016 (CET)
- (Einschib) Ja, bei Enschede kann die Frage "wären Sicherheistgurte nützlich gewessen" wirklich mit gutem Gewissen mit NEIN beantwortet werden. Die meisten getöteten wären auch mit Sicherheitsgurten gestorben. Die Wahrscheinlichkiet, dass man denn Unfall mit Sicherheitsgurt überlebt hätte ist gering. Dafür wären Überlebende (ohne Gurt) gestorben, weil der Sicherhitsgurt verhindert hätte, dass sie die Energie über mehre Schritte abgebaut haben, oder das sie durch den Gurt zusätzliche innere Verlezungen davon gezogen hätten (Und deswegen verblutte wären). Im Wagen herumfligen macht zwar AUA, kann aber verhindern, dass die Verzögerung zu gross wird. Ein Knochenbruch an den Armen oder Beinen steigert durchaus die Übelebenchanen bei so einem Unfall. Weil eben daduch paar Zentimeter mehr Abbremsweg zustande kommt. Und das kann das ausschlaggebende sein ob man überlebt oder nicht. Denn wie viele G's (g-Kraft) auf den Körper wirken ist der tödliche Faktor. Der Gurt (oder seine Befestigung) müsste also so konstruiert sein, dass er bei einer gewissen Belastung versagt, weil sonst die Belastungspitze zu gross würde. Und bei Eschede hätte die meisten Gurte versagen müssen.--Bobo11 (Diskussion) 15:23, 12. Jan. 2016 (CET)
- Der OP hat mit seiner Frage einen Zusammenhang mit der Geschwindigkeit festgestellt. Dieser Zusammenhang führt in die Irre, hab ich oben schon ausgeführt. Ein Gurt kann im Auto bereits bei sehr geringen Geschwindigkeiten, z.B. bei einer Vollbremsung aus 10km/h schlimme Verletzungen verhindern, weil der Beifahrer sonst mit dem Gesicht in der Frontscheibe hängen würde. Der Airbag spricht da noch gar nicht an. Bei hohen Geschwindigkeiten verhindert der Gurt hingegen nur noch, dass man aus dem Auto bei dessen Desintegration herausgeschleudert wird und sich dabei ziemlich sicher das Genick bricht. Die Verzögerung wenn man z.B. gegen einen Baum fährt ist mit oder ohne Gurt praktisch identisch. Vielleicht überlebt man es.
- Ich habe im übrigen mal einen ablaufenden Baumunfall beobachten dürfen. Das entgegenkommende Fahrzeug überfuhr zunächst das Rot eines Fussgängerweges und die Fahrerin vergaß auch noch zu lenken und steuerte den Wagen geradewegs gegen einen Alleebaum. Passiert ist ihr dank Airbag nichts, konnte sogar noch aus allein ihrem Wrack aussteigen. Nur schnell irgendwo hinsetzen mussten wir sie, sonst wär sie noch irgendwem vors Auto gelaufen. Das wäre dann ganz großes Pech gewesen. -- Janka (Diskussion) 14:35, 12. Jan. 2016 (CET)
- Janka: Und der Baum? Wie geht es ihm???? 217.9.49.1 15:10, 12. Jan. 2016 (CET)
- Bin zwar nich Janka, aber der überlebt das in der Regel. Wenn der Baum genügend alt und damit dick ist, steht der Gewinner zum vornherein fest. Schau dir mal das Video an. --Bobo11 (Diskussion) 15:26, 12. Jan. 2016 (CET)
- Janka: Und der Baum? Wie geht es ihm???? 217.9.49.1 15:10, 12. Jan. 2016 (CET)
Zum Thema: Frage ist so sinvoll wie die nach dem Airbag und den Sicherheitsgurten: Wie oft erlebt ein Autofahrer einen entsprechenden Aufprall frontal oder direkt von der Seite? Ansonsten lösen die nicht aus. Nebenbei: Beim letzten Neuwagen gabs nichtmal ein Notrad. Nach meiner Frage hierzu: Wie oft haben sie schon eine Reifenpanne erlebt. Ich: Dreimal! Er: nix! Also: kann man so oder so lesen. --80.187.102.108 19:09, 12. Jan. 2016 (CET)
Tanztyp gesucht
Wie heisst nochmal die Tanzform (der Rhythmus- bzw. Tanztyp) im Lied Flotter Dampfer von Bill Ramsey? --77.10.250.69 02:51, 12. Jan. 2016 (CET)
- Wirklich? --77.10.250.69 17:20, 12. Jan. 2016 (CET)
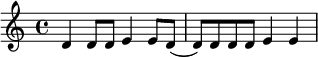
- Das Standardrepertoire der Tanzschulen hat sich wohl irgendwann zwischen 1960 und 1975 geändert. Ich würde mal früher suchen. Foxtrott trifft es mE nicht. Da ist ein der Fuß noch in der Luft, wenn das Schlagzeug spielt. --Hans Haase (有问题吗) 22:55, 12. Jan. 2016 (CET)
Google Maps/OpenStreetMap: API zur Darstellung georeferenzierter Werte
Liebe Auskunft, gibt es eine API, mit der a) in Google Maps, b) in OpenStreetMap ein Color-Code (also eine farbige Darstellung georeferenzierter Werte) auf Grundlage a) einer Gleichung, b) eines Algorithmus erzeugt werden kann? Es geht darum, beispielsweise eine Ausbreitungsfahne (Beispiel hier ganz unten) darzustellen. --BlackEyedLion (Diskussion) 09:39, 12. Jan. 2016 (CET)
- Kann ich dir nicht direkt sagen, aber irnkjemand im OSM-Forum kann das für b) bestimmt. --Kreuzschnabel 09:55, 12. Jan. 2016 (CET)
- Das lässt sich mit OpenLayers realisieren. Hier findest Du ein paar, teils recht beeindruckende Beispiele dafür, was alles möglich ist. Viel Spaß --Zinnmann d 10:07, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ist open layers etwas ähnliches wie leaflet.js?--85.4.233.141 23:45, 12. Jan. 2016 (CET)
In dem Artikel steht "..meist im 3/4 Takt". Kennt irgendemand ein Schunkellied, das nicht im 3/4 Takt ist ? --RobTorgel 09:47, 12. Jan. 2016 (CET)
- Google liefert mit bspw. diesen Artikel --Windharp (Diskussion) 10:10, 12. Jan. 2016 (CET)
- mmh, danke, werd ich versuchen --RobTorgel 10:16, 12. Jan. 2016 (CET)
- Warte.... Hier noch die Funktionalität! Schunkeln ist vor allem "sozial" und weniger "musikalisch" (mal in ein paar Wochen genau hinschaun! Die Harmonie bleib schnell auf der Strecke.) Die Bewegung - egal welcher Takt - und die Berührung lösen positive Gefühle aus. Ernstes Gruppenschunkeln gibt es (vermutlich) nicht.
- "Alle musikalischen Gruppierungen kooperieren partnerschaftlich, die Beziehungen untereinander sind kameradschaftlich, zumal jede Gruppe ihr spezifisches Repertoire repräsentiert und damit zwingenderweise nicht zum Konkurrenten werden muß oder gar irgendeine Form des Protestes in Form eines unkonventionellen Musikstiles präsentieren müßte. Im Gegenteil: So unterschiedlich die musikalischen Ausdrucksformen auch sein mögen, so scheint sich die öffentliche Akzeptanz letztlich über den gespielten Rhythmus zu erklären, ein Rhythmus, eine Taktfrequenz, die im Bereich maximaler Mitklatschtendenz liegt. Deshalb verwenden die verschiedensten Musikgruppen – je nach Genre – mit Vorliebe entsprechende Tempi, die die Menschen – entsprechend ihren inneren, neurobiologischen Mechansimen - zum Mitklatschen, Mitschwingen und –schunkeln, zum rhytmischen Mittanzen animieren."
- Also: 3/4 ist schon mal sehr gut, aber wenn man Schunkeln WILL/MUSS und der - oft vergessene - Alkoholpegel stimmt, kann man zu (fast) allem schunkeln!
- Hier ist der Klingeling Eiermann Song. Ab etwa 1:40 sieht man Personen (z.B. die Blonde rechts vorne), die mit Mono-Schunkeln beginnen, um ein Gruppenerlebnis auszulösen. Play It Again, SPAM (Diskussion) 10:43, 12. Jan. 2016 (CET)
- mmh, danke, werd ich versuchen --RobTorgel 10:16, 12. Jan. 2016 (CET)
- @Play It Again, SPAM: Das stimmt. Die wichtigste Gruppe beim Schunkeln ist die OH-Gruppe --RobTorgel 16:32, 12. Jan. 2016 (CET)
- Aber nur die kovalent gebundene Hydroxygruppe. Das ionisch gebundene Hydroxidion lädt eher weniger zum Schunkeln ein. --Rôtkæppchen₆₈ 00:27, 13. Jan. 2016 (CET)
- @Play It Again, SPAM: Das stimmt. Die wichtigste Gruppe beim Schunkeln ist die OH-Gruppe --RobTorgel 16:32, 12. Jan. 2016 (CET)
- Im Kölner Karneval wird zu allem geschunkelt, was einen erkennbaren Takt hat, egal, ob Walzer oder Marschfox. --Jossi (Diskussion) 16:48, 12. Jan. 2016 (CET)
#falschesgrau ???
Mit dem #ausnahmslos tag taucht auch vermehrt der tag #falschesgrau auf. Hab ich da irgendeinen Trend verpasst? Was bedeutet "falschesgrau"? --2003:66:8954:937A:2CEF:7AE2:7372:22A8 10:31, 12. Jan. 2016 (CET)
- nach einer kurzen twitter-suche: wehleidige männer ohne anstand. -- southpark 10:33, 12. Jan. 2016 (CET)
- Bitte kein Gedöns. Ich möchte nicht deine Meinung dazu wissen sondern was es tatsächlich bedeutet. --2003:66:8954:937A:2CEF:7AE2:7372:22A8 10:35, 12. Jan. 2016 (CET)
- Den Tweets nach zu urteilen: es soll sämtliche Vorurteile gegenüber Männern bekräftigen. Laut den Initiatoren sollen Männer dadurch beweisen, dass es ar nicht so ist, dass sie auch Sexisten sind. wie sie das schaffen wollen, indem sie Pornobilder und Machosprüche posten, musste du allerdings vielleicht die Initiatoren fragen. Vor allem scheint es sehr verwirrt zu sein und wirft ein echt peinliches Bild auf die Männlichkeit. -- southpark 10:59, 12. Jan. 2016 (CET)
- Bitte kein Gedöns. Ich möchte nicht deine Meinung dazu wissen sondern was es tatsächlich bedeutet. --2003:66:8954:937A:2CEF:7AE2:7372:22A8 10:35, 12. Jan. 2016 (CET)
Wo wurde dieses alte Aufzeichnungsgerät vormals verwendet?


Hallo, kennt jemand dieses elektronische Geräte? Es wurde auf einem Flohmarkt fotografiert. Was ist das für eine Art Gerät und wo wurde es vormals eingesetzt? --Eneas (Diskussion) 10:39, 12. Jan. 2016 (CET)
- Die Geschwindigkeit von "sound in water". Play It Again, SPAM (Diskussion) 10:47, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ein historisches Echolot? --Magnus (Diskussion) für Neulinge 10:48, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ja: "The i n t r o d u c t i o n o f t he echo sounder i n t o r o u t i n e hydrographic
s u r v ey in g , r e p l a c i n g dependence on use o f the lead l i n e , produced a major change. I t must be remembered t h a t a sounder a c t u a l l y r e g i s t e r s a time i n t e r v a l and t h a t the speed of sound must be known to c on v e r t the time to depth. The I n t e r n a t i o n a l Hydrographic Bureau r e s ol ve d t h a t 1500 metres per second should be adopted as a s t a n da r d v e l o c i t y . Most Canadian waters a re cold enough t h a t t h i s causes an o v e r e st i m a t e and for calibration the value of 1463 metres per second (800 fathoms per second) is f r e q u e n t l y used. Since f r e s h water has to have a t e mpe r a t ur e o f 14.2°C be f or e t h i s speed i s a t t a i n e d most soundings in deep l a ke s wi l l be o ve r e s t i m a t ed with this calibration." Play It Again, SPAM (Diskussion) 10:49, 12. Jan. 2016 (CET)
- Danke sehr für die Antwort! --Eneas (Diskussion) 19:06, 12. Jan. 2016 (CET)
Diese Twain-Quelle unterstützt den Speicherübertragungsmodus nicht.
Was heißt und bedeutet Twain-Quelle ?
Danke für eine Antwort.
Gottfried Schwantner--188.22.44.200 11:46, 12. Jan. 2016 (CET)
- Es bedeutet, dass versucht wird Bilddaten einer Kamera oder eines Scanners auszulesen. Bildverarbeitungsprogramme, die über TWAIN einlesen können, bieten an die Quelle unter den angeschlossenen und unterstützten Geräten, deren Treiber installiert sind, auszuwählen. Einlesen ist der nächste Schritt. --Hans Haase (有问题吗) 14:33, 12. Jan. 2016 (CET)
Amerikanische Parteien
Warum gibt es in Amerika nur eine demokratische Partei und republikanische Partei? --95.119.125.168 12:07, 12. Jan. 2016 (CET)
In den entsprechenden Artikeln fehlt jede Info zu der Wahlbeteiligung in den USA und zu den Hintergründen hierzu! (Oder war es versteckt und ich habe es überlesen?) --80.187.102.108 19:03, 12. Jan. 2016 (CET)
- Du hast es überlesen: Politische_Parteien_der_Vereinigten_Staaten#Kategorisierung_amerikanischer_Parteien -- Gerd (Diskussion) 19:07, 12. Jan. 2016 (CET)
Es gibt schon mehr Parteien, aber, wie oben erwähnt, Mehrheitswahlrecht - die führt automatisch zum Entstehen eines Zwei-Parteien-Systems (und gleichzeitig zur relativen Annäherung der beiden verbliebenen Parteien). Ab und zu bekommen aber Drittparteienkandidaten über 5%, siehe en:List of third party performances in United States elections--Alexmagnus Fragen? 23:55, 12. Jan. 2016 (CET)
Gut Palibino
Hallo zusammen,
weiß jemand von euch wo genau das oben genannte Landgut liegt, auf dem Sofja Kowalewskaja aufwuchs. bitte so genau wie möglich (möglichst Koordinaten). ich freue mich auf eine Antwort. --Eva-maria schmidt (Diskussion) 14:24, 12. Jan. 2016 (CET)
- erste anhaltspunkte 280km südlich von petersburg, an der litauischen grenze, in der heutigen Oblast Pskow (http://www.berliner-zeitung.de/archiv/vor-150-jahren-wurde-die-mathematikerin-sofia-kowalewskaja-geboren-fuerstin-der-wissenschaft,10810590,9757304.html). -- southpark 14:45, 12. Jan. 2016 (CET)
- Es wird was mit dieser Familie zu tun haben. Leider sind auch dort keine genaueren Ortsangaben. --Magnus (Diskussion) für Neulinge
Polibino, Koordinaten, dort sieht man auch Foto des Kowalewskaja-Museums, das wohl identisch sein wird, aber wo genau es liegt, ist ein bisschen widersprüchlich ... ---King Rk (Diskussion) 14:56, 12. Jan. 2016 (CET)
- Von oben betrachtet sag ich mal das hier könnte es sein. Die Museumsseiten mit Koordinaten sind leider alle etwas ungenau. --King Rk (Diskussion) 15:24, 12. Jan. 2016 (CET)
- Und die Prüfungsfrage lautet jetzt: Auf welche Frage bezieht sich dieser Beitrag? Oder was? --Kreuzschnabel 19:11, 12. Jan. 2016 (CET)
- : 2 Minuten solltest Du mir schon lassen! Und dies hier löscht Du weg! --80.187.102.108 19:14, 12. Jan. 2016 (CET)
- Der Ort hat einen eigenen Artikel: ru:Полибино (Великолукский район). --Timurtrupp (Diskussion) 20:23, 12. Jan. 2016 (CET)
Mondlandung und Stanley Kubrick
Wir hatten vorgestern eine Diskussion zu der wehenden Fahne. Ein Diskussionsteilnehmer sagte, dass Stanley Kubrick in einem Spiegelinterview etwa eine Woche vor seinem Tod gefragt worden ist, wieso er so lange nach 2001: Odyssee im Weltraum für den er einen Oscar bekam, keinen Film mehr gemacht hätte. Kubrick antwortete er hätte sehr viele Filme kurz danach für die NASA realisiert. Die Spiegelreporter fragten: Was für Filme denn? Kubrick soll geantwortet haben: Das darf ich nicht sagen!"
Der Diskussionsteilnehmer behauptete (ganz große Verschwörungstheorie) dafür sei Kubrick umgebracht worden.
Meine Frage ist es irgendeinem hier möglich die Existenz dieses Spiegelinterviews, jenseits der Verschwörungstheorie zu bestätigen? Das Interview müsste 1-maximal 3 Wochen vor seinem Tod veröffentlicht worden sein, also Ende Februar Anfang März 1999. --Markoz (Diskussion) 21:16, 12. Jan. 2016 (CET)
- Ich schlage mal als Grundlage Kubrick, Nixon und der Mann im Mond vor. Auch ohne Spiegel. --Vexillum (Diskussion) 21:34, 12. Jan. 2016 (CET)
- Sehr sehenswerte Dokumentation. Leider ein Fake. Aber vielleicht hat die NASA den Fake gefaked? </Verschwörungstheorie> --Optimum (Diskussion) 21:40, 12. Jan. 2016 (CET)
- Du meinst, die ganzen Widerlegungen der Verschwörungstheorien zur Mondlandung seien alle Fake? Wäre es nicht viel einfacher für die Nasa, tatsächlich zum Mond zu fliegen, anstelle so viele Verschwörungstheorien über Fakten
Verschwörungstheorienin die Welt zu setzen und diese glaubwürdig erscheinen zu lassen? --Rôtkæppchen₆₈ 21:54, 12. Jan. 2016 (CET)- <quetsch>Die hatten natürlich einen kleinen Elektromotor, der die Fahne bewegt hat, weil die Verschwörungstheoretiker sonst gesagt hätten: "Hä? Die bewegt sich ja gar nicht. Und was ist mit dem Sonnenwind?" :) --Optimum (Diskussion) 00:15, 13. Jan. 2016 (CET)
- nach BK: Danke für diesen Hinweis,...ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Interview eines Mitarbeiters der Sternenwarte Bochum in WDR 5, anlässlich der von der NASA geäußertem Sachverhaltes, dass alle Originalaufnahmen der Apollolandung 1969 verschwunden seien. Dieser sagte, dass die STernewarte sich damals irgendein Radargerät zugelegt hätte, die allen Funkkontakt aufgezeichnet hätten. Alle frühen Mondlandungen hätten nur Sprachkontakt aufgezeichnet die ersten Bilder aus dem All wurden erst bei der Apollomission mit dem Auto aus dem All geliefert, deswegen bin ich vorgestern hellhörig geworden.--Markoz (Diskussion) 21:56, 12. Jan. 2016 (CET)
- Darf ich Dir die Sternwarte Bochum als Linkfix anbieten? --Rôtkæppchen₆₈ 00:20, 13. Jan. 2016 (CET)
- Der Diskussionsteilnehmer meinte, die waren oben...aber ohne Kamera, zu schwer zu gefährlich...die Mondbilder seien Studioaufzeichnungen die Kubrick realisiert hätte....und der Link von Vexillum zeigt schon an dass der Diskussionsteilnehmer nicht aus dem dunklen gefischt hat--Markoz (Diskussion) 21:58, 12. Jan. 2016 (CET)
- Du meinst, die ganzen Widerlegungen der Verschwörungstheorien zur Mondlandung seien alle Fake? Wäre es nicht viel einfacher für die Nasa, tatsächlich zum Mond zu fliegen, anstelle so viele Verschwörungstheorien über Fakten
- Sehr sehenswerte Dokumentation. Leider ein Fake. Aber vielleicht hat die NASA den Fake gefaked? </Verschwörungstheorie> --Optimum (Diskussion) 21:40, 12. Jan. 2016 (CET)
- Sehr entscheidend wäre das Interview von Feb. März 1999, kann da aber nix zu finden im Inet...hat nicht einer hier ein Spiegelarchiv?--Markoz (Diskussion) 22:01, 12. Jan. 2016 (CET)

- "Kamera, zu schwer zu gefährlich", klar, weil der Mond aus Käse is, sie wären eingesunken. --Logo 22:13, 12. Jan. 2016 (CET)
- @Markoz...du meinst wohl dieses Interview. Dumm nur, dass es nicht Kubrick ist, der hier vorgibt, Kubrick zu sein. --Blutgretchen (Diskussion) 22:15, 12. Jan. 2016 (CET)
- Heinz Kaminskis erste „Sternwarte Bochum“ befand sich im Keller seines damaligen Wohnhauses, und es wird heute offen angezweifelt, dass er damals in der Lage war, die Sputnik-Signale zu empfangen (bzw. zu unterscheiden). Das gilt auch für die Mondlandung. --Wicket (Diskussion) 23:03, 12. Jan. 2016 (CET)
"Wir schaffen das!" - Übersetzung des Mottos in verschiedene Sprachen
Wie könnte man "Wir schaffen das!" auf Türkisch übersetzen? --ObersterGenosse (Diskussion) 21:59, 12. Jan. 2016 (CET)
- Irgendwas mit hakkından gelmek... --85.212.40.101 23:30, 12. Jan. 2016 (CET)
- Schonmal danke an die IP, aber wie müsste man dazu auf Jugoslawisch, Polnisch, Ungarisch und/oder Tschechisch sagen? --ObersterGenosse (Diskussion) 23:58, 12. Jan. 2016 (CET)
- Frag mal auf der wp:ÜH an oder der wp:Botschaft der jeweligen Sprache an. Yes we can. --Rôtkæppchen₆₈ 00:03, 13. Jan. 2016 (CET)
- Danke für den Tipp, nunmehr wäre mir ein jugoslawisch/serbischer Vorschlag am wichtigsten... --ObersterGenosse (Diskussion) 00:27, 13. Jan. 2016 (CET)
- Schonmal danke an die IP, aber wie müsste man dazu auf Jugoslawisch, Polnisch, Ungarisch und/oder Tschechisch sagen? --ObersterGenosse (Diskussion) 23:58, 12. Jan. 2016 (CET)
Arthur Schnitzler, Werk gesucht
In welchem Schnitzler-Werk legt der Mann seiner One-Night-Genossin morgens Geld auf den Nachttisch, was falsch ist, weil sie gar keine Prostituierte ist? --Logo 22:03, 12. Jan. 2016 (CET)
Deeplinks auf das Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel
Findet jemand eine Möglichkeit, auf einzelne Wirkstoffe innerhalb des Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel zu verlinken? Beispiel: Wähle ich unter "Wirkstoffe" Aclonifen aus und klicke auf "Suchen" erhalte ich zwar eine Seite mit einer URL, die am Ende eine Nummer hat (aktuell https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/ListeMain.jsp?page=1&ts=1452632798528), aber das ist eine Session-ID, eignet sich also vermutlich nicht zur langzeitstabilen Verlinkung. Eine Quelltextanalyse von https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/FormSuche.jsp verrät mir für Aclonifen einen value="0656" - hilft mir aber noch nicht für eine vollständige URL. Jemand eine Lösung? --Mabschaaf 22:10, 12. Jan. 2016 (CET)
- Seitennummer im Parameter Page= ersetzen. --Hans Haase (有问题吗) 22:41, 12. Jan. 2016 (CET)
- @Hans Haase: Das scheint nicht zu funktionieren (oder ich habe es nicht verstanden); @IP: Ja, das klappt. Danke --Mabschaaf 22:52, 12. Jan. 2016 (CET)
Bürgerpark Marzahn und Springpfuhlpark
Ich habe heute den halben Abend nach Informationen über Bürgerpark Marzahn und Springpfuhlpark bei Google und nichts über die Entstehung gefunden. Wer weiß was darüber oder findet was ich nicht gefunden habe? --Auto1234 (Diskussion) 22:56, 12. Jan. 2016 (CET)
13. Januar 2016
Bis zu welchem Dienstragd ist es nicht unüblich an direkten Kampfhandlungen teilzunehmen?
Hallo , ich wollte mich mal erkundigen bis zu welchem Dienstgrad es nicht unüblich ist das der entsprechende Soldat an Kampfhandlungen teilnimmt. Mir ist klar das es da wohl einige Unterschiede zwischen den Waffengattungen Heer, Marine und Luftwaffe gibt , sowie unterschiede zwischen Armeen und das sich das historisch sicherlich unterscheidet.
Gleichwohl würde mich mal interessieren ob z.B. ein Hauptmann der Fallschirmjäger noch aktiv mitkämpft oder eben nicht. --92.206.210.64 00:18, 13. Jan. 2016 (CET)
Ungeziefer
Hallo, kann mir jemand sagen um es sich hier für ein Tier handelt das ich vorhin eingefangen habe? Das Tier dürfte im Größenbereich von rund 5 mm liegen. --87.140.192.2 00:31, 13. Jan. 2016 (CET)

















