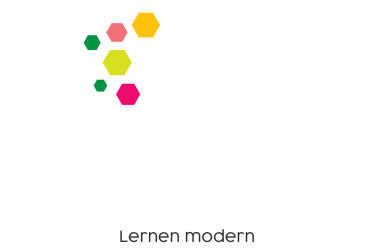„Ökologisches Gleichgewicht“ – Versionsunterschied
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{{Link FA|he}} |
{{Link FA|he}} |
||
[[et:Ökoloogiline tasakaal]] |
|||
[[he:מאזן אקולוגי]] |
[[he:מאזן אקולוגי]] |
||
[[zh:生态平衡]] |
[[zh:生态平衡]] |
||
Version vom 22. April 2010, 20:29 Uhr
Das ökologische Gleichgewicht bezeichnet eine unter ungestörter Systemdynamik positiv invariante kompakte Teilmenge des Zustandsraumes eines Ökosystems. Es ist demnach ein Fließgleichgewicht bezogen auf die konstituierenden Individuen, jedoch ein Fixpunkt bzw. ein periodischer Orbit der Dynamik des Ökosystems gemeint. Eine Klasse ökologischer Gleichgewichte bilden die stabilen Gleichgewichte.
Erläuterung der modernen, dynamischen Auffassung
Als „im Gleichgewicht“ kann ein Ökosystem nur dann bezeichnet werden, wenn es längere Zeit in einem Zustand verbleibt, also einen festgelegten Punkt des Zustandsraumes nicht verlässt, oder wenn die gegenwärtige Phase seines regelmäßigen bzw. längerfristigen Entwicklungskreislaufs gut ausgebildet ist (periodischer Orbit). In beiden Fällen wird die durchschrittene Punktmenge des Zustandsraumes als invariant bezeichnet, in dem Sinne, dass die Entwicklung von sich aus nicht aus dem Fixpunkt bzw. dem Orbit herausführt.
Eine Eigenschaft die manchen, aber nicht allen, Gleichgewichten zukommt, ist die Stabilität. Es gibt verschiedene Arten der Stabilität ökologischer Systeme. Hilfreich ist beispielsweise folgende Einteilung, die auf die Zusammensetzung des "Artengefüges" abstellt [1] :
- Stabilität spricht man einem Ökosystem zu, dessen Artengefüge bei Störungen von außen im Wesentlichen unverändert bleibt.
- Zyklizität bewirkt, dass durch regelmäßigen Wechsel der Umweltbedingungen ausgelöste Schwankungen im Artengefüge vollständig und rasch durchlaufen werden.
- Elastizität besteht, wenn auch katastrophale Stresssituationen, die aber für den Standort typisch sind, kompensiert werden können.
- Resilienz ist die Fähigkeit, nach wesentlichen Artenverschiebungen durch eine Abfolge von anderen Ökosystemen (Sukzession) wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren.
Eine Fokussierung auf die bestimmte Formen der zeitlichen Invarianz der vorkommenden Arten ist jedoch für eine Stabilitätsdefinition nicht zwingend. Ebenso können funktionale Ökosystemparameter (z.B. Netto-Primärproduktion, Energieumsatz) heran gezogen werden.
Die Ökosysteme können als komplexe adaptive Systeme verstanden werden. Unter diesem Gesichtspunkt sind sie Gegenstand der Theorie dynamischer Systeme. Theorie dynamischer Systeme läßt zu, dass - je nach betrachtetem System oder Systemausschnitt- multiple Fließgleichgewichte auftreten können. Andere dynamische Phänomene haben die Eigenschaft, Attraktor eines bestimmten Typs zu sein. [2] Aus diesem Blickwinkel treten resiliente Systemzuständen auf, wenn das System nach einer Störung im Bereich des gleichen Attraktors bleibt. Irreversibelbe Störingen lassen das System in den Bereich eines anderen Attraktors wechseln.[3]
Betrachten wir als Beispiel eine mehrschürige Wiese auf einem mesotrophen Standort. Es handelt sich dabei um anthropogenes Ökosystem, welches als zyklisch stabil bezeichnet werden kann. Die zyklische Störung ist dabei die Mahd, die kurzfristig in das System eingreift, aber eben durch die regelmäßigen Eingriffe einen langfristig stabilen Zustand erzeugt. Sobald nun die Bewirtschaftung unterlassen wird - d.h. nicht mehr gemäht wird, breiten sich Stauden aus und schliesslich tritt eine Verbuschung ein. Diese Sukzession mündet schießlich in einem Wald. Es tritt also ein Wechsel hin zu einem anderen Ökosystem ein, das ebenso stabil sein kann.
Während der Zeit der Umstellung ist die Biozönose nicht im Gleichgewicht. Der Begriff der Stabilität ist in dieser Zeit nicht sinnvoll anwendbar. Dies heißt jedoch nicht automatisch, dass Bestände im Ungleichgewicht automatisch „weniger wertvoll“ wären.[4]
Anders als nach der statischen Auffassung des ökologischen Gleichgewichts können bestimmte Störungen die Resilienz eines Ökosystems sogar stärken, so dass die Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen aktiv aufgebaut werden kann.[5] So soll das regelmäßige, gezielte Legen von kleineren, räumlich begrenzten Feuern im Unterholz bestimmter Waldökosysteme auf lange Sicht das Ausbrechen großer, unkontrollierter Waldbrände verhindern, die auch den Kronenbereich erfassen. Ein Beispiel für einen nicht-resilienten Systemzustand wäre ein überdüngter See, der in einem heißen Sommer „umkippen“ kann. In der Folge kann es in einem solchen polytrophen See zu Faulschlammbildung und einer dauerhaften Unterversorgung mit Sauerstoff kommen, was in der Regel einen starken Rückgang der Artenvielfalt zur Folge hat.
Zeitspanne, Referenzzustand, Ortsbezug
Je nach Betrachtungsmaßstab (Tage, Jahre, Jahrhunderte, geologische Epochen) ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse für das, was als „stabil“ bzw. „im Gleichgewicht“ gelten kann. Das langfristige, auf einen größeren Raum bezogene Gleichgewicht einer sogenannten Klimaxgesellschaft kann von unterschiedlichen zyklischen Dynamiken im kleineren Maßstab geprägt sein. Dies zeigen neuere Untersuchungen der Entwicklung von Urwäldern, die vom sogenannten Mosaik-Zyklus-Konzept ausgehen. Insbesondere für Arten, die Pionierstandorte besiedeln, ist das Aussterben von Lokalpopulationen ein natürlicher Prozess, ebenso die Neuetablierung an anderen Standorten (z. B. beim Flussregenpfeifer). Die Frage der Stabilität bzw. des Gleichgewichts der Population hängt hier auch davon ab, welcher Raumbezug gewählt wird.
Einige Ökosysteme benötigen für das Erreichen eines stabilen Zustandes Jahrhunderte. Hier tritt das empirische Problem auf, das das ökologische Gleichgewicht auch nach einer dynamischen Auffassung nicht immer sinnvoll definiert werden kann. Dies liegt daran, dass relevante Umwelteinflüsse schneller (und unvorhersehbar) wechseln, als das Ökosysteme reagieren kann. Ein relevantes Beispiel sind die Waldökosysteme der gemäßigten Zone. Diese brauchen viele Jahrhunderte, um nach einer starken Störung in einen Ausgangszustand "zurück" zu kehren. Auch ohne menschlichen Einluss ist in solchen Zeiträumen jedoch mit Klimaveränderungen zu rechnen, die stark genug sind, dass sie die Richtung der Sukzession verändern (vgl. Kleine Eiszeit). Das Erfordernis einer "ungestörten Systemdynamik" ist hier weitgehend eine definitorische Fiktion, die empirisch nicht zu erfüllen ist.
Wertung und Anwendung im Naturschutz
Begriffe wie „Stabilität“ oder „Gleichgewicht“ haben oft eine normative Konnotation: Ungleichgewichte werden von vielen Menschen eher als bedrohlich empfunden als ein „harmonisches“ Gleichgewicht. Wird von einer „Störung“ des ökologischen Gleichgewichts gesprochen, ist damit meist unausgesprochen gemeint, dass ein Eingreifen zum Wiederherstellen des Gleichgewichtes nötig sei.[6][7]
Wenn ein neu angenommener Systemzustand weniger produktiv ist oder eine geringere Biodiversität aufweist, kann er nach Ansicht mancher Autorem weniger wünschenswert sein. Gegenstand von Natur- und Artenschutzfragen war auch daher bislang oft die Erhaltung eines bestimmten Zustandes: Eine bestimmte Pflanzengesellschaft oder eine Tierart soll – möglichst an derselben Stelle und in ähnlicher Anzahl – erhalten werden. Allerdings gibt es in neuerer Zeit verstärkt Tendenzen, die von einem solchen, eher konservierenden Naturschutzkonzept abrücken. Dies kann zum einen darin bestehen, durch einen Prozessschutz die Veränderung als Teil natürlicher Prozesse zu akzeptieren.[8] Andererseits kann ein landschaftspflegerischer Ansatz mit gezieltem Biotopmanagement aktiv den Schutz von Biodiversität und ästhetischer sowie kulturgeschichtlicher Besonderheit der Landschaft verfolgen.[9]
- Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts insbesondere im mitteleuropäischen Raum sich ausbreitende Katalogisierung der Vegetation in hierarchische Einheiten (Pflanzensoziologie, z. B. Braun-Blanquet (1928 / 1964)[10] hat wahrscheinlich das Denken in statische Kategorien verstärkt. Diese heute meist als schützenswert angesehenen Einheiten (z. B. Genisto pilosae-Callunetum = Haarginsterheide) waren damals durchaus typische Landschaftselemente, die jedoch z. T. auf einer nicht nachhaltigen Nutzungsweise beruhten (im Beispiel sind die Haarginsterheiden Ersatzgesellschaften für übernutzte Eichenwaldgesellschaften), während das heutige Landschaftsbild durch andere Pflanzengemeinschaften geprägt wird, da sich die (landwirtschaftliche) Nutzungsweise gegenüber vor 100 Jahren stark geändert hat.
- Breitet sich eine Tierart aus, weil die Lebensbedingungen für sie besser geworden sind, und erfolgt diese Ausbreitung (auch) auf Kosten anderer Zielarten von Naturschutz, Artenschutz und / oder Jagd, entsteht schnell die Forderung, dass zur Bewahrung des ökologischen Gleichgewichtes die Ausbreitung gestoppt bzw. rückgängig gemacht werden soll.
In beiden Fällen ist bei näherer Betrachtung nicht ohne weiteres klar, warum gerade die frühere bzw. aktuelle Situation den zu bewahrenden Optimalzustand eines „ökologischen Gleichgewichtes“ darstellen soll.
- Bezzel (1992)[11] bringt als Beispiel den Hochwald, der als Schutzwald oder Holzressource bestimmte Funktionen wahrnimmt oder ein Landschaftsbild prägt: „Zuviel Schalenwild stört den dieser Vorgabe entsprechenden Wald. Man will nicht warten, bis Hirsche, Rehe oder Gemsen durch Übernutzung des pflanzlichen Nachwuchses ihren eigenen Lebensraum zerstört haben, so dass sie genötigt sind, durch Ressourcenmangel zu verschwinden und dann der Wald in einem weite Zeiträume umspannenden Zyklus seine Chance erhält. Ob eine solche Absicht, die nicht selten darauf hinausläuft, ein bestimmtes Entwicklungs- (Sukzessions-) stadium anzuhalten, als „biologisches Gleichgewicht“ richtig beschrieben ist, sei mit Nachdruck bezweifelt. „Konstante Verhältnisse oder Strukturen“ wäre der angemessenere Ausdruck.“
Für das Bewahren bestimmter Lebensgemeinschaften oder eines bestimmten Status der Artenvielfalt eignet sich Wiederherstellung eines ökologischen Gleichgewichtes als Argument oft nicht.[6] Für viele Zielarten des Naturschutzes sind Pflegemaßnahmen üblich, die eine Störung von natürlicherweise ablaufenden Sukzessionsprozessen und damit auch eine Störung des sich natürlicherweise einstellenden „Gleichgewichtszustandes“ darstellen (z. B. Kreuzkröte[12], Heidelerche[13], Uferschwalbe[14]).
Berücksichtigung des anthropogenen Einflusses
Umstritten ist, ob und ab welchem Grad menschliche Einflüsse auf Ökosysteme als Störung anzusehen sind.[15] [6] Das Zusammenwirken natürlicher und menschlicher Einflüsse in Ökosystemen werden von der sozial-ökologischen Forschung und der Ökologischen Ökonomie untersucht. Insbesondere werden dabei Fragen der Nachhaltigkeit und Resilienz thematisiert.
Einzelnachweise
- ↑ Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 5. Auflage, Ulmer Verlag Stuttgart, S. 1096
- ↑ Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter und A. Kinzig (2004: "Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems" Ecology and Society 9(2): 5. [online] URL: [1]
- ↑ Carl Folke, Steve Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Thomas Elmqvist, Lance Gunderson und C.S. Holling (2004): Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. (35), S. 557 ff. [2]
- ↑ Wilmanns, O. (1998): Ökologische Pflanzensoziologie. Eine Einführung in die Vegetation Mitteleuropas. 6. Auflage. Quelle & Meyer Verlag Wiesbaden, Seite 22 f.
- ↑ Carl Folke, Steve Carpenter, Thomas Elmqvist, Lance Gunderson, CS Holling und Brian Walker (2002): "Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations" AMBIO: A Journal of the Human Environment (31), S. 437–440
- ↑ a b c Reichholf, J. (2005): Die Zukunft der Arten. Neue ökologische Überraschungen. C. H. Beck-Verlag München, Seite 237
- ↑ Daniel B. Botkin: Discondant Harmonies - A New Ecology for the Twenty-First Century, Oxford University Press, 1990
- ↑ Jedicke, E. (1998): Raum-Zeit-Dynamik in Ökosystemen und Landschaften, Naturschutz und Landschaftsplanung 30, S. 229 ff.
- ↑ Küster, H. (2005): Das ist Ökologie - Die biologischen Grundlagen unserer Existenz, München: C.H. Beck, S. 169 ff.
- ↑ Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. 3. Auflage, Wien (1. Auflage von 1928)
- ↑ Bezzel, E. (1992): Liebes böses Tier. Die falsch verstandene Kreatur. Artemis & Winkler Verlag München, 232 Seiten
- ↑ Warren, S. D.; Büttner, R. (2008): Aktive militärische Übungsplätze als Oasen der Artenvielfalt. Studie zur positiven Auswirkung von „Landschaftszerstörung“ auf bedrohte Arten. Natur und Landschaft 83 (6): Seite 267-272
- ↑ Mallord, J. W.; Dolman, P. M.; Brown, A. F.; Sutherland, W. J. (2007): Linking recreational disturbance to population size in a ground-nesting passerine. Journal of Applied Ecology 44: Seite 185–195
- ↑ Dornberger, W.; Ranftl, H. (1983): Neue Daten von der Uferschwalbe (Riparia riparia) aus Nordbayern. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ 37: 21-31.
- ↑ Honnefelder, L. (1993): Welche Natur sollen wir schützen? Gaia 2 (5): 253-264.