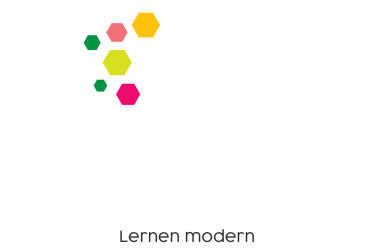Bismarcks ewiger Bund
Bismarcks ewiger Bund ist der Titel eines Buchs, das die Geschichte der Entstehung, Anwendung und wechselhaften Wirklichkeit der Verfassung des Norddeutschen Bundes und später des Deutschen Reiches von 1871 beschreibt. Der Autor Oliver Haardt legt einen Schwerpunkt darauf, wie der Bundesrat die ihm zugedachten Aufgaben als „Regierungsbank mit 43 Plätzen“, später 58 Plätzen, wahrnahm. Der Bundesrat scheiterte an dieser Aufgabe, weil die weisungsgebundenen Vertreter der Einzelstaaten nicht in der Lage waren, die nationale Politik eines großen Flächenstaates zu formulieren. Die Regierungskompetenzen wuchsen stattdessen dem Reichskanzler und seinem Reichskanzleramt zu. Der Reichstag wurde mächtiger und erzwang in zwei Fällen den Rücktritt des Reichskanzlers. Preußen stellte seine siebzehn Bundesratsbevollmächtigten der Reichsverwaltung zur Verfügung. Der Bundesrat konnte deshalb seiner Hauptaufgabe nicht mehr nachkommen, die Interessen der Einzelstaaten wahrzunehmen.

Der Autor Oliver Haardt studierte am Trinity College in Cambridge Geschichte. Er wurde 2017 unter Christopher Clark promoviert. Ab 2017 arbeitete er als Lumley Research Fellow in Geschichte am Magdalene College der Universität Cambridge.
Haardt beginnt mit dem Werdegang der Entwürfe Bismarcks von den Grundzügen einer künftigen Bundesverfassung bis hin zum Entwurf der Regierungen der norddeutschen Staaten, der am 4. März 1867 dem Reichstag zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.
Die Änderungen des Reichstags am Entwurf der Regierungen

Die 297 Abgeordneten des konstituierenden Reichstags, der nur über die Verfassung zu beschließen hatte, teilten sich in zwei Gruppen, eine konservative und eine liberale.
Konservative Fraktionen waren:
| Fraktion/Gruppierung | Sitze |
|---|---|
| Konservative Partei | 59 |
| Freikonservative Partei | 39 |
| Altliberale Partei | 27 |
| fraktionslose Konservative | 8 |
| Summe | 133 |
Liberale Fraktionen waren:
| Fraktion/Gruppierung | Sitze |
|---|---|
| Nationalliberale Partei | 80 |
| Freie Vereinigung | 14 |
| Deutsche Fortschrittspartei | 19 |
| fraktionslose Liberale | 11 |
| Summe | 124 |
Auf andere Parteien entfielen 40 Sitze.
Die konservative Parlamentariergruppe orientierte sich mehr am Modell eines Staatenbundes, die liberale Parlamentariergruppe tendierte zu zentralstaatlichen Vorstellungen. 68 Abgeordnete konnten als gesicherte Gegner der Regierungen betrachtet werden, die den Entwurf einbrachten.[1]
Grundrechte
Grundrechte waren im Entwurf der verbündeten Regierungen nicht vorgesehen. Die Mehrheit der Abgeordneten war nicht daran interessiert, weil sie in den vorgesehenen knapp sechs Wochen Sitzungszeit nicht hätten verhandelt werden können. Knapp 40 Abgeordnete beantragten, wenigstens eine Gesetzgebungskompetenz für künftige Grundrechte in der Verfassung vorzusehen. Doch selbst dieser zurückhaltende Antrag wurde mit 130: 128 Stimmen abgelehnt; 39 Abgeordnete nahmen nicht an der Abstimmung teil.[2] Einige Nationalliberale hofften auf eine zukünftige Verfassungsänderung, auch wenn sie 2/3 der abgegebenen Stimmen im Bundesrat benötigte[3][4] Statt Grundrechten sollte das wirtschaftliche „Menschrecht“ auf Freizügigkeit[5] gesichert werden.[6] Wenn die Verfassung kein Freiheitsversprechen abgeben durfte, so sollte sie nach Auffassung der Reichstagsmehrheit umso mehr die „Erlösung aus der Zersplitterung“, also einen einheitlichen Wirtschafts- und Verkehrsraum bewerkstelligen: der Bund bekam über den Entwurf der Regierungen hinaus die Zuständigkeit für die Herstellung von Land- und Wasserstraßen.[7] Die noch bestehenden Länderbahnen der Einzelstaaten wurden verpflichtet, Fahrpläne für den Personenfernverkehr anzubieten und durchgehenden Güterverkehr zuzulassen und, zum Schrecken der Techniker, fremde Güterwägen auf ihr Schienennetz zu lassen.[8][9]
Wahl des künftigen Reichstags
Im allgemeinen Männerwahlrecht, wie es schon die gescheiterte Reichsverfassung von 1848 vorsah, sahen die Liberalen eine große Gefahr für den Parlamentarismus. Das Schicksal der Nation werde in die Hände von Personen mit geringem Urteilsvermögen gelegt. Der Historiker Heinrich von Sybel warnte, dass das allgemeine, direkte und gleiche Wahlrecht noch immer der Anfang vom Ende des Parlamentarismus gewesen sei. Es führe in die Diktatur der Demokratie. Die Gegner des Wahlrechts hüllten sich großenteils in Schweigen, weil sie nicht wussten, wie sie Modelle eines abgestuften Wahlrechts, wie das preußische Dreiklassenwahlrecht oder das sächsische ständische Wahlrecht als gerecht darstellen sollten. So passierte das allgemeine, direkte Männerwahlrecht den Reichstag gegen die innere Überzeugung konservativer und liberaler Abgeordneter.[10] Die Nationalliberalen führten den Stimmzettel und das Wahlgeheimnis ein;[11] beides sah der Entwurf der Regierungen nicht vor, weil sich Bismarck eine soziale Kontrolle durch eine offene Stimmabgabe erhoffte.[12]
Kompetenzen des künftigen Reichstags
Selbstorganisationsrecht des künftigen Reichstags
Der Reichstag hatte nur ein beschränktes Selbstorganisationsrecht. Er konnte seine Geschäftsordnung und seinen Geschäftsgang selbst bestimmen.[13] Allerdings hatte er nicht das Recht, sich selbst einzuberufen, weil dies eine Kontrolle der Regierung erleichtert hätte. Er hatte auch nicht das Recht, sich selbst zu vertagen und aufzulösen. Diese Rechte standen nur dem König von Preußen bei Mitzeichnung des Bundeskanzlers zu. Dem konstituierenden Reichstag gelang es, einige Rechte des Königs von Preußen zu beschneiden: Nach Auflösung des Reichstags mussten Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen stattfinden. Innerhalb von weiteren 30 Tagen musste der neue Reichstag einberufen werden. Die parlamentslose Zeit war im Grundsatz auf drei Monate beschränkt.[14] Der Reichstag wurde im Norddeutschen Bund nie aufgelöst, aber viermal im Deutschen Reich nach Beitritt der süddeutschen Staaten. Eine Vertagung von mehr als 30 Tagen bedurfte der Zustimmung des Reichstags und durfte nur einmal im Jahr erfolgen.[15] Außerdem erstritt der Reichstag eine Immunität der Abgeordneten, wenngleich sie schwach ausgeprägt war.[16] Die Verhandlungen des Reichstags waren öffentlich. Der Reichstag konnte durchsetzen, dass wahrheitsgemäße Berichterstattung darüber weder zivil- noch strafrechtlich verfolgt werden konnte.[17]
Befugnisse des Reichstags in der Außenpolitik
Der Entwurf der Regierungen überließ die Vertretung des Bundes dem König von Preußen. Völkerrechtliche Verträge über Materien, die der Gesetzgebung des Bundes unterlagen, sollte er zwar mit Zustimmung des Bundesrats abschließen dürfen, aber ohne Mitwirkung des Reichstags. Die Liberalen konnten sich mit den Konservativen darauf einigen, dass zur Wirksamkeit die nachträgliche Genehmigung des Reichstags erforderlich sein sollte.[18] Allerdings unterfielen die hochpolitischen Verträge über Freundschafts-, Bündnis- und Beistandspakte nicht der Bundesgesetzgebung, so dass die bisherige Geheimdiplomatie mit ihren unabsehbaren Folgen fortgeführt werden konnte. Die Liberalen waren damit zufrieden, dass der Reichstag an den Zoll- und Handelsabkommen und an den zu erwartenden Verträgen über das Post- und Telegraphenwesen mitwirken konnte.[19]
Bundesregierung

Eine Bundesregierung sahen die Entwürfe Bismarcks von Anfang an nicht vor. Er wollte vermeiden, dass der Reichstag die Regierungstätigkeit unter seine Kontrolle zu bringen versucht. Der Entwurf der einzelstaatlichen Regierungen verteilte die einzelnen Regierungsaufgaben des Bundes so geschickt auf den König von Preußen als Inhaber des Bundespräsidiums, auf den Bundesrat und den Bundeskanzler, dass der Eindruck entstehen sollte, dass es einer Regierungstätigkeit überhaupt nicht bedurfte.
Der König von Preußen sollte die Ausführung der Bundesgesetze überwachen und hierzu notwendige Anordnungen erlassen und Verfügungen treffen. Die Vertreter der Gründungsregierungen befürchteten, dass die Bundesaufsicht des Königs darauf hinauslaufen werde, dass mangels anderer Behörden die preußischen Ministerien mit der Ausübung beauftragt würden. Sie setzten deshalb in der Vorlage durch, dass die Kontrollakte des Bundespräsidiums vom Bundeskanzler mitunterzeichnet werden müssen. Sie verzichteten dabei auf die übliche Formulierung „Gegenzeichnung“ oder „Kontrasignatur“, um eine politische Verantwortlichkeit nicht deutlich hervortreten zu lassen.[20]
Im Reichstag stellte der Abgeordnete Rudolf von Bennigsen mit Hintersinn den Antrag, dass der Bundeskanzler ausdrücklich verantwortlich sein solle und mit ihm die vom Präsidium des Bundes ernannten Vorstände der einzelnen Verwaltungszweige. Bismarck trat dem entgegen, weil die beantragte Erweiterung der Verantwortlichkeit auf andere Behörden ein Eingriff in die Rechte des Bundesrats sei, der die kollektive Souveränität der Bundesfürsten verkörpere. Der Bundesrat würde der beantragten Erweiterung nicht zustimmen und der beabsichtigte Bund würde scheitern.[21] Der Reichstag ließ die Verantwortlichkeit der einzelnen Vorstände der Verwaltungszweige fallen, aber die Verantwortlichkeit des Bundeskanzlers wurde beschlossen. Constantin Frantz und Ernst Rudolf Huber erkannten deshalb im Bundeskanzler einen Amtsträger mit eigenem Machtbereich, durch den der Bund handelte und der aus der Rolle eines Leiters der Geschäftsstelle des Bundesrates hinausgewachsen war.[22]
Heer und Marine
Als der Entwurf der Regierungen am 4. März 1867 beim Reichstag eingereicht wurde, hatte Preußen 264.000 Soldaten und Sachsen 32.000 Soldaten. Die Friedenspräsenzstärke des künftigen Heeres sollte ein Prozent der Bevölkerung betragen, und anteilig nach der Einwohnerzahl von den Einzelstaaten gestellt werden. Sie wurde bis zum Ergebnis einer Volkszählung mit 300.000 Mann angenommen. Wenn die Bevölkerung wachsen sollte, konnte nach Ablauf von zehn Jahren der König von Preußen als Bundesfeldherr einen anderweitigen Prozentsatz festlegen. Jeder Wehrfähige sollte vom 20. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr zum stehenden Heer herangezogen werden können und bis zum vollendeten 32. Lebensjahr, also weitere fünf Jahre, zur Landwehr.
Zur Finanzierung des Heeres hatte jeder Einzelstaat 225 Taler pro Kopf des ihn treffenden Anteils an der Friedenspräsenzstärke an den Bundesfeldherrn zu bezahlen. Unmittelbar nach der Wahl sollte der König von Preußen als Bundesfeldherr die preußische Militärgesetzgebung im ganzen Bundesgebiet auf dem Verordnungswege einführen. Nur die preußische Militärkirchenordnung war davon ausgenommen.
Eine Bundeskriegsmarine musste erst noch geschaffen werden. Sie sollte unter preußischem Oberbefehl stehen. Organisation und Zusammensetzung der Bundeskriegsmarine sollte ausschließlich der König von Preußen als Oberbefehlshaber der Marine festlegen. Die Kosten sollten wieder die Einzelstaaten nach dem Maßstab der Einwohnerzahlen tragen. Anders als der Heereshaushalt sollte der Marinehaushalt als Teil des Bundeshaushalts im Wege der üblichen Haushaltsgesetzgebung von Bundesrat und Bundestag beschlossen werden.
Die Finanzierung des Heeres ohne Parlamentsbeteiligung im Entwurf vom 4. März 1867 entsprach genau den Vorstellungen, die Bismarck bereits hatte, als er das Amt des preußischen Ministerpräsidenten antrat. Da die Militärausgaben 95 Prozent des Bundeshaushalts in Anspruch genommen hätten, betraf die parlamentarische Kontrolle des Haushalts nur einen Bruchteil der Einnahmen und Ausgaben.[23] Der Entwurf sah für die Finanzierung des Heeres einen unverrückbaren, ewigen Beitrag vor, an dem Bundesrat und Reichstag nichts verändern durften. Aus Sicht der Konservativen hätte die Unterwerfung des Militärs unter das allgemeine Haushaltsrecht den auf Dauer angelegten Norddeutschen Bund in ein kündbares Vertragsverhältnis überführt. Die Altliberalen sahen es genauso.[24] Die Linksliberalen betonten die Gefahr, dass man mit der Herausnahme des Militärwesens aus der jährlichen Haushaltsgesetzgebung einen absoluten Kriegsherrn schaffen würde, der neben den Organen der Verfassung existiere. Außerdem gäbe es keinen sinnvollen Grund, dem Volk, dem Reichstag und dem Bundesrat die Herrschaft über den Militäretat zu entziehen.[25] Es gab einen ersten Kompromissvorschlag: die Verfassung sollte die Heeresstärke und den Pro-Kopf-Beitrag der Einzelstaaten auf vier Jahre festlegen und die weitere Bestimmung dem normalen Gesetzgebungsverfahren in Bundesrat und Reichstag überlassen. Der Kompromiss scheiterte an den Regierungen und am Widerstand Bismarcks.[26] Konservative und Nationalliberale einigten sich auf einen Kompromiss, der auch den Regierungen zusagte: Der Geldbetrag blieb mit 225 Talern fest, aber der Gesetzgeber sollte die Friedenspräsenzstärke ab 1872 neu festsetzen dürfen. Auch die Militärausgaben sollte der Gesetzgeber festlegen, musste sich aber dabei an die Friedenspräsenzstärke halten, die nur mit Zustimmung der Einzelstaaten verändert werden konnte.[27]
Bei den Ausgaben für die Kriegsmarine setzte der Reichstag durch, dass sie der Bund übernehmen sollte und nicht die Einzelstaaten als Matrikularbeiträge.[28] Gleichzeitig räumte die Verfassung dem Bund das Recht ein, eigene direkte Bundessteuern zu erheben, die sich nicht auf die Verkehrssteuern beschränkten,[29] wie dies Art. 4 Nr. 2 des Entwurfs der Regierungen vorsah.
Bundessteuern
Bismarck scheiterte mit seinem Konzept, eine staatenbündisch orientierte Finanzordnung zu schaffen. Bei einer bundesstaatlichen Finanzordnung war mit einem großen Einfluss des Reichstags zu rechnen, und den Einfluss des Reichstags wollte Bismarck so gering wie möglich halten, weil er unberechenbare Ergebnisse des allgemeinen Wahlrechts fürchtete. Nationalliberale Abgeordnete konnten konservative Abgeordnete dafür gewinnen, dem Bund ein nicht auf bestimmte Steuerarten beschränktes Steuerrecht zu gewähren. Aber es gab dafür nur eine denkbar knappe Mehrheit von 125: 122 Stimmen.
Schlussabstimmung über den Gesamtentwurf
Am 16. April 1867 stimmte der konstituierende Reichstag über den überarbeiteten Gesamtentwurf ab. August Bebel, der spätere Mitbegründer der Sozialdemokratie, lehnte den Entwurf ab, weil er die Freiheit der Nation an die preußische Militärmonarchie verkaufe.[30] Die Linksliberalen hielten den Entwurf für völlig verfehlt, weil er weder Grundrechte noch eine Bundesregierung mit verantwortlichen Ministern vorsehe.[31] Die Nationalliberalen hielten den Entwurf für nicht befriedigend, aber für entwicklungsfähig.[32] Die Konservativen hielten das allgemeine Wahlrecht für gefährlich, aber meinten, diese Lösung sei nicht mehr zu umgehen.[33] Das gemeinsame Abstimmungsverhalten von Konservativen und Nationalliberalen führte dazu, dass eine breite Mehrheit von 230: 53 Stimmen den Gesamtentwurf annahm.[34]
Der Beitritt der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund
Nach der französischen Kriegserklärung vom 19. Juli 1870 forderte die Öffentlichkeit die Vereinigung aller deutscher Staaten.[35] In Baden wollten Bevölkerung, Landtag und der Präsident des Staatsministeriums, Julius Jolly, dem Norddeutschen Bund beitreten.[36]
Die hessische Regierung hoffte auf eine großdeutsche Lösung mit Hilfe Österreichs.[37] Die württembergische Regierung lehnte einen Beitritt zunächst ab. Der Präsident des Staatsministeriums, von Varnbüler, und König Karl konnten sich eine Unterordnung unter die Hohenzollern nur schwer vorstellen und Königin Olga, eine russische Zarentochter, gar nicht.[38]
Die bayrische Regierung wollte dem Norddeutschen Bund nicht beitreten, sondern mit ihm einen Staatenbund bilden, und nur im Kriegsfalle das bayrische Heer dem Oberbefehl des Königs von Preußen unterstellen.[39] Der Bundeskanzler und preußische Ministerpräsident erteilte diesem Modell eine Absage und machte stattdessen den ihre Souveränität verlierenden Bayern und Württemberg Zugeständnisse, die nicht gering wogen, aber ihnen auch keine realen Machtvorteile beließen.[40] Zwischen dem 15. und 25. November 1870 traten die süddeutschen Staaten dem norddeutschen Bund bei.[41] Nach ihrem Beitritt wurden die bisherigen Texte überarbeitet und angepasst, und als Verfassungs-Urkunde für das Deutsche Reich als Reichsgesetz beschlossen. Zwei wichtige Änderungen gegenüber der Verfassung des norddeutschen Bundes waren, dass der Bundesrat Rechtsverordnungen erlassen konnte.[42] Außerdem durfte der Bundesrat über das Vorhandensein von Mängeln und ihre Beseitigung beschließen, die der Kaiser bei Überwachung der Ausführung der Bundesgesetze festgestellt hatte.[43]
Gründe für die Entwicklung des Bundes zum Kaiserreich

Auf Betreiben Bismarcks sollte es nach Beitritt der süddeutschen Staaten wie in der gescheiterten Verfassung von 1849 einen Kaiser geben. Die hochadligen Souveräne der Einzelstaaten erklärten sich damit einverstanden, dass „die Ausübung der Präsidialrechte des Bundes mit der Führung des Titels eines deutschen Kaisers verbunden werde.“ Bismarck verlas als preußischer Ministerpräsident eine darauf abgestimmte Erklärung, dass der König von Preußen „die Würde übernehme.“[44] Mit den aufeinander abgestimmten Erklärungen sollten zwei Ziele verfolgt werden. Es sollte den einzelstaatlichen Monarchen die Abgabe eines Teils ihrer Souveränität an den König von Preußen leichter gemacht werden. Zweites Ziel war, dass ein Fürstenbund zum Gründungsmythos des erweiterten Nationalstaats werden sollte.[45] In Wirklichkeit war das Deutsche Reich durch Beitrittsverträge vor der Kaiserproklamation entstanden.[46] Dennoch wurde die Legende zur festen Realität des Kaiserreiches.[47] Mit ihr sollte verhindert werden, dass eine Reichsmonarchie entsteht, die den Wunsch nach einer Kontrolle durch den Reichstag ausgelöst hätte.[48] Die Verfassung teilte dem Kaiser einige Kompetenzen eines Staatsoberhaupts zu, machte ihn aber nicht zum Träger der Souveränität des Bundes.[49] Kollektiver Träger der Souveränität waren die im Bundesrat vereinigten Vertreter der Einzelstaaten und die Senate der drei freien Städte.[50][51]
Die Entwicklung des Verfassungsrechts im Kaiserreich
Entstehen einer Reichsmonarchie
Die Regulierungsaufgaben des Reichs vermehrten sich mit der stürmischen Industrialisierung und beim Entstehen eines einheitlichen Verkehrs- und Wirtschaftsraumes. Die Aufgaben betrafen das gesamte Reichsgebiet und mussten zwangsläufig vom Reichstag und von Reichsbehörden erledigt werden. Deshalb fächerte sich das Reichskanzleramt auf, zunächst in neun einzelne oberste Reichsbehörden unter der Leitung eines Staatssekretärs.[52] Den obersten Reichsbehörden wurden zentrale Verwaltungsbehörden nachgeordnet. Das Reichsinnenamt hatte 1880 elf nachgeordnete Behörden; sieben weitere kamen später hinzu.[53] Es entstand eine im Verfassungstext nicht erwähnte Reichsministerialbürokratie.
Die Gesetzesanträge, die die obersten Reichsbehörden dem Bundesrat vorlegen mussten, konnten sie nicht selbst einreichen. Zunächst bedienten sie sich der 17 preußischen Bundesratsbevollmächtigten, die die Gesetzesanträge übernahmen und hierzu auch berechtigt waren. Dieses Verfahren setzte voraus, dass ein förmlich ausgedrücktes Einverständnis Preußens eingeholt werden musste, und der jeweilige Bundesratsbevollmächtigte gleichlautend instruiert sein musste. Ab Mitte der 1870er-Jahre wurde das umständliche Verfahren abgekürzt und die Vorlagen vom Reichskanzler im Namen des Kaisers beim Bundesrat eingereicht. Bismarck argumentierte, dass im Reichsinteresse auch Vorlagen in den Bundesrat eingebracht werden müssten, die Preußen ablehnte.[54] Ab 1883 sollte Bismarck wieder umgekehrt denken.[55] Durch das Initiativrecht des Kanzlers wurde der Kaiser nahe an die Rolle eines Reichsmonarchen herangerückt.[56] Dennoch wurde der König von Preußen nicht zum Reichsmonarchen. Eigene Kompetenzen in der Gesetzgebung sprach ihm nämlich die Verfassung nicht zu. Bismarck vermutete 1866, dass die künftigen Einzelstaaten einen Primus inter pares akzeptieren würden, ein Reichsoberhaupt aber nicht.[57] Diskutiert wurde eine kurze Zeitlang, ob der Kaiser im Reich die Ausfertigung und Verkündung eines Gesetzes aus inhaltlichen Gründen aufhalten konnte, wie er es bei preußischen Gesetzen tun konnte. Unbestritten war dieses Recht bei leicht erkennbaren Verfahrensfehlern, aber ein inhaltliches Prüfungsrecht hatte der Kaiser nicht. Kaiser Wilhelm II. stellte dies in seiner von Bismarck gegengezeichneten Thronrede klar.[58] Die Machterweiterung des Kaiseramtes war schon abgeschlossen, bevor Kaiser Wilhelm II. den Versuch unternahm, ein [[persönliches Regiment]] zu errichten.[59]
Der Funktionswandel des Bundesrats
Zu den ständigen Aufgaben des Bundesrates gehörte es, Gesetzesvorlagen des Bundeskanzlers, später Reichskanzlers, zu beschließen. Mitglieder des Bundesrates und von ihnen ernannte Sachbearbeiter, genannt Commissarien, sollten die Gesetze vor dem Reichstag vertreten. Seit 1871 gehörte zu den Aufgaben des Bundesrates auch, Rechtsverordnungen und andere Vorschriften zur Ausführung der Reichsgesetze zu erlassen. Außerdem war der Bundesrat zuständig für die Feststellung und Abhilfe von Mängeln bei der Ausführung von Reichsgesetzen, die die kaiserliche Reichsverwaltung an ihn herantrug.
Bismarck sah nur einen Bundesrat vor, aber nicht eine Bundesregierung, die den Reichstag dazu herausgefordert hätte, sie zu kontrollieren. Es mussten aber Gesetzentwürfe und Begründungen erstellt werden, und es musste auch praktische Regierungsarbeit geleistet werden. Deshalb war Bismarck 1866 der Ansicht, dass der Bundesrat die Rolle einer Regierungsbank mit 43 Plätzen einnehmen könne.[60] Den Sachverstand für die Gesetzgebung sollten vorwiegend die 17 Bundesratsbevollmächtigten Preußens mitbringen. Diese Rechnung Bismarcks ging nicht auf, weil die Bundesratsbevollmächtigten erst ihre Stimme abgeben durften, nachdem ihre Heimatregierungen nach ihren jeweiligen Regeln vor der Stimmabgabe eingewilligt hatten.[61] Der Bundesrat konnte also auf neue Erkenntnisse nicht unmittelbar reagieren und war deshalb zu schwerfällig für das Tagesgeschäft einer Regierung. Die andere Erwartung Bismarcks trat aber ein: Auf den Sachverstand der 17 preußischen Bundesratsbevollmächtigten bei der Vertretung der Gesetzentwürfe vor dem Bundesrat und dem Reichstag konnte das Reichskanzleramt nicht verzichten. Bald stellte sich heraus, dass auch 17 Bevollmächtigte nicht ausreichten, um die Fachfragen in Bundesrat und Reichstag erörtern zu können. Daher konnten beliebig viele stellvertretende Bundesratsbevollmächtigte bestellt werden, die zwar nicht abstimmen konnten, aber im Bundestag und im Reichstag Rederecht hatten.[62] Da Reichsgesetze zu vertreten waren, wurden als preußische Bevollmächtigte und Stellvertreter eher Vertreter der obersten Reichsämter bestellt, als Regierungsangehörige und Beamte Preußens.[63]
Abstimmungsverhalten der Mittel- und Kleinstaaten
Preußische Interessen gerieten aber nicht ins Hintertreffen, weil es Preußen gelang, sich im Bundesrat eine stabile Gefolgschaft zu schaffen. Zu ihr gehörten die thüringischen Kleinstaaten, die vom Wohlwollen der preußischen Präsidialmacht abhängig waren. Sie waren darauf angewiesen, dass die Matrikularbeiträge für das Heer erträglich blieben, dass bestehende Garnisonen nicht verlegt wurden, und dass Eisenbahnen auf den von den Einzelstaaten gewünschten Trassen gebaut wurden.[64] Scherzhaft nannte der langjährige preußische Bundesratsbevollmächtigte, Adolf Wermuth, den Versuch einzelner Staaten, Preußen im Bundesrat zu überstimmen, eine Todsünde 2. Grades.[65] Im Gegenzuge war die Reichsleitung, die die preußische Bundesratsbank besetzte, im Vorfeld bemüht, Einstimmigkeit unter den Regierungen herzustellen.[66] Damit sollte die Legende und Fassade vom Fürstenbund aufrechterhalten werden.[67]
Die Verreichlichung der preußischen Bank und die Anpassung der Klein- und Mittelstaaten an die preußische Bank führten zu einer Verschmelzung des Staatenhauses mit der Verwaltung des Reichs.[68] Der Bundesrat wurde aber dadurch nicht bedeutungslos, denn er blieb Ansprechpartner des Reichstages im Gesetzgebungsverfahren, und nicht die dem Reichskanzler nachgeordneten obersten Reichsämter.[69]
Verständigung außerhalb des Bundesrates
Um Auseinandersetzungen und Verzögerungen im Bundesrat zu vermeiden, stimmte der Präsident des Bundeskanzleramtes, später Reichskanzleramts, Rudolph von Delbrück, die Gesetzentwürfe weit vor der Behandlung im Bundesrat mit den einzelstaatlichen Gesandtschaften ab. Die Bundesratsbevollmächtigten der Einzelstaaten waren in der Regel Angehörige der jeweiligen Gesandtschaften.[70] Delbrück nützte auch den Deutschen Handelstag und die Rheinschifffahrtskommission zur Verständigung.[71] In diesem nicht regulierten Rahmen entwickelte Rudolph von Delbrück Ausgleichsmechanismen, die auf dem Druck Bismarcks, der Hegemonie Preußens und der gleichzeitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der Einzelstaaten beruhte.[72] Aufwind erhielten diese Verfahren auch, weil in Bundesrat und Reichstag in den Jahren des Norddeutschen Bundes Einigkeit darüber bestand, dass die Rechtsvereinheitlichung an erster Stelle zu stehen hatte.[73] Delbrücks geräuschloses Vorgehen hatte zur Folge, dass der nichtöffentlich tagende Bundesrat kaum wahrgenommen wurde, und der Reichstag in den Vordergrund treten konnte.[74] Bald nachdem Delbrück 1876 sein Amt aufgab, wurde das System der Verständigung im Vorfeld nicht mehr weitergeführt.[75] Abstimmungen zwischen den obersten Reichsbehörden untereinander und mit den Einzelstaaten gelangen immer weniger.[76] Beim Lebensmittelgesetz kam es sogar zu einer Kampfabstimmung mit einem knappen Ergebnis.[77] Allmählich kam die Legende und Fassade vom Fürstenbund ins Bröckeln.
Versuchte Rückkehr der Vertreter der Einzelstaaten
Das Ergebnis der Reichstagswahlen 1881 war ungünstig für Bismarck. Das Zentrum wurde größte Fraktion und die linksliberale Fortschrittspartei verdoppelte ihr Ergebnis. Kaiser Wilhelm I. ging auf die 90 zu und die Altersschwäche machte sich bemerkbar. Bismarck befürchtete, dass der Reichstag ihn als Kanzler und seine ihm nachgeordneten obersten Reichsbehörden unter seine Kontrolle bringen könnte.[78] Er plante deshalb, die Regierung wie vor Delbrücks Rücktritt 1876 an den Bundesrat zurückzubringen.[79] Vor allem sollten die Präsidialanträge, also die Anträge des Reichskanzlers im Namen des Kaisers, nicht mehr gestellt werden, denn es gäbe keine Reichsregierung. Man müsse oppositionelle Abgeordnete im Reichstag davon abhalten, den Reichskanzler wegen der Präsidialanträge zu einer Reichsregierung zu stempeln. Gesetzesinitiativen sollten wieder von den Bevollmächtigten der Einzelstaaten, vor allem Preußens, vertreten werden.[80] Das Argument, dass der Reichskanzler bei einem Interessenkonflikt zwischen dem Reich und Preußen handlungsfähig sein müsse,[81] zählte nicht mehr. Bismarck hoffte, dass die Fachminister der Einzelstaaten zu Bundesratsbevollmächtigten bestellt würden, und die in ihr Fachgebiet fallenden Reichsgesetze vor dem Reichstag vertreten könnten.[82]
Die „Ministerbank mit 58 Plätzen“ scheitert
Im April 1884 schlossen sich die Fortschrittspartei und die Liberale Vereinigung zusammen. Schon im Gründungsprogramm erklärte die aus ihnen neu entstandene Deutsche Freisinnige Partei, dass die Regierung dem Reichstag verantwortlich sein müsse.[83] Bismarck veranlasste den Bundesrat zu einer Erklärung, dass die parlamentarische Kontrolle der Regierung die Rechte der Einzelstaaten vermindern würde. Die Unterwerfung der Regierung durch den Reichstag führe zum Verfall des Deutschen Reiches.[84] Die Erklärung erfolgte einstimmig, aber folgenlos, denn die Einzelstaaten schickten ihre Minister weder in den Bundesrat noch in den Reichstag.[85] Die obersten Reichsbehörden schickten nach wie vor ihre Vertreter auf die Preußische Bundesratsbank.[86] Der Bundesrat machte sich also nicht zum Gegenspieler des Reichstags, sondern der Reichstag machte sich zum Gegenspieler der obersten Reichsbehörden. So fanden die Verhandlungen zur Kompromissfindung beim Reichsversicherungsgesetz zwischen den Vertretern der obersten Reichsbehörden, die zu preußischen Bundesratsbevollmächtigten bestellt waren, und den Fraktionsvorsitzenden im Reichstag statt. Bismarck erkannte nach den Reichstagswahlen 1890, dass es dem Bundesrat nicht mehr gelingen werde, den Einfluss der obersten Reichsbehörden und des Reichstags zurückzudrängen.[87]
Verzicht auf Einstimmigkeit und Stillschweigen im Bundesrat
Seit 1867 war der Bundesrat gegenüber dem Reichstag einstimmig, manchmal in erzwungener Einstimmigkeit[88] gegenübergetreten. Über interne Abstimmungsergebnisse bewahrte der Bundesrat gegenüber dem Reichstag ein streng gehütetes Stillschweigen. Beide Traditionen beendete 1894 der württembergische Ministerpräsident Hermann von Mittnacht, weil entgegen einer Absprache eine Bundessteuer auf Wein erhoben werden sollte. Er erklärte, dass Württemberg dagegen gestimmt hätte. Die Entschiedenheit und Unberechenbarkeit des Bundesrats waren dahin. Der Staatssekretär im Reichsinnenamt stand so unter Schock, dass er aus Versehen von der „Reichsregierung“ sprach, als er den Tabubruch zu verniedlichen versuchte.[89]
Praktische Schritte des Reichstags zur parlamentarischen Verantwortlichkeit des Reichskanzlers
1908 gab Kaiser Wilhelm II. in der englischen Zeitung Daily Telegraph ein missverständliches Interview. Es stellte sich heraus, dass Reichskanzler von Bülow das Interview trotz seiner Bedeutung vor seiner Veröffentlichung nicht eigenhändig gegengezeichnet hatte. Im Reichstag begnügten sich nur die Nationalliberalen mit der Forderung nach einer Verbesserung der Ablauforganisation im Reichskanzleramt. Die Linksliberalen wiederholten ihre Forderung nach der Verantwortlichkeit des Reichskanzlers gegenüber dem Parlament. Die Sozialdemokraten verlangten gleich die komplette Abschaffung der Monarchie.[90] Als der fahrlässige von Bülow neun Monate später keine Mehrheit für eine Reichserbschaftssteuer im Reichstag fand, entließ ihn der Kaiser. Von Bülow war der erste Reichskanzler, den der Reichstag zu Fall brachte.[91]
1913 verständigten sich Sozialdemokraten, Nationalliberale und das Zentrum im Reichstag darauf, eine rechtsförmliche, nicht nur politische Kontrolle über den Reichskanzler auszuüben. Mit 293 Stimmen sprach der Reichstag dem Reichskanzler Bethmann Hollweg sein Misstrauen aus, weil er in verzögernder Absicht und zu wenig erkennbar in der Zabern-Affäre einen rechtswidrigen militärischen Eingriff in das zivile Polizeirecht rügte. Das Misstrauensvotum führte zwar nicht zur Entlassung oder zum Rücktritt des Kanzlers, wurde aber auch nicht als Versuch eines Staatsstreichs bewertet.[92]

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs verhängte der Kaiser den Kriegszustand über das Reich nach dem preußischen Gesetz[93] über den Belagerungszustand von 1851. Die vollziehende Gewalt im Reich ging auf die Militärbefehlshaber über. Die einzelstaatlichen und kommunalen Behörden hatten den Anweisungen der Militärbefehlshaber zu folgen.[94] Diese erhielten das Recht, die sieben wichtigsten Grundrechte der preußischen Verfassung außer Kraft zu setzen.[95] Das Strafrecht wurde verschärft.[96] So konnte der Gärtner Erich Lewinsohn aus Dresden 1917 wegen Antikriegspropaganda außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit zu einer Zuchthausstrafe von acht Jahren verurteilt werden. Gleichzeitig ermächtigte der Reichstag auf einer zweifelhaften Rechtsgrundlage den Bundesrat, unter Umgehung des normalen Gesetzgebungsverfahrens Notverordnungen in fast allen Lebensbereichen zu erlassen.[97] Der Bundesrat machte bis zum Kriegsende 825-mal von dieser Möglichkeit Gebrauch.[98] Der Bundesrat konnte damit fast eine Diktaturgewalt ausüben.[99] Allerdings führte dies nicht zu einer Aufwertung der Einzelstaaten, denn bei der Bestellung der Bevollmächtigten machte Preußen von der Möglichkeit Gebrauch, die ihm zustehenden 17 preußischen Plätze mit leitenden oder spezialisierten Beamten der obersten Reichsbehörden zu besetzen. Die Kleinstaaten übertrugen ihre Stimmen auf wenige Substitutionsbevollmächtigte mit Sammelmandaten.[100] Die Willensbildung fand über die preußische Bank statt, und das föderale Organ wurde mehr denn je zum Satelliten der Reichsregierung.[101] Der Kaiser trat sofort nach Kriegsausbruch seine Kommandogewalt an den Generalstabschef ab.[102] Allerdings wechselte er die Generalstabschefs zwei Mal aus.[103] Der Generalstabschef konnte unter Kriegsbedingungen politische Entscheidungen fällen. Als der Kanzler Bethmann Hollweg das preußische Dreiklassenwahlrecht reformieren wollte, sprach sich der Generalstabschef Hindenburg dagegen aus, drohte mit Rücktritt und verlangte vom Kaiser die Entlassung des Reichskanzlers. Der Reichstag warf Bethmann Hollweg die Verschleppung des demokratischen Wahlrechts vor und forderte ebenfalls vom Kaiser die Entlassung des Reichskanzlers. Bethmann Hollweg war das Vertrauen des Kaisers als Machtbasis zu gering und trat deshalb zurück. Der Reichstag konnte nach 50 Jahren der beiden Bismarckschen Verfassungen zum zweiten Mal einen Kanzler zu Fall bringen.[104] Die neu gewonnene Macht des Reichstags im Rahmen der monarchischen Verfassungen von 1867 und 1871 hielt nicht lange. Die Monarchie siechte in einem schlecht geführten Krieg noch ein Jahr dahin und ging Ende 1918 zugunsten einer Republik unter.
Zeitgenössische Staatsrechtslehre und Bismarcksche Verfassung
Die Staatsrechtslehre spielte eine bedeutende Rolle für die Anwender, denn es gab keine Verfassungsgerichtsbarkeit, die strittige Fragen hätte erörtern und entscheiden können.[105] Die Staatsrechtslehrer beschäftigten sich unter dem Eindruck des Rechtspositivismus vorwiegend mit dem Gesetzestext und damit mit dem Status quo zum Zeitpunkt der Gründung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches, aber nicht genügend mit der sich wandelnden Verfassungspraxis.[106] Prominente Staatsrechtslehrer, wie Hermann von Schulze-Gaevernitz,[107] Siegfried Brie,[108] und Paul Laband,[109] vertraten überwiegend die Auffassung, der Norddeutsche Bund und das Deutsche Reich seien ein Bundesstaat. Allerdings handle es sich dabei um einen atypischen Bundesstaat, weil eine Reichsregierung nicht vorgesehen war. Die Staatsrechtslehre trug wenig zur Sicherheit im Umgang mit der Reichsverfassung bei, weil sie sich sehr am Verfassungstext orientierte, der aber an den entscheidenden Stellen ungenau war.[110]
Streitbeilegung in verfassungsrechtlichen Streitigkeiten
Verzicht auf einen Staatsgerichtshof
Für den Bund, später das Reich, gab es keinen Staatsgerichtshof, wie ihn zwölf der 25 beitretenden Einzelstaaten hatten, hauptsächlich für die Ministeranklage. Grund war, dass der größte der beitretenden Staaten, Preußen, nicht bereit war, sich dem Urteil eines Richterkollegiums zu unterwerfen. Streitigkeiten seien zwar unvermeidlich, so die preußische Haltung, doch sie könne der Bundesrat besser entscheiden.[111] Bei den Liberalen stieß das auf Ablehnung, da sie dem Rechtsstaat anhingen. Aber Nationalliberale und Konservative waren mit Karl Friedrich von Savigny der Ansicht, Verfassungskonflikte seien von so eminenter politischer Bedeutung, dass sie von einem politischen Organ und nicht von einer unabhängigen rechtlichen Instanz entschieden werden sollten. Sie überstimmten die Liberalen mit großer Mehrheit und lehnten wie die Einzelstaaten eine Verfassungsgerichtsbarkeit ab.[112] Verfassungsstreitigkeiten konnten aus vier Konstellationen entstehen. Für die erste Fallgruppe war kein Streitbeilegungsverfahren vorgesehen: für Individualbeschwerden. Es gab keine Grundrechte des Reichs, so dass sie auch nicht verletzt werden konnten. Verfassungsstreitigkeiten waren nur solche zwischen Verfassungsorganen.[113]
Streitigkeiten zwischen Einzelstaaten und Reich
Für die Fallgruppe der Streitigkeiten zwischen Einzelstaaten und dem Reich gab es auch kein besonderes Streitbeilegungsverfahren. Den Einzelstaaten blieb wenigstens die Möglichkeit, von ihrem allgemeinen Recht Gebrauch zu machen, einen Antrag beim Bundesrat zu stellen oder einem Antrag entgegenzutreten.[114]
Als Preußen im Bundesrat den Antrag stellte, St. Pauli und Altona aus dem Hamburger Freihafengebiet herauszunehmen, und in das deutsche Zollgebiet zu überführen, beantragte Hamburg, die Streitsache an den Justizausschuss des Bundesrats zu überweisen. Hamburgs Rechte seien verletzt, weil ihm der in der Verfassung zugesagte Freihafen teilweise entzogen werden solle.[115] Bismarck erklärte im Bundesrat, dass Preußen in einem einstimmig ergangenen Kabinettsbeschluss festgestellt habe, dass die Überweisung an den Justizausschuss ihrerseits verfassungswidrig sei. Er drohte damit, dass Preußen aus dem Reich austreten werde, wie es aus dem Deutschen Bund ausgetreten sei.[116] Er wiederholte also die unzutreffende Auffassung, dass das Reich nicht durch Staatsverträge geschaffen wurde, sondern durch einen Fürstenbund, aus dem Preußen einseitig austreten kann. Eine Verwirklichung des Austritts war allerdings unwahrscheinlich.[117] Am Ende einigte man sich auf den Kompromiss, dass St. Pauli Freihafen blieb und nur Altona ins Zollgebiet kam.
Als Preußen beabsichtigte, 30.000 katholische Polen nach Österreich und Russland zu deportieren, fragte der Reichstag auf Veranlassung des katholischen Zentrums beim Reichskanzler an, ob er die preußische Regierung an diesem Vorhaben hindern werde. Der Reichskanzler belehrte den Reichstag sofort, dass Ausweisungen Sachen der Einzelstaaten seien und dass das Reich keine Kompetenzen habe, in die Rechte der Einzelstaaten einzugreifen.[118] Diese Argumentation bemühte der Reichskanzler noch einmal, als sich der Reichstag für die Beseitigung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen einsetzen wollte. Der Reichstag ließ sich wiederum belehren und lehnte es mit einer großen Mehrheit ab, sich für die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts einzusetzen.[119] Eine Minderheit war der Auffassung, man hätte die Reichsverfassung ändern können und in die innere Ordnung der Einzelstaaten eingreifen können.[120] Allerdings wäre ein Änderungsgesetz an der preußischen Sperrminorität gescheitert.[121]
Streitigkeiten zwischen den Einzelstaaten
Streitigkeiten zwischen den Einzelstaaten sollte der Bundesrat direkt erledigen.[122] Der Bundesrat griff in komplizierten Fällen zu der Möglichkeit mit dem Einverständnis der Parteien den Rechtsstreit an das Reichsgericht oder das Reichsoberhandelsgericht zu verweisen.[123] Solche Delegationen waren weder häufig noch sonderlich wirksam, zeigten aber einen Weg auf, wie doch noch ein Verfassungsgericht hätte entstehen können.
Streitigkeiten innerhalb von Einzelstaaten ohne Staatsgerichtshof
Streitigkeiten innerhalb der dreizehn Einzelstaaten, in denen es keinen Staatsgerichtshof gab, sollte entweder der Bundesrat selbst entscheiden oder gemeinsam mit dem Reichstag durch ein Reichsgesetz.[124] Streitigkeiten innerhalb der beiden mecklenburgischen Großherzogtümer hatten die seit 1850 bestehende rückständige landständische Verfassung zum Gegenstand. Die Antragsteller zielten auf eine moderne Verfassung ab. Hier lehnte es der Bundesrat ab, überhaupt tätig zu werden.[125] Er konnte dies einigermaßen schlüssig begründen: die Einzelstaaten waren dem Norddeutschen Bund mit ihren Verfassungen und ungleichen Wahlrechten so beigetreten, wie sie standen und lagen. Eine Kompetenz des Bundes, in die innere Ordnung der Einzelstaaten einzugreifen, war nicht gegeben.[126] Auch hätte es sich um eine Altstreitigkeit gehandelt, auf die sich die neu eingeführte Streitregelungskompetenz nicht erstreckt hätte. Bei der Neuvereinbarung internationaler Gerichte werden auch heute noch Altfälle nicht erfasst, sondern nur Fälle, die nach Abschluss der Vereinbarung eingetreten sind.[127] In politischer Hinsicht wollte Bismarck die Machtverteilung zwischen Monarchie und Parlament über die Grenzen der Mecklenburger Großherzogtümer hinaus im Zustand des Jahres 1867 belassen.[128]
Die Streitbeilegungsmechanismen waren sehr flexibel, aber schwach. Teilweise wiesen sie in die Zukunft, möglicherweise auf eine staatsgerichtliche Abteilung des Reichsgerichts. Allerdings konnten die restriktiven Verfahren Konflikte nicht beenden und für die Zukunft sicher verhüten. Zudem vermieden sie es, den oft unklaren Verfassungstext verbindlich zu interpretieren und auf diese Weise Rechtssicherheit zu schaffen. So setzte sich bei der Streitbeilegung im Bundesrat oft der Grundsatz „Macht vor Recht“ durch.[129]
Unterschiedliche Formen des Föderalismus
In den Vereinigten Staaten wurden die Bundesstaaten und ihre stark ausgebauten Rechte als Sicherung gegen unrechtmäßige Übergriffe der Zentralgewalt verstanden.[130]
In der Schweiz hatten die Kantone schon die Alte Eidgenossenschaft geprägt, und der 1848 geschaffene Bundesstaat knüpfte an föderale Traditionen an.[131] In beiden Staaten ist die Wertschätzung des Föderalismus hoch.
Nur im Norddeutschen Bund und später im Deutschen Reich gab es eine Hegemonialmacht. Diese gestaltete große Teile der Verfassung des Zentralstaats durch ihren Ministerpräsidenten Bismarck selbst.[132] Nur im Deutschen Reich gab es Monarchen. Der Gegensatz zwischen monarchischen und parlamentarischen Kräften bestimmte das politische Handeln. Beide Kräfte maßen der bundesstaatlichen Ordnung keinen nennenswerten Eigenwert zu.[133] Den Kollaps des Deutschen Reiches ab 1917 hatte das monarchische Element zu vertreten, also der Kaiser als Bundesfeldherr mit der von ihm bevollmächtigten Obersten Heeresleitung.[134]
Nutzung einzelner Beobachtungen für die Zukunft der Europäischen Union
Die föderalen Strukturen der Europäischen Union stehen von innen und außen unter Druck. Bedeutsame Faktoren sind der Brexit, die russische Kriegspolitik, unterschiedliche Einstellungen der Mitgliedstaaten zur Rechtsstaatlichkeit und zur Geldpolitik, und die Hinwendung der Vereinigten Staaten zum Isolationismus.[135] Die Europäische Union muss deshalb ihre Rolle in Europa und in der ganzen Welt neu definieren.[136] Aus dem Schicksal der Bismarckschen Reichsverfassung lassen sich für die Zukunft folgende Erkenntnisse gewinnen:
Es darf keine Hegemonialmacht geben; das wirtschaftliche Übergewicht Deutschlands darf nicht hierzu führen.[137] Die Europäische Union muss einen eigenen Ministerialapparat bekommen.[138] Die Kommission sollte zu einer Regierung weiterentwickelt werden[139] und dem Parlament der Europäischen Union verantwortlich werden.[140] Die Regierungen der Mitgliedstaaten sollten nur noch in einem Staatenhaus mitspracheberechtigt sein.[141] Es fehlt in der Europäischen Union an einem klaren Machtzentrum; die Europäische Union braucht deshalb eine Verfassung, die auch den ausufernden Brüsseler Zentralismus bekämpft.[142] Sie sollte klären, ob es sich um einen Staatenbund oder einen Bundesstaat handeln soll.[143] Einem Bundesstaat wäre der Vorzug zu geben. Es sollte aber kein alles regelnder Superstaat geschaffen werden, sondern er sollte sich auf Felder konzentrieren, die kleinere Staaten nicht mehr allein regeln können.[144] Eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten sollte nicht stattfinden. Stattdessen sollte ein stabileres und faireres Gleichgewicht zwischen den Organen eingerichtet werden.[145] Es braucht einen vollwertigen europäischen Verfassungsgerichtshof.[146] Unverzichtbar ist, dass die Bürger der Europäischen Union den Wert des Föderalismus erkennen und schätzen.[147]
Rezeption
Rezensionen
Lennart Bohnenkamp
Gut dargestellt ist, dass die Schwachstellen der Reichsverfassung besonders deutlich bei den Konfliktfällen hervortreten, weil diese weder vom Verfahren noch vom Ergebnis her verfassungskonform gelöst wurden. Konkurrierende Verfassungsvorstellungen der Einzelstaaten bei der Entwicklung des Verfassungstexts sind nicht erwähnt. Haardt widerspricht ausdrücklich der Ansicht Hans-Ulrich Wehlers, wonach das auf Polykratie beruhende Regierungssystem krisengeschüttelt in die Sackgasse geraten sei. Nach Haardt ist das Entscheidungssystem zwischen Reichskanzler, Reichstag, Bundesrat und Kaiser eingespielt und stabil gewesen. Das oft behauptete Aufgehen Preußens im Reich geschah nicht gegen den preußischen Willen. Bis 1914 instruierte nämlich das preußische Staatsministerium die preußischen Bundesratsbevollmächtigten, auch wenn sie Belange des Reichs im Bundesrat zu vertreten hatten. Dass die über 30 Unterkapitel im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt sind, erschwert die Orientierung im Text und das Auffinden der Fußnoten.[148]
Hartwin Spenkuch
Der Reichstag war keine Handlungseinheit. Er war von vielfältigen politischen und sozialen Fronten durchzogen. Um seine Bedeutung zu erfassen, müssen Parteien, Wahlkämpfe und gesellschaftliche Milieus berücksichtigt werden. Die Außenpolitik wurde in Berlin geheim betrieben und nur offengelegt, wenn in die Reichsgesetzgebung eingegriffen wurde. Das oft behauptete Aufgehen Preußens im Reich war auch davon geprägt, dass 80 % der Spitzenbeamten des Reichs aus Preußen stammten.[149]
Dieter Langewiesche
Die Reichsverfassung besaß kein festes Grundgerüst. Sie war eine regelungsschwache Plattform für den Machtwettbewerb der Institutionen. Sie war flexibel und zugleich schwer berechenbar. Glanzstück des Buches ist die Beschreibung der Übernahme der preußischen Bundesratsbank. Das Regierungssystem war entwicklungsfähig, hat aber seine Entwicklung durch Eintritt in den Ersten Weltkrieg beendet. Für eine Gesamtdarstellung des Verfassungsgefüges ist zusätzlich die Rolle der Einzelstaaten und der Kommunen wichtig.[150]
Frederik Frank Sterkenburgh
Die Reichsverfassung fror den Zustand des Jahres 1866 im „Ewigen Bund“ ein, wies aber nicht in eine bestimmte Richtung oder auf ein bestimmtes Ziel. Die Staatsrechtslehrer füllten diese Lücke nicht, denn sie formulierten keine Zukunftsvision für das Reich und beließen es bei einer wortlautgetreuen Interpretation des Verfassungstexts. Bismarcks ewiger Bund wird als Handbuch der deutschen Föderalismusdebatte seinen Platz einnehmen. Sterkenburgh empfiehlt eine englische Übersetzung mit einer strafferen Gliederung und Kürzungen zugunsten der Schwerpunkte.[151]
Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestags
Haardt erhielt 1923 den Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestags, weil er mit Bismarcks ewigem Bund eine neue Herangehensweise verfolgt hat, indem er die Entwicklung des Bundesrates in den Vordergrund gerückt hat. Haardt leistete mit seinem Werk einen bedeutenden und innovativen Beitrag zur Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Durch seine Arbeit wurde das Verständnis von Parlamentarisierungsprozessen politischer Systeme erweitert.[152]
Literatur
- Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020,
- Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart und Berlin, Neuausgabe 1928.
- Otto von Bismarck/Friedrich Thimme: Die gesammelten Werke, Band 6a, Berlin 1930.
- Jost Dülffer: Deutschland als Kaiserreich. In: Martin Vogt (Hrsg.): Deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3. Auflage, Frankfurt am Main 2006, S. 517–615.
- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III: Bismarck und das Reich, 3. Auflage, Stuttgart 1988.
- Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, München 1995.
Einzelnachweise
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 204
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 210
- ↑ Art. 78 NBV
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 211
- ↑ Art 3 NBV
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 210.
- ↑ Art. 4 Nr. 8 NBV
- ↑ Art. 44, 45 NBV
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 213.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 242.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 243.
- ↑ Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart und Berlin, Neuausgabe 1928, S. 381.
- ↑ Art. 26 NBV
- ↑ Art. 25 NBV
- ↑ Art. 26 NBV
- ↑ Art. 31 NBV
- ↑ Art. 22 Absatz 2 NBV
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 231.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 231
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 151.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 256f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 258.
- ↑ Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, München 1995, S. 315.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 236.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 237.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 239.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 241.
- ↑ Art. 53 Abs. 3 NBV
- ↑ Art. 4 Nr. 2 NBV
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 261.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 264.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 264.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 262.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 261.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 160
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 157.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 158.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 159.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 162.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 170.
- ↑ Jost Dülffer: Deutschland als Kaiserreich. In: Martin Vogt (Hrsg.): Deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3. Auflage, Frankfurt am Main 2006, S. 517–615, [517.]
- ↑ Art. 7 Absatz 2 RV 1871
- ↑ Art. 7 Absatz 3 Satz 1 und Art. 17 Satz 1 RV 1871
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 177.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 176ff.
- ↑ Jost Dülffer: Deutschland als Kaiserreich. In: Martin Vogt (Hrsg.): Deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3. Auflage, Frankfurt am Main 2006, S. 517–615,[517].
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 179.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 179.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 293.
- ↑ Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III: Bismarck und das Reich, 3. Auflage, Stuttgart 1988, S. 791.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 305f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 314f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 433 und 459.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 320.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 450.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 321.
- ↑ Putbuser Diktat vom 19. November 1866 in: Otto von Bismarck/Friedrich Thimme: Die gesammelten Werke, Band 6a, Berlin 1930, S. 168–170, Urkunde Nr. 616.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 328.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 329.
- ↑ Putbuser Diktat vom 19. November 1966, Otto von Bismarck/Friedrich Thimme: Die gesammelten Werke, Band 6a, Berlin 1930, S. 168–170, Urkunde Nr. 616.
- ↑ Art. 17 Absatz 3 Satz 4 RV 1871
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, s. 367.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 370.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 382.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 383
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 383
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 383.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 385 wie Paul Laband: Der Bundesrat, JZ 1 [1911] Spalte 1–9
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 388.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 415.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 416.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 417.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 419.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 427.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 437.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 439.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 442.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 448
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 449.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 449.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 320.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 458.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 454.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 455.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 458.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 460.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 476.
- ↑ entgegen Art. 9 Satz 1 RV 1871
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 494.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 516.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 517.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 766.
- ↑ Art. 68 Satz 2 RV 1871
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 547.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 549.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 549.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 550.
- ↑ Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 555.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 552.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 555.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 555.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 559.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 560.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 560.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 692.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 737f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 698.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 699.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 706.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 726f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 614ff.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 618f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 630.
- ↑ Art. 7 Absatz 3 Satz 2 RV 1871
- ↑ Art. 34 RV 1871
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 679–681.
- ↑ Huber, Verfassungsgeschichte, Band 4 S. 225f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 642–646.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 649.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 650.
- ↑ Art. 78 Absatz 1 Satz 2 RV 1871
- ↑ Art. 76 Abs. 1 RV 1871
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 636f.
- ↑ Art. 76 Absatz 2 RV 1871
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 630–632.
- ↑ anders heute Art. 28 Absatz 1 Satz 1 GG
- ↑ Internationaler Gerichtshof: Liechtenstein gegen Deutschland, Urteil vom 10. Februar 2005, Allgemeine Liste Nr. 123, S. 21 f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 633.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 671.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 806.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 807.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 809
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 806.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 823.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 849.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 849.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 850f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 851.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 851.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 854.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 851.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 851f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 852.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 856.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 852.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 852f.
- ↑ Oliver Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Darmstadt 2020, S. 855.
- ↑ Lennart Bohnenkamp, Rezension zu: Haardt, Oliver: Bismarcks ewiger Bund. Eine neue Geschichte des Deutschen Kaiserreichs. Darmstadt 2020, ISBN 978-3-8062-41-792, In: H-Soz-Kult, 09.07.2021, hsozkult.de
- ↑ Hartwin Spenkuch: Rezension von: Oliver F.R. Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Eine neue Geschichte des Deutschen Kaiserreichs, Darmstadt: wbg Theiss 2020, in: sehepunkte 21 (2021), Nr. 7/8 [15.07.2021], sehepunkte.de
- ↑ Dieter Langewiesche: Der ruhelose Staat sueddeutsche.de
- ↑ Frederik Frank Sterkenburgh, Bismarcks ewiger Bund: Eine neue Geschichte des Kaiserreichs, by Oliver F.R. Haardt, The English Historical Review, Volume 137, Issue 585, April 2022, Pages 623–626, doi:10.1093/ehr/ceac022
- ↑ Pressemitteilung des Deutschen Bundestags bundestag.de