„Wikipedia:Auskunft/alt37“ – Versionsunterschied
Janka (Diskussion | Beiträge) |
Sunks (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 883: | Zeile 883: | ||
:Vielleicht sollte man, um den ESC zu verstehen, auch darauf schauen, wer so hinter den Kulissen des ESC mitverdient. Mir fallen da (bezogen auf Deutschland) als Lektürevorschlag zum Beispiel die Artikel [[Ralph Siegel]] und [[Stefan Raab]] ein. Wäre ja interessant, mal zu untersuchen, ob es in anderen Ländern auch Produzenten mit einem gewissen Schwerpunkt auf diesem Geschäftsfeld gibt. --[[Spezial:Beiträge/87.151.175.97|87.151.175.97]] 18:39, 9. Jun. 2014 (CEST) |
:Vielleicht sollte man, um den ESC zu verstehen, auch darauf schauen, wer so hinter den Kulissen des ESC mitverdient. Mir fallen da (bezogen auf Deutschland) als Lektürevorschlag zum Beispiel die Artikel [[Ralph Siegel]] und [[Stefan Raab]] ein. Wäre ja interessant, mal zu untersuchen, ob es in anderen Ländern auch Produzenten mit einem gewissen Schwerpunkt auf diesem Geschäftsfeld gibt. --[[Spezial:Beiträge/87.151.175.97|87.151.175.97]] 18:39, 9. Jun. 2014 (CEST) |
||
::Der NDR hat die Zusammenarbeit mit [[Brainpool]], Raabs Firma, weitgehend eingestellt und Ralph Siegel hat dieses Jahr das Lied für San Marino geschrieben, das auf dem drittletzten Platz landete. --[[user:Rotkaeppchen68|R<span style="color:red">ô</span>tkæppchen₆₈]] 18:51, 9. Jun. 2014 (CEST) |
::Der NDR hat die Zusammenarbeit mit [[Brainpool]], Raabs Firma, weitgehend eingestellt und Ralph Siegel hat dieses Jahr das Lied für San Marino geschrieben, das auf dem drittletzten Platz landete. --[[user:Rotkaeppchen68|R<span style="color:red">ô</span>tkæppchen₆₈]] 18:51, 9. Jun. 2014 (CEST) |
||
Die Erklärung für den Sieg von Conchita Wurst beim ESC ist ganz einfach und hat nichts mit der Musik zu tun: Seit Jahren ist der ESC ein ganz großes Ding in der Schwulen- und Lesbenszene, und die haben eben für C. Wurst gestimmt. --[[Benutzer:Sunks|Sunks]] ([[Benutzer Diskussion:Sunks|Diskussion]]) 00:05, 11. Jun. 2014 (CEST) |
|||
== Person gesucht, Schreibfehler in der Geburtsurkunde == |
== Person gesucht, Schreibfehler in der Geburtsurkunde == |
||
Version vom 11. Juni 2014, 00:05 Uhr
Wikipedia:Auskunft/alt37/Intro
Fehler bei Vorlage (Vorlage:Autoarchiv-Erledigt): Bei "Zeigen=Nein" können die Parameter Übersicht, aktuelles Archiv und Icon nicht angegeben werden.
29. Mai 2014
Wie helfen?
Guten Abend, versuche mich kurz zu fassen. (Entschuldigt die fast durchgehende Kleinschreibung) Einer sehr vertrauten Person (Mitte 30) von mir sollte man den Kopf waschen. Leider bin ich der einzige, der irgendwie Zugang zu ihm hat, deswegen fühle ich mich schon etwas verantwortlich, und kann auch die Trauer seiner Eltern über ihn kaum ertragen.
Er hatte nie Freunde; nie eine Freundin (sehnt sich aber danach) und wohnt noch zu Hause (Die eltern meinen, bei einem rausschmiss würde er komplett untergehen). Die Arbeit bei der Post, die ihm Spaß macht, zwei schachteln zigaretten, zwei liter red bull und zwei liter cola am tag sind sein leben. (sein talent als super keyboardspieler beachtet er nicht.) Er hat ein super gutes Herz, ist leichtgläubig; die Medien haben leichtes spiel mit ihm. Hin und wieder beim psychologogen auf druck der mutter. Nichts gebracht. Irgendwelche Supercoaches meinen, sie zu ihnen zu schicken bringt nur was, wenn man selber möchte. er möchte nicht. er ist nicht glücklich. seine eltern noch unglücklicher. Arztdiagnose: Situationsangst. Meine Fragen: Wie kann ich helfen? Was können seine Eltern tun, um ihm zu helfen? Danke --Tronkenburger (Diskussion) 22:44, 29. Mai 2014 (CEST)
- Müssen denn immer alle glücklich sein? Ist ja praktisch eine Glücksdiktatur, die da herrscht! Wirklich, mit zwei Litern Red Bull plus zwei Litern Cola am Tag kann der Mann gar nicht unglücklich sein, höchstens völlig überreizt. Und zitterig wie blöde, wenn er die Zigaretten absetzt. Aber darum geht es hier ja sowieso nicht. Es geht darum, dass der Kerl in seiner Umgebung "irgendwie stört". Seine Mutti ist der Meinung. Du siehst das genauso. Ihr macht also euer Problem mit ihm zu seinem Problem. Das ist grundfalsch, darüber solltet ihr mal mit dem Psychologen sprechen.
- Unabhängig davon kann man ihn natürlich dennoch vor die Tür setzen, der kommt schon zurecht, hat ja nen sicheren Job. Eventuelle Sorgen sollten Mutti und du auch wieder mit eurem Psychologen besprechen. -- Janka (Diskussion) 23:00, 29. Mai 2014 (CEST)
- Die "Supercoaches" haben schon recht: Wer sich nicht helfen lassen will, dem ist erstmal nicht zu helfen. Das Einmauern im Unglück ist eine (problematische) Methode, vermeintlich noch größeres Unglück zu vermeiden, also eine Strategie vom Register "Trick 17 mit Selbstüberlistung". Wie Du helfen kannst? Indem Du ihm das Gefühl gibt, dass er nicht allein ist... Klingt furchtbar banal, ist aber für einen, der sich vermutlich genauso fühlt, schon sehr viel wert! 188.109.211.17 23:19, 29. Mai 2014 (CEST)
- Du schreibst „Die Arbeit bei der Post, die ihm Spaß macht“ , das ist schon mal ein gutes Zeichen. Warum macht sie ihm Spass? Da ansetzen und den Spassfaktor versuchen ins private hinüber zu nehmen. Aber prinzipiell man kann eine Person auch zu fest umsorgen. In Ruhe lassen aber zu erkennen geben das er zu einem kommen kann ist oft der bessere Weg. Es wäre nicht die erste Person, die es überleben wenn sie von Zuhause ausziehen. Es gibt es sehr oft, dass die verschlossenen Personen denen Mutti nichts zutraut, kaum das sind sie aus dem Haus sind regelrecht auf-blühen. Dazu braucht meist nicht mal viel, sondern nur jemand denen sie sich anvertrauen können. Weil frag ihn mal wirklich alleine, und auch ohne es danach Mutti zu erzählen!, ob er gerne von Zuhause ausziehen möchte. Manchmal braucht jemand nur den sanften Anstoss, in dem man ihm hilft eine geneigte Wohnung/Zimmer zu finden. Die andere Alternative wäre Wochenaufenthalter, verbunden mit einem temporären Stellenwechsel im Betrieb (wenn Post den stimmt, sollte das möglich sein). Luftveränderung soll schon des öfteren Wunder gewirkt haben. --Bobo11 (Diskussion) 00:01, 30. Mai 2014 (CEST)
- Zurück zum Problem.
- Ja, da kann man was machen. Dazu ist aber jemand nötig, der bereit ist, sehr sehr viel für diesen Menschen zu tun. Ob du, Tronkenburger, der Freund bist, der ihm helfen kann, weiß ich natürlich nicht. Der Freund (nennen wir ihn mal so, denjenigen, der hier helfen möchte - wobei es auch mehrere Leute sein können) braucht etliche Resourcen und die Bereitschaft, diese einzusetzen. Diese Resourcen sind eventuell auch ein bisschen Geld, vor allem aber viel Zeit und Organisationstalent und Geduld und seinerseits ein paar echte Freunde.
- Freund soll bitte um Himmels willen nicht die Mutter mit reinziehen; die darf gar nichts erfahren.
- Was braucht unser (nennen wir ihn mal) Problemling? Dass er bei Muttern wohnt, ist nicht toll, aber nicht das echte Problem. Er braucht das Gefühl, von Anderen gewollt zu werden, anerkannt zu werden, mit diesen Anderen angenehm umgehen zu können. Woher aber soll das kommen, so von Null auf?
- Eben diese Situation muss Freund künstlich schaffen. Dass Problemling ein Talent hat, nämlich gut Keyboard spielt, ist eine große Chance. Freund muss nun die Situation schaffen, in der Problemling Keyboard spielt. Da sehe ich mal spontan zwei Möglichkeiten:
- A - Freund bittet ihn, als Aushilfe wg Notfall für eine Gruppe von Freunden zu spielen (was, kommt drauf an, zum Zuhören oder zum Tanzen, kommt auch drauf an). Der eigentlich vorgesehene Keyboarder liegt plötzlich im Krankenhaus (nein, bitte ihn nicht wg Realismus dorthin prügeln - man muss auch mal lügen können).
- B - eine Band oder Gruppe oder auch nur ein Duo hat (fiktiv) das gleiche Problem: Der Originalkeyboarder ist weg, dringend wird Ersatz gebraucht für einen vorgesehenen Auftritt o.ä.
- In beiden Fällen zwingt Freund ihn geradezu, in beiden Fällen kann Problemling zeigen, was er kann, eventuell auch mehrmals. In beiden Fällen wird Problemling echte (!) Anerkennung bekommen, von den Zuhörern oder von den Musikerkollegen oder von beiden. Das ist ganz wichtig! Wenn alles gut geht, geht die Anerkennung nahtlos in ein Bier im netten gemeinsamen Kreise über.
- Insgesamt gilt die "Methode" auch für Nicht-Keyboarder. Problemling muss unter Vorspiegelung eines Notstandes dazu gezwungen werden, etwas für Andere zu tun. Das kann runtergehen bis zu sehr einfachen Tätigkeiten, hundert Zwiebeln für den Freundeskreis schälen, drei Stunden lang den Grill anfachen, beim Renovieren helfen oder beim Umzug oder was auch immer. In jedem Fall werden die Anderen (und Nutznießer) die Tätigkeit anerkennen und mit ihm reden. Wenn er kein ganz schwerer Fall ist, wird er das angenehm bemerken und den Umgang vielleicht weiterführen. Freund hat dabei Geduld, es geht um kleine erste Schritte, nicht darum, sofort zu Hause auszuziehen, sofort eine Freundin zu finden o.ä.
- Alles klar? Hummelhum (Diskussion) 00:44, 30. Mai 2014 (CEST)
N'abend!
Bei dem beschriebenen "Problembild" fallen mir ein paar Sachen auf, die mich in eine bestimmte Richtung denken lassen:
- hatte nie Freunde - hatte nie eine Freundin
und zumindest teilweise:
- hat ein super gutes Herz und - ist leichtgläubig
Ist er schonmal in Richtung Asperger-Syndrom diagnostiziert worden? Auch wenn er schon mehrmals bei Psychologen war, sind diese (zumindest teilweise) auf diesem Auge leider noch etwas blind. Das soll jetzt keine Ferndiagnose sein, sondern nur ein Denkanstoss. In diesem Zusammenhang sollte man dann bei der von Hummelhum empfohlenen Vorgehensweise des "sanften Zwangs", sich in die Gesellschaft mehr einzubringen, vorsichtig sein - das kann bei Aspergern böse schiefgehen.
Wie gesagt, nur eine Idee zu später Stunde...84.173.198.96 01:29, 30. Mai 2014 (CEST)
- Ich denke, die OP-Aussage "super gutes Herz" kommt nicht von ungefähr und genau auf dieser Schiene wurden die bisherigen Fehlversuche getragen, den Mann zu irgendeiner Teilnahme an "Gemeinschaftserlebnissen" zu bewegen. So denken extravertierte Menschen, bei einem introvertierten Menschen wird das nicht funktionieren. Für den ist das einfach Arbeit. Lächeln zu müssen, Lob und Umarmungen zu ertragen ist Arbeit. Zuhören und Nicken ist Arbeit. Die wird er nur aus der Überlegung heraus tun, sich damit den Lohn zu erarbeiten, wieder wochenlang im Loch verschwinden zu dürfen und keiner meckert. Schon gar nicht funzen wird es übrigens unter der Prämisse, der introvertierte Mensch sei "ein schwerer Fall" oder irgendwie krank oder sonstwas. Das ist dann nämlich ein Manipulationsversuch, der sich direkt gegen das (in dem Alter ganz sicher ausgereifte) Selbstbild der Person richtet. Merkt jeder, misbilligt jeder. Nicht nur introvertierte Menschen. Die vielleicht noch einen Tick eher, weil sie den von außen auf sie einstürmenden Gefühlsdusel ignorieren.
- Wenn kein Leidensdruck da ist (kann nicht da sein, da "Spaß bei der Arbeit"), lässt man die Finger da raus. Dann ist diese Person nämlich einfach so, und man hat kein Recht, das ändern zu wollen. Auch als Freund nicht. Und es klappt auch nicht, Milliarden Ehefrauen haben es bereits versucht und sind kläglich gescheitert. (Bei Mutti ausziehen sollte der OP-Freund trotzdem, da kann Sie auch drauf bestehen und vermutlich macht der das auch einfach so.) -- Janka (Diskussion) 02:07, 30. Mai 2014 (CEST)
- Wieso muss er unbedingt ausziehen? Ist das nicht ein Widerspruch: Auf der einen Seite wird argumentiert, dass kein Leidensdruck da ist und die Person halt so ist - aber alleine Leben soll sie gefälligst? ;) Das ist dann ja auch eher was von außen erzwungenes. Weil es sich bei uns in Deutschland halt so gehört (zumindest derzeit, war ja nicht immer so strikt). Genauso wie die genannten Gemeinschaftserlebnisse. --StYxXx ⊗ 05:37, 30. Mai 2014 (CEST)
- Die Mutter hat den Leidensdruck. Der Sohn entspricht nicht ihren Vorstellungen (typisches Mutterproblem) und daran wird sich auch nichts ändern, solange der Sohn im Blickfeld ist. Daher sollte er ausziehen, da fühlt sie sich besser und er hat seine Ruhe. -- Janka (Diskussion) 11:51, 30. Mai 2014 (CEST)
- Wieso muss er unbedingt ausziehen? Ist das nicht ein Widerspruch: Auf der einen Seite wird argumentiert, dass kein Leidensdruck da ist und die Person halt so ist - aber alleine Leben soll sie gefälligst? ;) Das ist dann ja auch eher was von außen erzwungenes. Weil es sich bei uns in Deutschland halt so gehört (zumindest derzeit, war ja nicht immer so strikt). Genauso wie die genannten Gemeinschaftserlebnisse. --StYxXx ⊗ 05:37, 30. Mai 2014 (CEST)
- Janka trifft den Nagel auf den Kopf. Das Problem haben hier in erster Linie nicht der (vermeintliche) "Problemling", sondern tatsächlich die Angehörigen bzw. das Umfeld, hier also der Fragesteller und die Eltern. Denen passt das Verhalten/der Lebensstil des OP-Freunds nicht, und sie wollen es ändern (man müsse ihm "mal den Kopf waschen"), andererseits soll er aber auf keinen Fall von zuhause ausziehen, denn (trotz Mitte 30 u. fester Job) würde er angeblich nicht zurechtkommen. Solche Fälle gibt es in der Praxis zuhauf, und stets spielt fehlende oder mangelhafte Abnabelung vom Elternhaus eine zentrale Rolle.
- Was man tun kann: Ihm klar machen, dass Hotel Mama in Bälde unwiederbringlich schließt und er sich eine Bleibe suchen muss (ihn freilich bei der Suche unterstützen, sofern überhaupt nötig). Ansonsten respektieren, dass es sein Leben ist. Was er tut und lässt, ist sein Bier (bzw. Cola/Red Bull). Jeder hat das Recht, eine Begabung nicht zu nutzen.--Zockmann (Diskussion) 11:54, 30. Mai 2014 (CEST)
- Richtig @Zockmann, man ist nicht verpflichtet seien Begabungen zu nutzen. Ich lese aus der Problembeschreibung, dass es sicher nicht nur am "Problemling" liegt. Hier wurde scheinbar der richtige Zeitpunkt für den Auszug verpasst. Und NEIN, das muss nicht nur am "Problemling" liegen. Wenn Mama vom erwachsenen Sohn zum Beispiel keine Kostenbeteiligung verlangt, muss sie sich nicht verwunder, wenn der im Hotel Mama blieben will (ist ja SO günstig).
- Mir z.b. hat die Mutter noch sicher 3-4 Jahre die Wäsche nach meinem Auszug gewaschen (gegen kleinen Geldbeitrag). Das hat mir denn Auszug natürlich auch erleichtert. Und natürlich auch das ich ein günstige Zwei-Zimmer Wohnung gefunden habe (das Teil war klein, aber als erste Wohnung gerade richtig). Durch das wöchentliche die Wäsche vor bringen, war für die Eltern doch noch bisschen Kontrolle da, wie es mir geht usw..
- Hier müsste man mal wirklich neutral abklären was der "Problemling" möchte. Wenn Freundin, dann erkläre im mal was für das Problem das „Freundin zuhause vorbei bringen“ mit sich bringt. Gerade wenn man an ihr rumfingeln möchte. Muttersöhnchen sein, ist der Hinsicht „Will Freundin“ nicht wirklich eine Pro-Argument. Meist fehlt einfach die Erkenntnis über die Gründe, warum man zuhause ausziehen sollte. Also die Einsicht, dasss etwas eben nicht zu klappen kommen könnte, weil man noch zuhause lebt. Da bringt aber Holzhammermethode gar nichts. Sondern man muss eben den sanften Zugang finden. Denn die Erkenntnis das Ausziehen vielleicht doch die beste Option ist, muss in ihm zuerst Wachsen können.--Bobo11 (Diskussion) 12:29, 30. Mai 2014 (CEST)
- Ein ganz anderer Ansatz sollte vielleicht auch geprüft werden: Möglicherweise wurden ständig überzogene Erwartungen auf die Person projiziert, aus denen ein Filtern unvermeidbarer unangenehmer Situationen erfolgt, siehe Vermeidungsverhalten, Zwangsstörung, Resignation, worin die Ursache nicht in der Person selbst läge. Nachdem in den Bearbeitungen des Artikels Kindesmisshandlung gewisse dazuzählende Handlungen etwas weicher formuliert wurden, die zugunsten von Erziehungsberechtigten im Scheidungsfall recht gelegen kämen, könnte eine Vermittlung von Wertlosigkeit in Frage kommen. Vielmehr scheint hier der „Seelenklemptner“ im wahrsten Sinne des Wortes als falsch als „Handwerker“ eingeordnet zu werden. So könnte die Situation beschrieben werden als „Das Kind funktioniert nicht, reparieren Sie es!“. Dass soetwas niemals zielführend sein kann, ist klar. Eine Situation dieser Art kann durch Vernachlässigung entstehen, oder wenn bei niedrigem Einkommen in der Familie das traditionelle Ernährermodell aufrechterhalten würde. Die familiären Auswirkungen auf unverhältnismäßigen Druck am Arbeitsplatz seien auch zu berücksichtigen. Hinzu kommt ein von Medien, Schule, Pädagogen und Arbeitgebern unzusammenhängendes, unvollständiges und völlig verzerrtes Bild von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Weitergedacht: Wie würde sich das Gerechtigkeitsempfinden von Personen entwickeln, auf die diese Auswirkungen und Eindrücke und Erwartungen dieser Art vermehrt wirken und abgeladen werden? Eine Parallele dessen könnte auch lauten: „Wenn du als Ehrbarer Kaufmann den Kunden so behandeln würdest, wärst du bereits vor Gericht oder die Bewertungsportale voll von dir“. Dies verhält sich wie Mechaniker an der Elektrik: Sie sehen den Strom nicht und haben Probleme das ganze zu verstehen, worauf in Folge Mechatroniker ausgebildet wurden. Wie die Ausbilder anfangs im Einzelfall für die neuen Anforderungen qualifiziert waren, sei vorsichtig dahingestellt. Ökonomische Interessen vermögen es, skrupellosere Gewinnschöpfungsmethoden darin zusehen, Mitarbeiter ständig latent zu kritisieren, dass sie sich nicht als Wert für eine Gehaltserhöhung sehen, da ihnen permanent eine vernachlässigte Bringschuld unterstellt wird, die barmherzig toleriert wird. Jemand mit zugezogenen Filtern als Ursache zusehen, würde folglich zu leicht fallen, immerhin wäre in einem solchen Fall existenzieller Druck vorhanden. Situationen dieser Art beobachtete ich bei Mitarbeitern eines gewissen Konzerns. Sie hatten nach dem Verlust ihrer Arbeitsplätze erheblich zu kämpfen. Einige vernachlässigten ihre Wohnung, anderen zerbrach ihre Beziehung. Sie bekamen wohl eine Abfindung, hatten aber es schwer wieder in den Beruf zukommen und wechselten sehr häufig und fluktuierten unfreiwillig ihren Freundeskreis. Diesen Preis sollte man bei der Gehaltsverhandlung mit einbeziehen. (Hinweis: der „gewisse Konzern“ ist nicht aus der im Text suggerierten Branche, aber sehr, auch bei Endkunden bekannt.) Ein weiterer Ansatz währe es, die Auswirkungen von Helikopter-Eltern auf die Situation zu vergleichen. --Hans Haase (有问题吗) 12:38, 30. Mai 2014 (CEST)
Denke auch an eine Veranlagung in Richtung autistische Spektrum bzw. eher noch ADS, weil letzteres wegen Abusus von Zigaretten, Red Bull und Cola als mögliche Selbstmedikation deutlich wahrscheinlicher erscheint. Das würde ich mal bei einem ADS-Spezialisten abklären lassen. Dauerhaft unglücklich sollte nicht sein, dann lieber ein wenig Anschub für die Neurotransmitter, bis er auf eigenen Beinen stehen kann. Das bereits angesprochene Sozialkompetenztraining, ibs. Erfolgserlebnisse, ist sowieso klar zu befürworten. Wie wäre es mit Keyboarden zwecks Spendensammlung für ein caritatives Projekt? Da ließe sich bestimmt etwas organisieren. Oder er spielt für ein Stückchen vom Kuchen auf Kindergeburtstagen oder im Kindergarten, als kleines Kunstprojekt für die Zwerge. --178.4.110.173 11:38, 1. Jun. 2014 (CEST)
- Diese Menge der legalen körperlichen Aufputschmittel geben mir auch zu denken. Das kann körperliche Ursachen haben, die Gutmütigkeit eine andere natürliche Reaktion darauf, da betroffene Individuen im Konflikt unterliegen könnten. --Hans Haase (有问题吗) 14:07, 1. Jun. 2014 (CEST)
- … bzw. geringes Selbstwertgefühl und Resignation, wenig Glauben an den Erfolg eigener Anstrengungen resultiert in Konfliktvermeidungsverhalten, und Gutmütigkeit birgt dabei noch am ehesten Chancen auf soziale Teilhabe. --178.4.110.173 18:28, 1. Jun. 2014 (CEST)
Zunächst mal sortieren: Was ist das Problem des jungen Mannes, was ist das Problem der Eltern?
Der junge Mann wohnt zunächst mal offenbar ganz zufrieden in Hotel Mama und scheint damit kein Problem zu haben. Warum also sollte er (aus seiner Sicht) irgendetwas unternehmen? Sein einziger Leidensdruck scheint im Mangel einer Freundin zu bestehen - aber auch dieser Leidensdruck scheint nicht groß genug zu sein, um ernsthaft irgendetwas dagegen zu tun. Wenn er weiterhin auf Dauer 4 Liter Zuckerwasser pro Tag zu sich nimmt, wird er in absehbarer Zeit ein weiteres Problem haben, was das Finden einer Freundin nicht leichter machen wird. (Es gibt Leute, die brauchen ein solches - äußerliches - Problem sogar, um sich nicht mit ihren inneren Problemen auseinandersetzen zu müssen.) Jedenfalls ist eins vollkommen richtig: Solange er selber nicht will, ist jegliche Beratung durch Psychologen etc. vollkommen zwecklos.
Das eigentliche Problem scheint bei der Mutter bzw. den Eltern zu liegen. Da ist der Leidensdruck offenbar hoch. Ich würde an Deiner Stelle nicht versuchen, bei dem Sohn anzusetzen oder gar ihm "den Kopf zu waschen" (wird nichts nützen und nur das Vertrauensverhältnis zerstören), sondern gucken, was man für die Mutter tun kann. Ich würde ihr an Deiner Stelle dringend empfehlen, sich an eine Lebens- oder Erziehungsberatungsstelle zu wenden ("Erziehung" ist natürlich bei einem Mittdreißiger der falsche Begriff). Sie sollte sich über folgende Fragen klarwerden:
Was könnte passieren, wenn sie Sohnemann vor die Tür setzt? Mal verschiedene Varianten durchspielen. Ein "Worst Case Scenario" aufstellen. Überlegen, wie wahrscheinlich das ist und wie man dem evtl. vorbauen könnte. Er hat doch offenbar einen stabilen Job, das ist doch schonmal viel wert. Herumsitzen vor dem Fernseher oder Computer kann er auch in einer eigenen Wohnung.
Was könnte passieren, wenn sie ihn nicht vor die Tür setzt? Auch diese Frage sollte sie sich mal stellen. Sie wird älter. Irgendwann wird sie sich nicht mehr um ihn kümmern können. Dann wird er selbstständig zurechtkommen müssen. Ist es einfacher, wenn er das mit Mitte 50 lernen muss oder mit Mitte 30? Wenn er dann plötzlich von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geworfen wird, oder wenn er frühzeitig mit aller notwendigen Unterstützung in die Selbstständigkeit begleitet wird?
Noch etwas: Du sprichst abwechselnd einmal von den "Eltern", einmal von der "Mutter". Die Frage ist, ob die Eltern in dieser Sache mit einer Zunge sprechen. Ist der Leidensdruck bei beiden hoch genug, um gemeinsam eine Beratung aufzusuchen? Falls sie nämlich Sohnemann unterschiedliche Botschaften senden, wird's schwierig.
Anmerkung am Rande: Jegliche Spekulationen - wie hier im Thread geäußert - über mögliches Fehlverhalten der Eltern halte ich an dieser Stelle für vollkommen fehl am Platze. Sie sind in keiner Weise zielführend, sondern schieben nur die Schuld am Problem auf die Eltern. Liebende Eltern werden sich die Frage nach eigenen möglichen Erziehungsfehlern ohnehin schon hunderttausendmal gestellt haben und ein reichliches Maß an Schuldgefühlen mit sich herumtragen. Und sollte eine Problematik wie Asperger oder sonstwas vorliegen (was hier wirklich nicht per Ferndiagnose zu entscheiden ist, schon gar nicht anhand der spärlichen Personenbeschreibung), so liegt dies nach heutigem Kenntnisstand nicht im Versagen der Eltern begründet. --Anna (Diskussion) 14:39, 2. Jun. 2014 (CEST)
- @Anna: Falsche Eingangsvermutung Deinerseits, er sei zufrieden. In Eröffnungsthread steht unmissverständlich, er ist unglücklich. Damit erübrigen sich Deine sämtlichen Anschlußüberlegungen. --178.4.110.173 22:05, 2. Jun. 2014 (CEST)
- Nicht im geringsten. Er ist ganz offensichtlich nicht unglücklich genug, um irgendetwas an seiner Situation zu ändern. Das reicht, um alle meine Anschlussüberlegungen bestehen zu lassen. --Anna (Diskussion) 00:09, 4. Jun. 2014 (CEST)
- "… nicht unglücklich genug, um irgendetwas an seiner Situation zu ändern."??? Ich kann nur schwer an mich halten! Bitte lies mal irgendetwas über Depressionen, völlig egal was und von wem. Diese Deine Aussage ist entwürdigend und zeugt vom völligen Fehlen jeglichen Verständnisses für den Betroffenen, geschweige denn Fachwissen. --178.6.175.163 00:30, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Deine Aussage zeugt in erster Linie von einem, nämlich von Ferndiagnosen, die uns hier nicht zustehen. Von der Formulierung "nicht glücklich" auf eine Depression zu schließen, halte ich doch für recht gewagt.
- Und wenn Du es MIR nicht glaubst, dass der Leidensdruck erst hoch genug sein muss, bevor irgendjemand an seiner Situation etwas ändert, dann frag gerne alle einschlägigen Fachleute Deines Vertrauens. Sie werden Dir nichts anderes sagen. Das ist nicht entwürdigend, sondern völlig normal.
- Auch wenn Du also nicht an Dich halten kannst, wiederhole ich es gerne nochmal: Nach der uns hier vorliegenden Situationsbeschreibung ist der junge Mann offenbar noch nicht unglücklich genug ( = der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug), als dass er bereit wäre, selber aktiv zu werden, um etwas an seiner Situation zu ändern. --Anna (Diskussion) 00:48, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Der Reihe nach.
- Ich habe keine Depression diagnostiziert, sondern lediglich am Beispiel Depression Dir beizubringen versucht, wie trotz sehr hohem Leidensdruck und selbst bei bestehender Veränderungsbereitschaft ein "selber aktiv werden" ausbleiben kann.
- Damit ist Deine Ferndiagnose "… nicht unglücklich genug, um irgendetwas an seiner Situation zu ändern." mehr als fahrlässig und für den Betroffenen entwürdigend. Außerdem kannst Du nicht wissen, was ihn tatsächlich von einer Veränderung abhält, urteilst aber dennoch abschließend
- Weiters behauptest Du der Betroffene sei zufrieden, was Du offenbar aus demselben Fehlschluss herleitest, womit Du Dich wohl selber zu bestätigen versuchst.
- Überdies verweist Du auf Fachleute, die angeblich hinter Deinen Ansichten stünden, was einzig Deiner falschen Überzeugung entspringt, aber keinesfalls der Realität.
- Ich fürchte, gegen so viel blinde Selbstbezogenheit kann man nicht ankommen und beschließe es mit der Bitte, diese inhumane Betrachtungsweise zukünftig nur noch auf Dich selber zu beziehen, aber nicht mehr auf andere. --88.68.71.205 20:14, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Liebe IP: Es ist eine anerkannte und triviale Grundweisheit unter allen Fachleuten aller helfenden Berufe, dass jemandem, der an seiner Situation nichts ändern will und der sich nicht helfen lassen will ( = jemand, bei dem der Leidensdruck nicht hoch genug ist), nicht geholfen werden kann. Das hat weder was mit "Selbstbezogenheit" noch mit "Entwürdigung" noch gar mit "Inhumanität" zu tun (bitte spar Dir im übrigen solche PAs!), sondern ist einfach ein allgemein anerkannter Fakt. Wenn Dir das nicht bekannt ist, kann ich's nicht ändern. Für mich ist hier jetzt EOD. --Anna (Diskussion) 21:53, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Du machst einen Zirkelschluss. Du behauptest, er wolle keine Hilfe, begründest das mit dem Fehlen von Veränderungen, was Du wiederum begründest mit der Eingangsbehauptung, er wolle keine Hilfe usw. Daraus erklären sich auch alle Deine Folgefehler inkl. dem völligen Ignorieren der möglichen Depression und der bereits diagnostizierten Angststörung.
- Damit ist jetzt alles restlos klar geworden, brauchst nicht mehr zu antworten. --88.68.71.205 00:53, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Hier sollte der betroffene sortieren: Was spricht für und was gehen eine Änderung des Zustandes? Entscheidungen im Selbstmanagement sollten getroffen werden. An was gezögert wird, sollte aufgerollt werden. Die verdrängte Ursachen gefunden und erkundet werden. --Hans Haase (有问题吗) 16:51, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Meinst Du so etwas wie eine Rational-Emotive Verhaltenstherapie? --88.68.87.252 11:37, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hier sollte der betroffene sortieren: Was spricht für und was gehen eine Änderung des Zustandes? Entscheidungen im Selbstmanagement sollten getroffen werden. An was gezögert wird, sollte aufgerollt werden. Die verdrängte Ursachen gefunden und erkundet werden. --Hans Haase (有问题吗) 16:51, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Liebe IP: Es ist eine anerkannte und triviale Grundweisheit unter allen Fachleuten aller helfenden Berufe, dass jemandem, der an seiner Situation nichts ändern will und der sich nicht helfen lassen will ( = jemand, bei dem der Leidensdruck nicht hoch genug ist), nicht geholfen werden kann. Das hat weder was mit "Selbstbezogenheit" noch mit "Entwürdigung" noch gar mit "Inhumanität" zu tun (bitte spar Dir im übrigen solche PAs!), sondern ist einfach ein allgemein anerkannter Fakt. Wenn Dir das nicht bekannt ist, kann ich's nicht ändern. Für mich ist hier jetzt EOD. --Anna (Diskussion) 21:53, 5. Jun. 2014 (CEST)
- "… nicht unglücklich genug, um irgendetwas an seiner Situation zu ändern."??? Ich kann nur schwer an mich halten! Bitte lies mal irgendetwas über Depressionen, völlig egal was und von wem. Diese Deine Aussage ist entwürdigend und zeugt vom völligen Fehlen jeglichen Verständnisses für den Betroffenen, geschweige denn Fachwissen. --178.6.175.163 00:30, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Nicht im geringsten. Er ist ganz offensichtlich nicht unglücklich genug, um irgendetwas an seiner Situation zu ändern. Das reicht, um alle meine Anschlussüberlegungen bestehen zu lassen. --Anna (Diskussion) 00:09, 4. Jun. 2014 (CEST)
4. Juni 2014
Suche Song und Video
Hallo Leute
Ich suche bereits seit vielen Jahren (bisher vergeblich) nach einem Lied, welches ich im YouTube Video "Welcome to Toonstruck" gehört habe. Das Video (http://www.youtube.com/watch?v=AaQee2vVXYU) ist von YouTube verschwunden und bisher konnte ich es nicht mehr finden. Könnt Ihr mir helfen, das Lied bzw. das Video wieder zu finden? Gibt es ein Archiv, in welchem ich das Video finden könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen --178.195.94.230 22:11, 4. Jun. 2014 (CEST)
- Natürlich gibt es ein Internet-Archiv (die Wayback Machine), allerdings sind dort auch „nur“ 400 Milliarden Seiten enthalten, es kann dort unter Umständen die richtige Seite zum gewünschten Zeitpunkt erfasst sein. Bei Youtube Videos ist es aber oft so, dass der Benutzer diese selbst wieder entfernt.
- Ich bin der Sache etwas nachgegangen und habe dort eine ältere Instanz deines Links gefunden, das Video war/ist aber nicht (mehr) dabei. Vom Rest der Seite erfährt man, dass es ein gewisser „Manfromtheinternet“ publiziert hatte. Und nach weitergoogeln seines Benutzernamens kommt heraus, dass er bei Youtube unter diesem Namen nicht mehr existiert, auf anderen jedoch Seiten findet man noch weiterführende Spuren. Eventuell ist er hier noch Mitglied, dass du ihn direkt fragen kannst. Oder der Hinweis auf dieser Seite wäre die Lösung und dein gesuchtes Lied wäre tatsächlich das Make your own kind of Music von „Mama“ Cass Elliot. Gruß, --MedMan (Diskussion) 21:27, 7. Jun. 2014 (CEST)
Vielen Dank für deine Hilfe, MedMan. Ich hoffe, dass ich dir nicht zuviel Arbeit beschert habe. Leider handelt es bei dem gesuchten Lied nicht um Make your own kind of Music von „Mama“ Cass Elliot. Ich kann mich jedoch erinnern, dass das Lied aus dem Toonstruck video hin und wieder im Radio zu hören war. Ich habe die Charts abgeklappert, es jedoch nicht gefunden. Gibt es noch weitere Archive als das Internet Archive? Interessanterweise habe ich fast dasselbe Video (http://www.youtube.com/watch?v=OIIXjulD3_w) gefunden, welches einfach über einen anderen Soundtrack verfügt. Anfragen an den Macher wurden bisher leider nicht beantwortet.--178.195.94.230 22:11, 8. Jun. 2014 (CEST)
Fürstliche Zwillinge
Frage an die Historiker: Gab es schon mal regierende Fürsten mit Zwillings- (oder Mehrlings-)-Geschwistern? Rein statistisch müsste das gelegentlich vorgekommen sein. --84.135.179.201 23:43, 4. Jun. 2014 (CEST)
- Auf die Schnelle findet sich nur Spekulatives und Mythisches. Theoretisch sollte es bei einer Chance von 1:80 allerdings mal vorgekommen sein. Natuerlich sind Mehrlingsgeburten in der Neuzeit aufgrund von Hormonbehandlung haeufiger (ebenfalls spekulativ - im daenischen Falle wohl eher unwahrscheinlich) und man kann nicht ausschliessen, dass Kronprinzenzwillinge in der Vergangenheit auch schon einmal unauffaellig verheimlicht wurden, um oeffentlich die Einzigartigkeit des kuenftigen Monarchen darstellen zu koennen und um Diadochenkonkurrenz zu vermeiden. -- 160.62.10.13 03:17, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Der letzte Schah von Persien hatte eine Zwillingsschwester. Grüße Dumbox (Diskussion) 06:40, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Angeblich hatte Ludwig XIV. einen Zwillingsbruder.--Optimum (Diskussion) 10:48, 5. Jun. 2014 (CEST)
- siehe oben.--160.62.10.13 10:50, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Ach ja, hatte nicht gesehen, dass das ein Link war.--Optimum (Diskussion) 11:11, 5. Jun. 2014 (CEST)
- siehe oben.--160.62.10.13 10:50, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Angeblich hatte Ludwig XIV. einen Zwillingsbruder.--Optimum (Diskussion) 10:48, 5. Jun. 2014 (CEST)
König Jakob II. von Schottland hatte einen, früh verstorbenen, Zwillingsbruder. --Proofreader (Diskussion) 11:03, 5. Jun. 2014 (CEST)
Auch interessant: Der Zwillingssturz von Gottorf. --Proofreader (Diskussion) 11:43, 5. Jun. 2014 (CEST)
Die Kinder Drogo und Pippin von Karl dem Kahlen waren offensichtlich ebenfalls Zwillinge, sind beide jung verstorben. --Proofreader (Diskussion) 11:52, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Danke schon mal für die Beiträge. Ich bin auf das Thema gekommen durch die Gerüchte aus dem Fürstentum Monaco, dass dort Zwillinge zu erwarten wären. Das wird bestimmt kein Problem. Auch die Zwillingsschwester eines orientalischen Herrschers ist keins, sie ist eben eine vornehme Frau, die für eine Thronfolge naturgemäß nicht in Frage kommt.
- Wenn ich mal das Altertum und frühe Mittelalter ausklammere, sondern nur die letzten ca. 1000 Jahre nehme. Dann müssten in der Vielzahl der souveränen europäischen Territorien solche Fälle schon einige Male aufgetreten sein, gefühlt eine zweistellige Zahl. Das Ereignis einer Thronfolgergeburt wird öffentlich bekannt, gut dokumentiert, ist ein Politikum. Die Geburtsdaten später regierender Fürsten sind meist zuverlässig bekannt, dann müsste die Tatsache einer Mehrlingsgeburt auch bekannt sein, auch wenn man die evtl. geringeren Überlebenschancen von Mehrlingen in früherer Zeit in Rechnung stellt. Natürlich denke ich auch in die Richtung, dass evtl. Thronfolgestreitigkeiten daraus resultieren können. Mich interessieren daher nachweisliche Fälle, vor allem solche, in denen der andere Zwilling nicht ("zufällig"?) früh verstorben ist. Haben sich Historiker über so etwas schon mal gekümmert? --84.135.182.166 14:24, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Für die Thronfolge sollte es doch egal sein? Zwillinge werden ja nicht gleichzeitig geboren... --Eike (Diskussion) 14:26, 5. Jun. 2014 (CEST)
Also ab Herzog aufwärts scheint es das in Europa bislang nicht gegeben zu haben, dass beide Zwillingsgeschwister bis ins Erwachsenenalter überlebt hätten. Es würde mich allerdings ebenfalls wundern, wenn es nicht bei den Grafen, Markgrafen, Fürsten oder Großfürsten solche Fälle gegeben hätte. Ich such mal weiter ... --Proofreader (Diskussion) 14:43, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Und gleich einen Fall gefunden: Eleonore von Bretzenheim und Friederike von Bretzenheim, ihres Zeichens Gräfinnen. --Proofreader (Diskussion) 14:47, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Noch ein Zwillingspärchen: Sizzo von Schwarzburg und seine Schwester Helene. Zum Regieren kam der Mann nicht mehr, weil die Revolution dazwischenkam. --Proofreader (Diskussion) 14:51, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Georg Friedrich Prinz von Preußen hat Zwillingssöhne. --Proofreader (Diskussion) 14:56, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Und der dänische Thronfolger Frederik ist Papa von Zwillingen, Vincent und Josephine. --Proofreader (Diskussion) 15:00, 5. Jun. 2014 (CEST)
Es gab sogar mindestens einen Kaiser mit Zwillingsbruder: Ludwig der Fromme, Sohn Karls des Großen, geboren 778. Auch hier starb der Bruder allerdings bald darauf. Sollte sich heute ein ähnlicher Fall zutragen, fände ich die Konsequenzen hinsichtlich der Thronfolge allerdings auch interessant. Frage an die Medzin-Auskenner: Hängt das eigentlich bei Zwillingen ganz vom Zufall ab, wer zuerst "rausflutscht", oder zeichnet sich das lange vorher ab? Und im Falle einer Kaiserschnittgeburt, können die Ärzte da frei entscheiden, wen sie zuerst holen (und im royalen Fall dadurch ggf. die Thronfolge beeinflussen) oder hängt auch das von der Lage im Mutterleib ab? --slg (Diskussion) 14:58, 5. Jun. 2014 (CEST)
Et voilà: Ein Fall von erwachsenen männlichen Zwillingen mit Thronfolgeproblematik: Wolfgang von Hessen, der jüngere, wurde vom Vater zum Thronfolger für den finnischen Thron ausersehen; der ältere, Philipp von Hessen (Politiker), sollte daheim in Hessen bleiben. Zum Regieren kam Wolfgang allerdings auch nicht, die Finnen wollten dann doch lieber Republikaner sein. --Proofreader (Diskussion) 15:06, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Kaiser Otto III. hatte möglicherweise eine Zwillingsschwester, die direkt nach der Geburt starb, s. Theophanu (HRR). Ich glaube aber nicht, daß früher beim Tod im Kindesalter nachgeholfen wurde, um künftigen Streitfällen allein wegen der Zwillingsgeburt vorzubeugen. Bei der größeren Kindersterblichkeit war man doch froh, wenn die Kinder erwachsen wurden. Daß sich so wenig Fälle finden lassen, liegt wohl eher daran, daß Kinder öfter starben und Geburtsdaten (und damit Zwillingsgeburten) zu früheren Zeiten nicht so genau dokumentiert wurden. 217.230.125.34 15:07, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Und nochn Kaiser mit Zwillingsschwester, die sogar bis ins Erwachsenenalter überlebt hat: en:Alexios Komnenos (co-emperor) Ein Kaiser ohne Artikel in der de WP? Wer macht sich ans Werk? :) --Proofreader (Diskussion) 15:31, 5. Jun. 2014 (CEST)
Drama: Zwei Zwillingsbrüder regieren gemeinsam, können sich aber nicht ausstehen; einer der beiden kommt bei der Jagd ums Leben, der andere wird des Mordes verdächtigt. Auch die Namensgebung ist originell: Berengar Raimund II. (Barcelona), genannt der Brudermörder und Raimund Berengar II. (Barcelona), genannt der Flachskopf. --Proofreader (Diskussion) 15:39, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Drama ist gar kein Ausdruck. Die fr WP sagt gar, der Brudermörder habe außerdem noch die Frau seines Bruders geschwängert, sodass Raimund-Berengar III., der ihm dann auf dem Thron folgte, gar nicht sein Neffe, sondern in Wahrheit sein leiblicher Sohn gewesen sei; so jedenfalls "selon des légendes roussillonnaises". Kain und Abel ist gar nix dagegen, die Story sollte man verfilmen. --Proofreader (Diskussion) 19:16, 5. Jun. 2014 (CEST)
- So etwas habe ich geahnt. Ich vermute noch weitere Fälle. Außerdem werden Zwillinge durchaus gleichzeitig geboren, Thronfolge nach Stoppuhr (eine Minute eher geboren) wäre auch seltsam. Wer hätte das in früheren Zeiten kontrollieren können. Danke für die Beispiele. --84.135.180.210 20:55, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Jetzt frage ich mich (ganz ernsthaft), wer von uns beiden naiv ist... Ich stelle mir nicht vor, dass die die Uhrzeit auf Sekunden genau aufgeschrieben hätten. Aber es spricht doch nichts dagegen, aufzuschreiben, wer vor dem anderen geboren ist. Dafür braucht man keine Stoppuhr, das ergibt sich ziemlich zwanglos. --Eike (Diskussion) 21:09, 9. Jun. 2014 (CEST)
- So etwas habe ich geahnt. Ich vermute noch weitere Fälle. Außerdem werden Zwillinge durchaus gleichzeitig geboren, Thronfolge nach Stoppuhr (eine Minute eher geboren) wäre auch seltsam. Wer hätte das in früheren Zeiten kontrollieren können. Danke für die Beispiele. --84.135.180.210 20:55, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Drama ist gar kein Ausdruck. Die fr WP sagt gar, der Brudermörder habe außerdem noch die Frau seines Bruders geschwängert, sodass Raimund-Berengar III., der ihm dann auf dem Thron folgte, gar nicht sein Neffe, sondern in Wahrheit sein leiblicher Sohn gewesen sei; so jedenfalls "selon des légendes roussillonnaises". Kain und Abel ist gar nix dagegen, die Story sollte man verfilmen. --Proofreader (Diskussion) 19:16, 5. Jun. 2014 (CEST)
@84.135.182.166 Ich weiß nicht, was ein „orientalischer Herrscher“ sein soll. Aber siehe Begum, Salghuriden, Melike Mama Hatun, Arwa bint Ahmad, Raziah, Schadschar ad-Durr und allgemeiner en:List of queens regnant. Eine Zuordnung als „orientalisch“ ändert nichts daran, dass in bestimmten historischen Situationen auch Frauen die Herrschaft erlangten. --Chricho ¹ ³ 13:43, 7. Jun. 2014 (CEST)
5. Juni 2014
Rechnen Fähigkeit weltweit
- Gibt es irgendwo eine Statistik wie es mit der Fähigkeit der Menschen zu Rechnen weltweit ausgeprägt ist? Ich habe bisher nur Statistiken zur Erlangung bzw. Nicht Erlangung der Lese - und Schreibfähigkeit Alphabetisierung (Lesefähigkeit) gefunden. Egal ob online oder offline (Bücher usw.). --Fiver, der Hellseher (Diskussion) 09:21, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Nun da gibt es ein Definition Problem. Rechnen können ja zum Teil schon Tier. Addieren und Subtrahieren ist etwas das uns mehr oder weniger im Blut liegt. Die beiden Grundrechenart kann eigentlich jeder normal entwickelte Mensch (Wenn überhaupt erlernt, dann sehr früh). Bisschen anderes sieht es bei den anderen beiden Grundrechenarten Multiplikation und Division aus, die werden ganz sicher erlernt. Allerdings schaffen es in der Regel alle Menschen sich alle vier Grundrechenarten für einfache und alltags-übliche Rechnungen anzueignen (notfalls halt Fingerrechen ^^). Der Knackpunkt ist eher der, wie willst du die Rechenfähigkeit überprüfen, wenn der Mensch nicht Lesen und Schreiben kann? Der kann das reinste Kopfrechengenie sein. --Bobo11 (Diskussion) 09:36, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Indem man ihm die Frage vorliest? Halte ich aber für die extreme Ausnahme, dass jemand sehr gut rechnen kann, aber keine Möglichkeit hat das Ergebnis festzuhalten (10 Ziffern zu lernen ist wesentlich einfacher als flüssig lesen und schreiben zu lernen). --mfb (Diskussion) 14:32, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Multiplikation kann man (für ganze Zahlen) in Addition überführen (was natürlich nur bei kleinen zahlen kopfrechnerisch handhabbar ist), z.B. 5*4 = 5+5+5+5. Die Division entspricht der Multiplikation des Inversen, daher auch die kann man bis zu einem gewissen Grad mit der Multiplikation beherrschen, ohne sie wirklich extra zu lernen, z.B. wenn man wissen will, wie viel 40/8 ist, dann fragt man sich einfach, mit was man 8 multiplizieren muss, um 40 zu bekommen, wenn man nicht dividieren kann, probiert man einfach ein paar Multiplikationen aus bis man das richtige Ergebnis hat, wenn man das oft genug macht, weiß mans dann irgendwann auswendig und kann durch ganze Zahlen dividieren, so lange kein Rest übrig bleibt (so lernt man wohl auch in de Schule zuerst einmal dividieren). Wies mit Rest geht ist eigentlich recht leicht zu lernen, wenn man z.B. 43/8 dividiert, dann bemerkt man, 5*8 = 40, 6*8 =48, also schon drüber, also muss das Ergebnis mal >5 und <6 sein, dann muss man eigentlich nur wissen, dass man die komplette Zahl bekommt, indem man den Rest dazu schreibt und durch den Divisor teilt und schon weiß man, dass das Ergebnis 5 3/8 ist. Für 44/8 kommt man mit diese Methode zwar nicht ohne weitergehende Kenntnisse auf 5 1/2, aber 5 4/8 ist auch richtig und in vielen Fällen ausreichend (wenn man z.B. 44 Kuchen auf 8 Personen aufteilen will, ist es wurscht, ob man jetzt jedem 5 Kuchen und vier Achtel oder jedem Fünf Kuchen und eine Hälfte gibt, nur muss man halt bei vier achteln öfters schneiden). Daher würde ich die grundlegende Multiplikations- und Divisonsfähigkeit eher als einfach erlernbares Wissen sehen als als wirklich eigenständige Fähigkeit. --MrBurns (Diskussion) 20:13, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Indem man ihm die Frage vorliest? Halte ich aber für die extreme Ausnahme, dass jemand sehr gut rechnen kann, aber keine Möglichkeit hat das Ergebnis festzuhalten (10 Ziffern zu lernen ist wesentlich einfacher als flüssig lesen und schreiben zu lernen). --mfb (Diskussion) 14:32, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Nun da gibt es ein Definition Problem. Rechnen können ja zum Teil schon Tier. Addieren und Subtrahieren ist etwas das uns mehr oder weniger im Blut liegt. Die beiden Grundrechenart kann eigentlich jeder normal entwickelte Mensch (Wenn überhaupt erlernt, dann sehr früh). Bisschen anderes sieht es bei den anderen beiden Grundrechenarten Multiplikation und Division aus, die werden ganz sicher erlernt. Allerdings schaffen es in der Regel alle Menschen sich alle vier Grundrechenarten für einfache und alltags-übliche Rechnungen anzueignen (notfalls halt Fingerrechen ^^). Der Knackpunkt ist eher der, wie willst du die Rechenfähigkeit überprüfen, wenn der Mensch nicht Lesen und Schreiben kann? Der kann das reinste Kopfrechengenie sein. --Bobo11 (Diskussion) 09:36, 5. Jun. 2014 (CEST)
Was genau ist die "Fähigkeit zu rechnen"? Kopfrechnen ist wie Lesen, Schreiben und vieles anderes eine Kulturtechnik. Das Potential zum Rechnenlernen ist wohl in allen Menschen angelegt, aber was sie konkret lernen, ist kulturell vermittelt. In sehr primitiven Kulturen zählte man "eins, zwei, viele" - vielleicht ist davon in vielen Sprachen noch der Dual zurückgeblieben - und da erübrigte sich das Rechnen. In Kulturen mit griechischen/lateinischen/chinesischen Zahlzeichen rechnet es sich schwieriger als mit dem indisch-arabischen Stellenwertsystem. Und wer das Einmaleins nicht (mehr) beherrscht, kommt nicht weit - Kulturtechniken müssen auch geübt werden, sonst gehen sie verloren und man kann nur noch eintippen und dem Apparat vertrauen. ;-) --Zerolevel (Diskussion) 15:43, 5. Jun. 2014 (CEST)
- +1 Vermutlich haben viele Menschen gar keine Verwendung für "höhere Mathematik". Ein Bauer in einem Drittweltland muss mit dem wenigen Geld (be)rechnen, das er erwirtschaftet und vielleicht noch seine Ernte unter den Angehörigen aufteilen, aber er wird wohl kaum das große Einmaleins benötigen. Das Gleiche gilt allerdings auch für Schreib-/Lesefähigkeiten: Wer sich keine Bücher und Zeitungen leisten kann und sowieso den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten muss, hat Probleme, seine Lesefähigkeit anzuwenden. --Optimum (Diskussion) 18:18, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Bezweifle ich, dass der nicht richtig rechnen können muss. Selbst in der dritten Welt verkauft praktisch jeder, der eine Ernte einfährt was auf dem Markt. Und wenn man Zwischenhändler mit drin hat, muss man erst recht richtig rechnen können. Sonst wird man grundsätzlich angeschmiert. Wäre ich dort Bauer: Ich würde darauf *bestehen*, dass meine Kinder richtig rechnen lernen, selbst mit Prozent und Komma. -- Janka (Diskussion) 19:36, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Würdest Du nicht, weil Du selbst gar kein Verständnis für Prozent und Komma hättest, und weil Rechnen anstrengend ist. Sogar diejenigen im hochgebildeten Deutschland, die es eigentlich können müssten, verlassen sich lieber auf ihr Gefühl.--Optimum (Diskussion) 20:44, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Bei den Großpackungen muss ja der Grundpreis angegeben werden, bei dem Link steht zwar, das der manchmal fehlt, aber nach meinen Erfahrungen ist das eher selten der Fall, lesbar ist er meistens auch noch für normalsichtige Leute. Ich denke es legt eher daran, dass man oft eben nur die eine Packungsgröße sieht (die zeit, den Supermarkt genau zu durchsuchen hat kaum jemand, oft sind die Großpackungen ja auch in einem anderen Bereich als die Kleinpackungen)) und viele sich auch gar nicht die Mühe machen, auf den Grundpreis zu achten, weil sie noch immer darauf vertrauen, dass Großpackungen immer billiger kommen als Kleinpackungen. --MrBurns (Diskussion) 21:00, 5. Jun. 2014 (CEST)
- *QUETSCH* Da solltest Du auch im Supermarkt überschlägig nachrechnen. Der ausgewiesen Kilo- bzw. 100-Gramm-Preis ist manchmal falsch - gar nicht mal so selten. --Zerolevel (Diskussion) 09:41, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Bei den Großpackungen muss ja der Grundpreis angegeben werden, bei dem Link steht zwar, das der manchmal fehlt, aber nach meinen Erfahrungen ist das eher selten der Fall, lesbar ist er meistens auch noch für normalsichtige Leute. Ich denke es legt eher daran, dass man oft eben nur die eine Packungsgröße sieht (die zeit, den Supermarkt genau zu durchsuchen hat kaum jemand, oft sind die Großpackungen ja auch in einem anderen Bereich als die Kleinpackungen)) und viele sich auch gar nicht die Mühe machen, auf den Grundpreis zu achten, weil sie noch immer darauf vertrauen, dass Großpackungen immer billiger kommen als Kleinpackungen. --MrBurns (Diskussion) 21:00, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Würdest Du nicht, weil Du selbst gar kein Verständnis für Prozent und Komma hättest, und weil Rechnen anstrengend ist. Sogar diejenigen im hochgebildeten Deutschland, die es eigentlich können müssten, verlassen sich lieber auf ihr Gefühl.--Optimum (Diskussion) 20:44, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn was in der weniger gut entwickelten Regionen gelernt wird, dann ist es Rechnen. Lange bevor man sich den Luxus von Lesen und Schreiben leistet. Klar sind das eher einfachere Rechenaufgaben, aber die vier Grundrechenarten werden praktisch weltweit angewandt. Deswegen ja auch der Definition Problem Hinweis. Wann kann einen Mensch rechnen? Wenn er 3+4 zusammen zählen kann (das schaffen sogar einige Raben) oder wann? --Bobo11 (Diskussion) 20:32, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Das Problem ist hier die Frage was du als Rechnen definierst: Einfaches Addieren/Subtrahieren ("Abzählen") kann jeder, auf einfachem Niveau und bei kleinen Zahlen dürfte ein normal Intelligenter ohne jede Schulbildung auch Multiplizieren und Dividieren können, notfalls mit manuellem Abzählen der Finger. Die Frage ist eher, ob ein Verständnis für abstrakte mathematische Begriffe hat: Versteht er was ein Flächeninhalt ist? Oder Maßeinheiten? Kann er auf dem Markt abstrakte, große Zahlen verstehen und einordnen, die im der Händler vorgibt? Auch bei der Lesefähigkeit ist der Übergang zwischen können und nicht können breit (definiert meistens damit ob einer einen Zeitungsartikel vorlesen und verstehen kann). So einen Test müsste man dann auch definieren.--Antemister (Diskussion) 22:29, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Zum Thema lesen: da gibts ja den absoluten Analphabetismus und den "funktionalen Analphabetismus". Als "funktionaler Analphabet" gilt man soviel ich weiß schon, wenn man beim (sinnerfassenden) Lesen "etwas" langsamer ist als der Durchschnitt. Ob es im Mathematischen Bereich etwas gibt, das ähnlich wie "funktionaler Analphabetismus" definiert ist, weiß ich aber nicht. --MrBurns (Diskussion) 00:42, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Es gibt die Arithmasthenie (Rechenschwäche, Dyskalkulie) analog zur Legasthenie (Leseschwäche, Dyslexie). --Rôtkæppchen₆₈ 00:46, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Zum Thema lesen: da gibts ja den absoluten Analphabetismus und den "funktionalen Analphabetismus". Als "funktionaler Analphabet" gilt man soviel ich weiß schon, wenn man beim (sinnerfassenden) Lesen "etwas" langsamer ist als der Durchschnitt. Ob es im Mathematischen Bereich etwas gibt, das ähnlich wie "funktionaler Analphabetismus" definiert ist, weiß ich aber nicht. --MrBurns (Diskussion) 00:42, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Das Problem ist hier die Frage was du als Rechnen definierst: Einfaches Addieren/Subtrahieren ("Abzählen") kann jeder, auf einfachem Niveau und bei kleinen Zahlen dürfte ein normal Intelligenter ohne jede Schulbildung auch Multiplizieren und Dividieren können, notfalls mit manuellem Abzählen der Finger. Die Frage ist eher, ob ein Verständnis für abstrakte mathematische Begriffe hat: Versteht er was ein Flächeninhalt ist? Oder Maßeinheiten? Kann er auf dem Markt abstrakte, große Zahlen verstehen und einordnen, die im der Händler vorgibt? Auch bei der Lesefähigkeit ist der Übergang zwischen können und nicht können breit (definiert meistens damit ob einer einen Zeitungsartikel vorlesen und verstehen kann). So einen Test müsste man dann auch definieren.--Antemister (Diskussion) 22:29, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Bezweifle ich, dass der nicht richtig rechnen können muss. Selbst in der dritten Welt verkauft praktisch jeder, der eine Ernte einfährt was auf dem Markt. Und wenn man Zwischenhändler mit drin hat, muss man erst recht richtig rechnen können. Sonst wird man grundsätzlich angeschmiert. Wäre ich dort Bauer: Ich würde darauf *bestehen*, dass meine Kinder richtig rechnen lernen, selbst mit Prozent und Komma. -- Janka (Diskussion) 19:36, 5. Jun. 2014 (CEST)
Eisschnee
Was genau ist Eisschnee (mit 2 s)? Er wird offenbar zur Wurstherstellung verwendet.
--79.255.40.57 17:20, 5. Jun. 2014 (CEST)
Ganz simple Antwort, auch nur eine Form von gefrorenem Wassereis. Wenn ich es als Laie aus der Ansicht beschreiben darf, ist das Besondere, daß es sich nicht um zerstoßene Eiswürfel (crashed ice) handelt, sondern beim Frostprozess die feinen Eiskristalle bereits durch Schaben am Vergrößern gehindert werden. Der Begriff stammt ja von mir, in dem Fachbuch wird er zwar häufig erwähnt, aber auch nicht genauer beschrieben, wie es technisch geschieht.Oliver S.Y. (Diskussion) 17:42, 5. Jun. 2014 (CEST)
- [1] zwar nicht als Quelle tauglich, aber in der Mitte der Bildreihe ein paar Bilder mit dem Eissschnee bei der Verwendung.Oliver S.Y. (Diskussion) 17:45, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Es heißt übrigens crushed ice. Die andere Schreibweise ist ein bei Deutschen beliebter Schreibfehler. --Rôtkæppchen₆₈ 17:51, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Wobei dieses Eis von der Stange geraspelt ist. Es soll sich möglichst fein zu Wasser werdend in der Wurstmasse verteilen.--79.232.199.238 18:14, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Das Eis bei der Wurstzubereitung muss so fein zer- und verteilt sein, damit die Wurstmasse im Kutter (Lebensmittelherstellung) nicht vorzeitig gerinnt. Das würde minderwertige Wurst ergeben. --Rôtkæppchen₆₈ 18:29, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Wobei dieses Eis von der Stange geraspelt ist. Es soll sich möglichst fein zu Wasser werdend in der Wurstmasse verteilen.--79.232.199.238 18:14, 5. Jun. 2014 (CEST)
- noch minderwertiger? *scnr* --Heimschützenzentrum (?) 21:44, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Kauf Dir eine gute Qualitätswurst und überleg Dir, was man daran alles schlechter machen kann. Ich weiß, dass Wurst optisch und geschmacklich aufbereitete Schlachtabfälle sind. --Rôtkæppchen₆₈ 23:42, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Besnonders kreativ muss man da gar nicht sein: Ich kann mich noch gut an den Fall vor etwa 15…20 Jahren erinneren, als es einem Wurstfabrikanten zu mühsam oder zu teuer geworden war, die Kunststoffbehälter der Flüssigwürze die er für die Wurstherstellung verwendete, fachgerecht zu entsorgen. Er hat sie einfach kleinschneiden und die Stücke in den Kutter zum Brät werfen lassen. Dort wurden sie soweit zerkleinert, dass die Körnchen neben den Sehnenstückchen in der fertigen Wurst nicht mehr aufgefallen sind.
- Rausgekommen ist es durch einen der Angestellten dem das nicht gefiel und der das öffentlich gemacht hat. Schon damals wurde auch ihm, als eine Art „Mini-Joseph“, sein Verhalten nicht gedankt: Er wurde entlassen und hatte anschließend größte Mühe, einen
seriösenneuen Arbeitgeber zu finden. --79.216.213.40 09:01, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Kauf Dir eine gute Qualitätswurst und überleg Dir, was man daran alles schlechter machen kann. Ich weiß, dass Wurst optisch und geschmacklich aufbereitete Schlachtabfälle sind. --Rôtkæppchen₆₈ 23:42, 5. Jun. 2014 (CEST)
- noch minderwertiger? *scnr* --Heimschützenzentrum (?) 21:44, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Rotkäppchen, Schlachtabfälle würde ich das nicht nennen. Wurst wird natürlich nicht vor allem aus großen, schieren Fleischstücken gemacht, sondern mehr aus dem Kleinkram und Teilen, die nur zerkleinert genießbar sind. Abfälle sind das deshalb aber noch lange nicht. Es ist doch richtig, möglichst alle Teile zu verwerten. Rainer Z ... 14:25, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Die Bezeichnung Schlachtabfall hab ich absichtlich polemisch verwendet. Ich weiß so ungefähr, was in Wurst drin ist und halte gute Wurst keinesfalls für minderwertig. Manche Metzger kommen halt in Versuchung, da Dinge reinzumachen, die da nicht hineingehören. Aber es gibt auch gute Metzger, denen es auf Qualität ankommt und die ihren Kunden so etwas nie antun würden. --Rôtkæppchen₆₈ 15:32, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Rotkäppchen, Schlachtabfälle würde ich das nicht nennen. Wurst wird natürlich nicht vor allem aus großen, schieren Fleischstücken gemacht, sondern mehr aus dem Kleinkram und Teilen, die nur zerkleinert genießbar sind. Abfälle sind das deshalb aber noch lange nicht. Es ist doch richtig, möglichst alle Teile zu verwerten. Rainer Z ... 14:25, 6. Jun. 2014 (CEST)
Hallo! Nachdem ich heute drei Experten befragen durfte, der englische Begriff dafür ist Shave Ice, und en:WP hat einen Arikel [2].Oliver S.Y. (Diskussion) 02:29, 9. Jun. 2014 (CEST)
Rassismus?
In einer recht normalen Online-Community, in der man andere Leute anschreiben kann, das auch viele zur Partnersuche nutzen, liest man ab und an solche Profile auf denen steht, dass der User nicht von Personen aus nicht deutscher Abstammung oder nur von Deutschen angeschrieben werden möchte. Häufig noch mit dem Hinweis, dass dies ja nicht rassistisch gemeint ist oder so wirken soll. Letztlich ist das aber doch Rassismus oder nicht? Oder wenn nicht, was dann? --178.5.187.195 21:05, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Evtl. eher Nationalismus --Cubefox (Diskussion) 21:12, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Erstmal dies, und dann ist jedermanns Recht, sich die eigenen "Freunde" selbst auszusuchen. Ob's sinnvoll ist, das nach Nationalität zu tun steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Andererseits ist das vermutlich eh nur Getrolle. -- Janka (Diskussion) 21:15, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Ich denke mal, dass sich das weniger auf die Nationalität bezieht, gegen einen Österreicher werden die vermutlich nicht viel sagen (die Leute die so etwas schreiben sind wohl nicht die Schlausten). Ich würde schätzen, dass damit eher Südländer und was manche unter diesem Begriff sammeln, verstehen. Oder Moslems, Türken, usw. Und natürlich ist das zulässig sich auszusuchen mit wem man zu tun haben möchte, aber ein Unternehmen dürfte das eher nicht, da wäre es dann ja rassistisch. Aber gibt es solchen Privat-Rassismus oder ist das eben vielleicht doch nicht rassistisch? Weil Rassismus ist ja diskriminierend, aber das ist es gewissermaßen ja auch (nicht rassistisch diskriminierend, aber gewissermaßen anders), wenn man keinen Partner unter 1,70m möchte oder nichts mit Leuten zu tun haben möchte, die ungebildet sind. Oder? --178.5.187.195 21:24, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Es ist für die Frage "Ist das Rassismus?" völlig unerheblich, von wem eine Äußerung ausgeht oder welchem Zweck sie dient. Wesentlich ist, dass die Äußerung mit einer verallgemeinernden Begründung unterlegt ist. Wenn da also jemand schreibt: "Ich will keinen Kontakt mit Türken" ist das logischerweise nicht rassistisch, weil keine Gründe genannt werden. Schreibt er "Ich will keinen Kontakt mit Türken, weil Türken ... sind" ist das eindeutig rassistisch, weil es ein Allgemeinurteil enthält, das niemals richtig sein kann (Außer "weil Türken Türken sind"). Grenzwertig: "Ich will keinen Kontakt mit Türken, weil ich schlechte Erfahrungen mit einem Türken gemacht habe." Hier kommt es auf den Kontext an. Ich würde dann aber mit ziemlicher Sicherheit auf Trollerei tippen, die eben diese Grenze in der gegebenen Community ausloten soll. -- Janka (Diskussion) 21:35, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Ich denke mal, dass sich das weniger auf die Nationalität bezieht, gegen einen Österreicher werden die vermutlich nicht viel sagen (die Leute die so etwas schreiben sind wohl nicht die Schlausten). Ich würde schätzen, dass damit eher Südländer und was manche unter diesem Begriff sammeln, verstehen. Oder Moslems, Türken, usw. Und natürlich ist das zulässig sich auszusuchen mit wem man zu tun haben möchte, aber ein Unternehmen dürfte das eher nicht, da wäre es dann ja rassistisch. Aber gibt es solchen Privat-Rassismus oder ist das eben vielleicht doch nicht rassistisch? Weil Rassismus ist ja diskriminierend, aber das ist es gewissermaßen ja auch (nicht rassistisch diskriminierend, aber gewissermaßen anders), wenn man keinen Partner unter 1,70m möchte oder nichts mit Leuten zu tun haben möchte, die ungebildet sind. Oder? --178.5.187.195 21:24, 5. Jun. 2014 (CEST)
- BK
- "Deutscher Abstammung" oder auch "nicht deutscher Abstammung" ist völliger Schwachsinn, wenn man nicht wenigstens die Generation dazu sagt. Oder auch die Mindestgroßelternzahl: Ist jemand mit drei deutschen und einem finnischen Großelternteil nun "deutscher Abstammung" oder "Viertelfinne" oder was?
- Wer nur Deutsche kennenlernen will, ist hingegen sicherlich jemand, der selbst noch nicht lange da ist (ich gehe mal davon aus, dass diese zunächst digitalen Kontakte dann auch in der Realwelt weitergeführt werden sollen) und der natürlich von seinen Kumpels in der Kneipe oder aufm Tennisplatz möglichst akzentfreies Deutsch lernen will... Hummelhum (Diskussion) 21:29, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Deutsch-völkisch-nationalistisch trifft es wohl in der Formulierung mit der „Abstammung“. In der Formulierung „nur von Deutschen“ ist es nicht so klar, das kann verschiedenes heißen (siehe etwa Humelhums Spekulation, dass sich auch dort völkischer Nationalismus äußert, halte ich aber auch für möglich). Inwiefern das mit rassistischen Vorstellungen verbunden ist, lässt sich nicht sicher sagen, es liegt aber nahe und die Prävalenz ist auch einfach hoch im deutschsprachigen Raum, bei Völkisch-Nationalen erst recht. Findet man bei „ganz normalen“ Leuten, daher natürlich auch in „ganz normalen“ Communitys. Siehe dazu etwa diese jüngste Studie. Besser machts das nicht. Auch was „zulässig“ im Sinne von Gesetzen und Rechtssprechung ist, kann auf ein Problem mit den Einstellungen von Leuten hinweisen. Bei einer solchen kritischen Betrachtung muss es auch nicht darum zu gehen, nun dem Individuum einen moralischen Vorwurf zu machen. Jedenfalls hilft der Gedanke über die „Partner unter 1,70 m“ bei der Frage sicherlich nicht weiter, der macht rassistisches Gedankengut auch nicht weniger rassistisch.
- @Janka Ist ja schön und gut, dass der Staat nicht mit der Justiz gegen Leute vorgeht, die sich ihre Freunde nach Nationalität aussuchen. Darüber, was mutmaßliche ideologische Hintergründe von Äußerungen sind, und welchen ideologischen Gehalt Äußerungen vermitteln, kann man sich hoffentlich trotzdem kritisch unterhalten. --Chricho ¹ ³ 21:48, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Die Veröffentlichungen der Stiftung sind gut, aber andere Experten auf dem Gebiet warnen auch vor einer Bagatellisierung der Begrifflichkeiten für Alltagsphänomene, was zu einer Abstumpfung führt, und bei wirklichen Problemen dann zu fehlender Unterstützung führt. Man muß da nämlich "Fremdenangst" (Xenophobie) von "Fremdenfeindlichkeit" strikt trennen. Denn Angst kann auf eigene Erfahrungen, Erziehung aber auch dem gesellschaftlichen Umfeld beruhen. Das Political Correctnes führt zu solch paradoxen Konstrukten wie diesen, wo sachfremd über "deutsche Abstammung" gesprochen wird, obwohl man auch keinen Russlanddeutschen begrüßt. Das Problem ist aber doch, das die "Fremden" untereinander genau die selben Phänomene haben. Europäer, Asiaten aus Nah- und Fernost lehnen Schwarzafrikaner ab. Westeuropäer lehnen Osteuropäer ab, usw. Wir sind eben nicht alle gleich, und wer mit Leuten aus anderen Kulturkreisen schlechte Erfahrung gemacht hat, den kann man nicht pauschal mit "völkisch/nationalistisch" gleichsetzen, da die Ablehnung von Fremden weder automatisch mit Gewalt oder deren Rechtfertigung noch mit der übersteigerten Wertschätzung der eigenen Nationalität zu tun hat.Oliver S.Y. (Diskussion) 22:02, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Es liegt doch auf der Hand, dass Äußerungen wie "nur Volksdeutsche" oder ähnlicher Unsinn lediglich dem Zweck der Provokation dienen, allerdings ziemliche ärmliche. "SS-Ausweis vom Opa muss vorliegen" hätte wenigstens das Potential, die versammelte Adminschaft wegen Diskriminierung einer Weltanschauung dranzukriegen. -- Janka (Diskussion) 22:14, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Ausschlüsse sind in Kontaktanzeigen sehr häufig ((siehe Anzeige ganz unten.) Der Rest ist auch ganz gut.--Optimum (Diskussion) 22:31, 5. Jun. 2014 (CEST)
- (BK) Gerade dass es sich um Alltagsphänomene handelt, macht die Angelegenheit so relevant. Fast die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage „Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden.“ zu. Wie soll man da anders, als ein zutiefst kritisches Bild von der gesellschaftlichen Lage zu haben? Man lasse sicht das Wort „verbannen“ auf der Zunge zergehen. Gerade auch die Möglichkeit solch sprunghaften Anstiegs in kurzer Zeit, wie in der Studie beim Antiziganismus diagnostiziert, bereitet mir Sorgen: Ich verstehe das so, dass Denkmuster auf Abruf bereitgehalten werden, sich in ihrer Grundstruktur erhalten, und ehe man sichs versieht, vertreten die, die zuvor einer These noch „eher ablehnend“ in der Befragung gegenübertraten, diese ganz offensiv.
- Für mich hat das nichts mit einer Bagatellisierung zu tun. Vielmehr sehe ich, dass manche versuchen, beispielsweise Rassismus, Antiziganismus und Antisemitismus auf ein „Anderes“ zu projizieren, auf die Außenstehenden, die Rechtsextremen und somit ihre Wirkmächtigkeit verkennen. Das muss nicht davon abhalten, die Spezifika von Parteien und Strömungen am äußersten rechten Rand klar zu benennen und sie von anderen Strömungen abzugrenzen. Die NPD oder die Identitäre Bewegung lassen sich aber nicht dadurch abgrenzen, dass es bei ihnen Rassismus gäbe und anderswo nicht – da muss man schon genauer hinschauen.
- Eine „strikte Trennung“ von „Fremdenangst“ und „Fremdenfeindlichkeit“ ist mir in keiner Theorie bekannt, wie ohnehin der Begriff der Xenophobie kaum als allgemeines Paradigma taugt. „Wertschätzung der eigenen Nationalität“ lässt sich nicht einfach als eine Spielart oder Konsequenz von einer „Ablehnung von Fremden“ betrachten, da hast du schon recht. Da zeigen sich Grenzen des Konzepts der Xenophobie, das macht Kritik aber nicht überflüssig, sondern an anderer Stelle notwendig. Es sei am Rande noch angemerkt, dass das Lexem „phobie“ etwa in „Xenophobie“, „Homophobie“ und „Transphobie“ äußerst irreführend ist. Es handelt sich bei besagten Phänomenen nicht um Phobien, ein Begriff aus der Psychopathologie. Auch eine Reduktion auf einen Begriff der Angst entspricht nicht dem üblichen (soziologischen) Verständnis.
- Selbstverständlich beruhen etwa Rassismus, Nationalismus und Xenophobie auf Erfahrungen, Erziehung und gesellschaftlichem Umfeld. Das ist eine Banalität. Ich habe für Rassismus übrigens vollstes Verständnis. Ich weise selbst rassistische Denk- und Verhaltensweisen auf. Ich sehe, wie andauernd solche eintrainiert werden. Ja, durch Erziehung, Peergroup, Medien … All das ist aber kein Grund für mich, dies zu akzeptieren oder gar für gut oder notwendig zu erklären.
- Dass es auch individuelle psychologische Phänomene geben kann, bei denen irgendwelche Kategorien einfließen, die ähnlich auch bei der Beschreibung von Rassismus auftreten, mit Rassismus aber nichts zu tun haben, will ich nicht in Abrede stellen. Wenn ein jüdischer KZ-Häftling nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder mit deutschem Boden und der deutschen Sprache in Berührung kommen wollte, dann hat das nichts mit Rassismus zu tun. Da wird weder in Rassen gedacht, noch homolog in irgendwelchen Kulturen, da haben schlichtweg extreme Erlebnisse tief verbunden mit Auftreten von „Deutschem“ ihre Wirkung entfaltet. --Chricho ¹ ³ 22:52, 5. Jun. 2014 (CEST)
Leute, hier geht's um ein Partnersuchportal. Wenn's um "normale" Kontakte unter Nutzern irgendeines beliebigen Internetforums ginge, fände ich einen solchen Ausschluss vollkommen indiskutabel.
Bei Partnersuchportalen können allerdings auch andere Faktoren eine Rolle spielen, die man fairerweise nicht unbedingt sofort in die Rassismusschublade packen sollte. Mir ist persönlich ein Fall bekannt, wo jemand, der ganz sicher vollkommen Rassismus-unverdächtig ist, über solche Portale mehrfach angeschrieben wurde von Frauen, die es mit dem Heiraten sehr eilig hatten (= offensichtlich auf der Suche nach einer Aufenthaltsgenehmigung) oder aber vermutlich nichtexistent waren (Love Scams und Co.). Wenn jemand sowas ein paarmal mitgemacht hat, kann ich es sogar verstehen, dass er bei der Partnersuche bestimmte Dinge ausschließt. Und ich lege dabei Wert auf die Feststellung, dass mir jegliche Form von Rassismus ein Greuel ist. --Anna (Diskussion) 22:59, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Wurde ja hinreichen dargestellt, dass die Rassismusschublade nicht passt. Man muss halt differenzieren. --Chricho ¹ ³ 23:02, 5. Jun. 2014 (CEST)
Problematisch finde ich, wie heutzutage Diskriminierung und Rassismus reflexhaft negativ konnotiert bewertet werden. Diskriminierung ist nichts anderes als ein Fremdwort für Unterscheidung; in vielen Wissenschaften wird es daher auch rein in dieser Bedeutung verwendet. Rassismus ist da eine Unterform, die Anhand der Zugehörigkeit zu eine Menschenrasse (völlig willkürlicher Begriff letztlich, ist aber hier unwichtig) eine allgemeine Unterscheidung vornimmt. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. So zu tun, als gäbe es gar keine Unterschiede, wäre nämlich Verleugnung. Was vermieden werden sollte ist, sich an Pauschalisierungen festzukrallen, aber genau das ist Normalität/die Natur des Menschen. Menschen vereinfachen und packen alles in Schubladen, um sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden, wobei sie sich fortwährend darum bemühen, es ihrem Umfeld gleich zu tun - es sei denn, sie sind autistisch, aber das führt zur sozialen Ausgrenzung, weil es das gleichartige Schubladendenken ist, das Menschen zu Gruppen verbindet. Gemeinsames Reflektieren und Diskutieren können aus diesem Dilemma herausführen, aber das ist ein ausgesprochen zäher und schwerfälliger Prozess. --88.68.71.205 23:32, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Nun, das Wort „Diskriminierung“ wird aber auch anders benutzt als im Sinne von „Unterscheidung“. Diese Sprachentwicklung mag dir nicht gefallen, du musst aber anerkennen, dass es eben in vielen Situationen etwas anderes bedeutet.
- Rassenkonstruktionen sind nicht wertfrei und per se essentialistisch. Und da gehe ich nicht mit dir mit, das als „nicht grundsätzlich schlecht“ zu bewerten. Rassismus abzulehnen hat nichts damit zu tun, die große Vielheit in dieser Welt zu leugnen. Damit, dass der Rassismus die Menschen zu Gruppen verbindet, hast du natürlich völlig recht.--Chricho ¹ ³ 23:53, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Bzgl. meinem Missfallen an der Sprachentwicklung liegst Du richtig, der Rest ist verdreht und unterstellend, da spiele ich nicht mit. --88.68.71.205 01:05, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Da gibt's nichts zu spielen. Der Begriff "Diskriminierung" ist im Alltagsdeutsch heute ganz eindeutig und praktisch ausschließlich so konnotiert - ob's einem passt oder nicht.
- Und Rassismus ist allerdings und sehr wohl pauschal und per se negativ zu bewerten, weil schon der Begriff der "Rasse" - auf den Menschen angewendet - wissenschaftlich nicht haltbar ist. Seine Verwendung kann von daher nur einem einzigen Zweck dienen - dem bekannten. --Anna (Diskussion) 09:19, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Naja - Diskriminierung muss sich nicht auf ein Pseudomerkmal wie "Rasse" beziehen. In diesem Zusammenhang finde ich z.B. en:Anti-Irish_sentiment ganz interessant - das betrifft eine Gruppe, die nach amerikanischer Diktion zur "caucasian race" gehört. --Zerolevel (Diskussion) 09:59, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Nein, wer sagt das? Es kann sich natürlich auf alles Mögliche beziehen, auf Behinderungen, auf Haarfarbe, auf Nationalität, auf Dialekt, auf sonstwas.
- Die IP bezog sich aber auf den fachsprachlich-gehobenen Gebrauch des Wortes "Diskriminierung" im Sinne von "Unterscheidung". Mal abgesehen davon, dass der Begriff "Diskriminierung" hier im Thread auch gar nicht Thema war, ist das ganz einfach ein Sprachgebrauch, der in heutiger normaler Alltagssprache nicht nennenswert vorkommt. --Anna (Diskussion) 10:07, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Naja - Diskriminierung muss sich nicht auf ein Pseudomerkmal wie "Rasse" beziehen. In diesem Zusammenhang finde ich z.B. en:Anti-Irish_sentiment ganz interessant - das betrifft eine Gruppe, die nach amerikanischer Diktion zur "caucasian race" gehört. --Zerolevel (Diskussion) 09:59, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn es keine Menschen-Rassen gibt, wie kommt es dann, daß Schwarze bestimmte Medikamente in höherer Dosierung nehmen müssen, daß Japaner viel öfter keine Milch vertragen, daß Kreuz-Allergien bei Spaniern anders verteilt sind als in Deutschland etc. etc.? --Geometretos (Diskussion) 11:27, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Siehe den Artikel Rassentheorien. Natürlich gibt es jede Menge genetischer Unterschiede zwischen den Menschen, die sich dann auch in unterschiedlichen Hautfarben, Allergien, etc. bemerkbar machen. Diese Unterschiede lassen sich aber kaum sinnvoll klassischen Großrassen zuordnen. Bei der Hautpigmentierung gibt es jede Menge fließender Übergänge, da mussten schon die Rassentheoretiker mit ihren Konzepten von Mischrassen zugeben, dass ihre Systematik so nicht funktioniert. Ansonsten sind die genetischen Unterschiede häufig innerhalb einer bestimmten Population zu finden. Es gibt halt wirklich zig verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, was Gene angeht und so findet man bei "den Schwarzen" eben auch eine sehr diverse genetische Ausstattung. Ein Mensch aus Äthiopien hat eben andere Gene als einer aus Botswana oder einer aus den USA. Ansonsten, bei der ursprünglichen Fragestellung ging es auch weiger um genetisch-biologische Eigenschaften, sondern um vermeintliche Charaktereigenschaften, die man einer Rasse zuschreibt. Das sind aber nun wirklich willkürliche Konstrukte. Schlaue, dumme, egoistische, altruistische, aggressive, friedfertige, höfliche, unhöfliche Menschen gibt es in jeder "Rasse". --178.8.109.235 12:30, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Klar gibt es Menschenrassen. Und zwar als vorwissenschaftliche Kategorien in der Vorstellungswelt mancher Ärzte, die aber trotzdem manchmal in der Behandlungspraxis helfen können. --Chricho ¹ ³ 14:22, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Na ja. Diese Feststellung ist ungefähr so hilfreich wie: Es gibt Menschenrassen in der Vorstellungswelt amerikanischer Formularersteller, und in der amerikanischen Vorstellungswelt soll die Erfassung solcher Dinge womöglich gar der Bekämpfung von Rassismus dienen. --Anna (Diskussion) 14:55, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Jo, sehr anders sollte sie auch nicht sein – bloß mit Bezug zu dem von Geometretos angesprochenen Punkt. --Chricho ¹ ³ 17:17, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Na ja. Diese Feststellung ist ungefähr so hilfreich wie: Es gibt Menschenrassen in der Vorstellungswelt amerikanischer Formularersteller, und in der amerikanischen Vorstellungswelt soll die Erfassung solcher Dinge womöglich gar der Bekämpfung von Rassismus dienen. --Anna (Diskussion) 14:55, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Bzgl. meinem Missfallen an der Sprachentwicklung liegst Du richtig, der Rest ist verdreht und unterstellend, da spiele ich nicht mit. --88.68.71.205 01:05, 6. Jun. 2014 (CEST)
Wenn Anthropologen und andere heutzutage von Ethnien, Volksgruppen, Stämmen usw. sprechen, ist das auch nichts anderes, als eine Weiterentwicklung der Rassenkunde, bloß in neuem Gewand, um sich von der problematischen Arbeitseinstellung der Rassekundler zu Kolonialzeiten abzugrenzen und weil der Begriff Rasse sich allgemein eher wenig für wissenschaftliches Arbeiten eignet, denn Rasse ist ein abstrakter Ordnungsbegriff, vergleichbar mit der Klasse in der Logik oder der Sorte, der Art im umgangssprachlichen Sinne. Er bezeichnet beliebige Zusammenfassungen von nach subjektivem Ermessen gruppierten Lebewesen einer Art. Seine fachlich korrekte Verwendung beschränkt sich auf die Klassifikation von Zuchtformen; frühere Anwendungen, etwa in den biologischen oder anthropologischen Wissenschaften, sind weitgehend obsolet. In der Biologie hat sich seit dem 19. Jahrhundert anstelle der „Rasse“ allmählich die Unterart durchgesetzt, die weniger Raum für willkürliche Unterteilungen bietet, da sie deutlich strenger definiert ist.
Der Rassebegriff avancierte insbesondere im 19. Jahrhundert zu einer anpassungsfähigen und flexiblen Ordnungskategorie fast beliebiger sozialer und kultureller Entitäten, keineswegs nur im biologistischen Sinne. Christian Geulen sieht den Rassebegriff in Zusammenhang mit Zeiten verunsicherter Zugehörigkeitsgefühle, so aktuell in der Globalisierung. Der jeweilige Rassebegriff wird demnach benutzt, um zunächst hergebrachte oder neue Grenzen von Zugehörigkeit theoretisch zu begründen und diene praktisch, im Rassismus, dazu, die erfahrbare Wirklichkeit diesen Vorgaben anzupassen. Er geht damit über statisch affirmative Vorurteilsstrukturen, Animositäten und ideologische Feindbilder hinaus.[1] Wie der Evolutionsbiologe Ernst Mayr betont, basieren alle rassistischen Theorien darauf, Rassen nicht als Abstraktion, sondern als Realität aufzufassen.[2] (Einleitung aus dem WP-Artikel Rasse, die es sehr gut auf den Punkt bringt) --178.4.178.171 09:42, 8. Jun. 2014 (CEST)
- "Wenn Anthropologen und andere heutzutage von Ethnien, Volksgruppen, Stämmen usw. sprechen..." - nein, das trifft nicht zu. Es geht bei den Ethnien ausschließlich um soziokulturelle Aspekte, nicht um die biologische Herkunft der Mitglieder der Ethnie. Hummelhum (Diskussion) 17:54, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Och Hummelhum, lies doch wenigstens mein Zitat. Extra für Dich nochmal rauskopiert: Der Rassebegriff avancierte insbesondere im 19. Jahrhundert zu einer anpassungsfähigen und flexiblen Ordnungskategorie fast beliebiger sozialer und kultureller Entitäten, keineswegs nur im biologistischen Sinne. --178.4.178.171 18:31, 8. Jun. 2014 (CEST)
- "Wenn Anthropologen und andere heutzutage von Ethnien, Volksgruppen, Stämmen usw. sprechen..." - nein, das trifft nicht zu. Es geht bei den Ethnien ausschließlich um soziokulturelle Aspekte, nicht um die biologische Herkunft der Mitglieder der Ethnie. Hummelhum (Diskussion) 17:54, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Danke, danke, ist mir alles bekannt. Jedenfalls umfasste der Begriff "Rasse" auch den Bio-Anteil, basierte auf diesem und ist heute noch in der Lage, dem Laien was Biologisches zu suggerieren.
- Der Begriff der Ethnie kann sich nicht auf biologische Aspekte beziehen. Wo er heute so gebraucht wird, als könne er auch Aspekte der biologischen Abstimmung umfassen, ist in jedem Fall von schlimmster Unwissenheit, meist aber von vorsätzlich diskriminierenden Haltungen auszugehen. Hummelhum (Diskussion) 21:17, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Unterstelle niemals Bösartigkeit, wenn Dummheit als Erklärung ausreicht;) Die meisten Menschen sind von diesen Begrifflichkeiten komplett überfordert und plappern eher gedankenlos nach, was sie meinen, mal irgendwo gehört zu haben. --178.4.178.171 21:55, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Rassismus braucht keine „Vorsätzlichkeit“. --Chricho ¹ ³ 11:58, 9. Jun. 2014 (CEST)
Parkschein
Ganz ernsthafte Frage: Wäre das da in Deutschland erlaubt? IMHO liegt der Parkschein "von außen gut sichtbar auf dem Armaturenbrett" Gruß --Gruenschuh (Diskussion) 23:29, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Gute Frage. "Gut sichtbar" ja, gut erkennbar nein. Hier ginge es in einem Prozess wohl um Geist und Buchstaben, da ist das Urteil schwer vorhersehbar. Auch wenn es nicht zur Frage gehört: Ich mag den, der so etwas macht, nicht leiden. Grüße Dumbox (Diskussion) 23:35, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist sicher nicht gut sichtbar, sondern gut getarnt. --Rôtkæppchen₆₈ 23:39, 5. Jun. 2014 (CEST)
- Gut sichtbar durchaus, gut erkennbar an sich auch - sobald man auf den aktuellen draufguckt und ihn inmitten dieser Vielfalt nicht übersieht. Wenn deswegen dann ein Ticket kommt, muss man selber den Parkschein raussuchen und vorlegen. Kein Grund für die Kontrolleure, sich zu ärgern, kann denen doch wurscht sein, machen sie hält ein Photo davon und dann kann sich der PKW-Besitzer gegenüber dem Amt erklären. --88.68.71.205 23:55, 5. Jun. 2014 (CEST)
Schön und gut, aber was wäre der offizielle Grund/Tatbestandsnummer auf dem Ticket? --Gruenschuh (Diskussion) 00:30, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Kein gültiges Ticket gefunden:) --88.68.71.205 00:56, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Schwer vorherzusehen, aber ehrlich gesagt würde ich nicht empfehlen, es zu versuchen - die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht und man hinterher auf deutlich höheren Kosten sitzenbleibt, überwiegt bei weitem. --Snevern 10:16, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Erinnert an die Sache mit den Schweizer Autobahnvignetten. Dort läuft hartnäckig der Volksglaube um, man dürfe nicht mehr als insgesamt drei Vignetten an der Scheibe haben; wer neben der aktuell gültigen mehr als zwei alte dranhabe, werde bestraft. Nur findet sich diese Info auf keiner offiziellen Seite... Hummelhum (Diskussion) 13:07, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Auf den meisten Parktickets steht eine Bedienungsanleitung drauf, wie sie auszulegen sind.--Wikiseidank (Diskussion) 13:09, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Würde mich wundern, wenn dort explizit "legen sie keine anderen Tickets dazu" stände. --mfb (Diskussion) 14:23, 6. Jun. 2014 (CEST)
- "IMHO liegt der Parkschein "von außen gut sichtbar auf dem Armaturenbrett" " Das kannst du so für dich interpretieren. Aber was würde sich ein Richter dazu denken? Die Gegenseite würde argumentieren: Der Parkschein soll nicht sichtbar sondern sogar "gut sichtbar" auf dem Armaturenbrett liegen. Der Sinn dieser Forderung ist offensichtlich. Die gute Sichtbarkeit soll eine schnelle und unbehinderte Prüfung der Parkberechtigung sicherstellen. Die Anforderung einer entsprechenden Mitwirkung des Parkenden an diesem nachvollziehbaren Ziel ist, unabhängig davon, daß es sich hier um einen Vertragsbestandteil zwischen dem Parkenden und der Parkraumbewirtschaftung handelt, generell als zumutbar und berechtigt anzusehen. Im vorliegenden Fall hat der Parkende einen erheblichen sachlichen und zeitlichen Aufwand betrieben, um genau dieses Ziel zu unterlaufen und das Gegenteil zu erreichen. Er hat nicht nur eine große Anzahl Parkscheine gesammelt und auf dem Armarturenbrett ausgelegt. Er hat zusätzlich noch einen Ausdruck mit dem Text "Liebe Politesse Viel Glück beim Suchen" und einer Grafik angefertigt und an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt. Es handelt sich also um keine gedankenlose oder spontane Handlung sondern um einen bewußt und von langer Hand vorbereiteten Versuch, auf eine möglichst geringe Sichtbarkeit des Parkscheins hinzuwirken und das Bemühen einer Kontrolle ironisch zu verhöhnen. Der Text des Ausdrucks belegt, daß sich der Parkende darüber im Klaren war, daß sein Handeln die Mitarbeiter des Ordnungsamtes oder Politessen zum Suchen zwingt, daß er also der geforderten guten Sichtbarkeit des Parkscheins bewußt und gezielt entgegenwirkt. Die geforderte und vertraglich vereinbarte gute Sichtbarkeit war tatsächlich durch das willentliche und zielgerichtete Einwirken des Parkenden nicht mehr gegeben, auch wenn im Prinzip noch von einer Sichtbarkeit ausgegangen werden kann. Es kann daher ein Verwarngeld verhängt werden. – Tja, Und dann kannst du überlegen, ob du unter diesen Umständen das Risiko der Prozeßkosten tragen willst... --212.184.142.183 14:47, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Armaturen wäre richtig gewesen. Dumbox (Diskussion) 15:02, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Stimmt, ich bin total durcheinander gekommen :-) Habs korrigiert, danke --212.184.142.183 15:21, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Sauber. Kann man wortwörtlich in die Urteilsbegründung übernehmen. :-) --Jossi (Diskussion) 16:27, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Armaturen wäre richtig gewesen. Dumbox (Diskussion) 15:02, 6. Jun. 2014 (CEST)
- (BK)Mir ist die Motivation für diese Aktion nicht klar. Worin liegt der Vorteil, der Politesse "eine Nase zu drehen"? Man spart sich ja nicht die Parkgebühr oder so. Bestenfalls findet sie den Parkschein relativ schnell und geht weiter. Möglicherweise fühlt sie sich aber - zu Recht - veräppelt und stellt ein Knöllchen aus, weil angeblich kein gültiger Parkschein dabei war. Dann muss man Einspruch einlegen, den gültigen Parkschein nachweisen, sich mit Behörden rumstreiten usw. Wenn man nicht gerade Rechtsanwalt ist, der das als Fingerübung betrachtet, liegt der Nutzen doch eindeutig im Negativen. Man sitzt ja sicher auch nicht im nächsten Busch und beobachtet sein Auto, also ist das einzige Ergebnis, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit > null bei der Rückkehr ein Knöllchen hat. Hä??? --Optimum (Diskussion) 15:13, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Das mit dem Busch würde ich nicht von vornherein ausschließen. Es geht darum, dass jemand von den Guten (Autofahrer) es jemandem aus dem Reich des Bösen (Politesse) mal aber so richtig zeigt. Was ich davon halte, schrieb ich ja schon Grüße Dumbox (Diskussion) 15:20, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Was man sehen würde, ist eine Politesse, die ins Auto guckt und weitergeht. Oder eine Politesse, die ins Auto guckt, ein Knöllchen ausstellt und weitergeht. Was hätte man sich denn erhofft? Dass sie sich die Haare rauft und dann tränenüberströmt vor dem Auto zusammenbricht? --Optimum (Diskussion) 15:39, 6. Jun. 2014 (CEST)
- @Optimum: Für den Parkenden gibt es keinen Vorteil - aber er schadet anderen. Das ist es, was er will. Manche Menschen sind so. Würd mich interessieren, was Knöllchen-Horst zu sowas sagt. --88.130.77.185 16:39, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Das mit dem Busch würde ich nicht von vornherein ausschließen. Es geht darum, dass jemand von den Guten (Autofahrer) es jemandem aus dem Reich des Bösen (Politesse) mal aber so richtig zeigt. Was ich davon halte, schrieb ich ja schon Grüße Dumbox (Diskussion) 15:20, 6. Jun. 2014 (CEST)
- (BK)Mir ist die Motivation für diese Aktion nicht klar. Worin liegt der Vorteil, der Politesse "eine Nase zu drehen"? Man spart sich ja nicht die Parkgebühr oder so. Bestenfalls findet sie den Parkschein relativ schnell und geht weiter. Möglicherweise fühlt sie sich aber - zu Recht - veräppelt und stellt ein Knöllchen aus, weil angeblich kein gültiger Parkschein dabei war. Dann muss man Einspruch einlegen, den gültigen Parkschein nachweisen, sich mit Behörden rumstreiten usw. Wenn man nicht gerade Rechtsanwalt ist, der das als Fingerübung betrachtet, liegt der Nutzen doch eindeutig im Negativen. Man sitzt ja sicher auch nicht im nächsten Busch und beobachtet sein Auto, also ist das einzige Ergebnis, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit > null bei der Rückkehr ein Knöllchen hat. Hä??? --Optimum (Diskussion) 15:13, 6. Jun. 2014 (CEST)
- @Optimum: Ich sehe da einen anderen Ansatz. Ein solches Verhalten, das übrigens seit Jahren im Web Wellen schlägt ([3], [4]) wird nur durch einen grundsätzlicheren Blick verständlich. Seit sehr langer Zeit ist Autofahren mit der Vorstellung von Wohlstand und persönlicher Freiheit konnotiert. Nicht nur der Freiheit, zu fahren, wohin man will (und wie schnell man will, siehe z.B. "Freie Fahrt für freie Bürger", Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei Deutschlands oder die Bedrohung der Ölpreisschocks) sondern auch Freiheit von anderen, von dem Gedränge in den Bussen und Bahnen.
- Verfolgt man die Argumente und die Werbung über die Jahrzehnte, so treten Aspekte wie Kosten, Verkehrsstaus, Parkplatzsuche, Feinstaub, Verschwendung von Rohstoffen, Arbeitskraft und Energieressourcen immer hinter die wirtschaftliche Bedeutung der Autoindustrie und die Marktrealität zurück und werden erst in letzter Zeit ernster genommen (z.B. ablesbar an der zunehmenden Verbreitung des Carsharings oder der Innenstadtmaut). Dabei sind die Probleme schon lange bekannt. In der Global 2000 (Studie) von 1977 kann man schon nachlesen, daß eine (angenommene und prognostizierte) Zunahme des Autoverkehrs in China auf das in den USA übliche Niveau nicht möglich sein werde.
- All diese Erkenntnisse änderten jedoch wenig an der Grundhaltung Ich will Spaß! Ich geb' Gas!. Verkehrsverhalten wird nicht als Sozialverhalten innerhalb einer Sozialstruktur begriffen sondern als Umsetzung eines Individualinteresses. Aus dieser Sicht wachsen Feindbilder, die mich an dem Ausleben meiner Interessen hindern: Geschwindigkeitsbegrenzungen, Blitzer, Langsamfahrer, Radfahrer, Parkplatzwegschnapper - und eben auch Politessen. Deren Tätigkeit wird nicht so verstanden, daß sie zu einer die Gesellschaft finanziell belastenden Notwendigkeit geworden sind, um dem zunehmenden asozialen Verhalten von Verkehrsteilnehmern ein Korrektiv entgegenzusetzen. Sie wenden eher als persönliche Zumutung und Schikane erlebt.
- Zugegeben ist es nicht immer einfach, auch in gesellschaftlichen Dimensionen zu denken und diese mit den berechtigten persönlichen Interessen abzuwägen. Es ist erst recht nicht einfach, seit (stellvertretend sei das genannt) der Verkünder einer "geistig-moralischen Wende" noch in seiner Eigenschaft als Bundeskanzler seinen Beitrag und die Mithilfe bei der Aufklärung von unbestrittenen Steuer- und Parteispendenvergehen öffentlich mit der Begründung ablehnte, die mußmaßlichen Straftäter seien seine Kumpels und er habe ihnen versprochen, dichtzuhalten. Wenn man danach dann noch ganze zwei Jahre lang den Ehrenvorsitz seiner Partei behält wird es füt Otto Normalverbraucher natürlich etwas schwieriger, seinen Kindern noch so etwas wie Anstand und Achtung der Gesetze beizubringen. Zu der Legitimierung rechtsfreier Räume durch prominente Menschen, die eigentlich aufgerufen sind, das Recht zu schützen, kommt ja oft auch noch das subjektive Gefühl, das eigene Recht sei nicht ausreichend geschützt. In der Folge beginnen einige - und sehen sich oft in ihrer subjektiven Erfahrung darin berechtigt - selbst Recht zu setzen. (Der Extremfall ist dann Ein Mann sieht rot.) Nur so ist (für mich) auch zu erklären, daß jemand die vom Fragesteller eingebrachte Aktion gegen den "Feind" Politessen lustig findet oder daß sich Phänomene der Verzweifelung wie Car Walker entwickeln. --212.184.142.183 17:22, 6. Jun. 2014 (CEST) Eine Ergänzung zur Klarheit: Das Recht schützen ist nicht identisch mit: Die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse nicht verändern. Recht und Gesellschaft können sich selbstverständlich in einem demokratisch legitimierten Prozeß auch ändern. Durchaus auch grundlegend ändern. --212.184.142.183 17:40, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Gut getarnt kann treffen, gut sichtbar ist es, wenn der richtig dabei ist. Wenn Behörden wirtschaftlich denken würden, sollte klar sein, dass spätestens bei der Menge an Parkscheinen die nichtgenutzte Restparkzeit, die ja nicht anrechenbar ist, dieses Verhalten längst finanziert hätte. In Wahrheit werden Parkplätze abgebaut. Die Supermärkte bauen kostenlose zusammen mit ihren Filialen. Das macht sie wiederum attraktiver und die Autoindustrie freut es, das das Auto gefragter wird. Die Geschäfte in der Innenstadt haben damit weniger Kunden und in Folge höhere Preise. So einfach ist das. Zahlen muss es immer der Bürger und Endverbraucher. --Hans Haase (有问题吗) 21:21, 6. Jun. 2014 (CEST)
- "Liebe Politesse Viel Glück beim Suchen" ist nachträglich in das Bild eingefügt worden. Auf dem Zettel am Fahrzeug selbst war es nicht vorhanden. Also kann man die Absicht nicht so ohne Weiteres unterstellen. --91.0.142.157 11:27, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Du hast recht, daß das Bild mit diesem Text nachträglich bearbeitet wurde. Du hast nicht recht, daß sich daraus ableiten läßt, der Text sei "auf dem Zettel am Fahrzeug selbst (...) nicht vorhanden" gewesen. Der Zettel mit dem Dreirad hat jedenfalls existiert, ob da etwas draufstand (das beispielsweise über das Foto nicht erkennbar ist und was dann nachträglich ausgeglichen wurde) oder nicht und wenn ja was wäre bei einem Abstreiten durch den Parkenden oder im Zweifel durch eine Zeugenaussage von Ordnungsamtsmitarbeitern oder Politessen zu eriuieren. Das dürfte dann die Prozeßkosten noch ein schönes Stück hochtreiben. Es wurde ja ohne Zweifel ein Zettel an das Innere der Windschutzscheibe geklebt, der in einem Zusammenhang mit den ausgelegten Parkscheinen steht. Der Vorwurf des Vorsatzes wird auch nicht allein durch den Text erhärtet. Deine Schlußfolgerungen könnten daher gut als ein Versuch aufgefaßt werden, sich herauszureden und nicht zu seinem Handeln zu stehen. (Verbunden mit einer fehlenden Schuldeinsicht.) --87.149.169.112 16:14, 8. Jun. 2014 (CEST) (auch als 212.184.xxx unterwegs)
Anekdote am Rande: Früher mal gab es beim Ordnungsamt meines damaligen Wohnorts eine Anweisung, Forderungen unter 2 Deutsche Mark (für die Jüngeren unter uns: das war damals die Währung hier, also sowas ähnliches wie heute der Euro) nicht beizutreiben. Für's normale Falschparken gab's einen Strafzettel über 5 Mark, von dem man also, wenn man um dieses Geheimnis wusste, nur 3,01 Mark zahlen musste (nein, offene Beträge wurden nicht aufsummiert). Das Parkhaus kostete ab 2 Stunden 1 Minute Parkzeit 4 Mark, war also schnell teurer als das Falschparken - zumal beim Parkhaus immer kassiert wurde, während man nur ungefähr jeden zweiten Tag ein Knöllchen am falsch geparkten Auto vorfand. Simple Rechnung: Eine Woche Parkhaus mindestens 20 Mark, eine Woche Falschparken etwa 7,50 Mark. Binnen kurzer Zeit hatte ich so einen Berg von Strafzetteln angesammelt, den ich säuberlich auf der Hutablage meines 2CV (Anm. d. Verf.: das war damals ein unter Studenten beliebtes Auto Vehikel) aufreihte. Politessen gab es damals auch schon, aber ich habe es leider versäumt, mich auf die Lauer zu legen, um ihre Reaktionen zu beobachten. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. --Snevern 19:10, 8. Jun. 2014 (CEST)
6. Juni 2014
Chromium statt Chrome - und dann keine Apps/Plugins ohne Google-Konto???
Hallo, ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass man mit Chromium statt Chrome der "Datenkrake Google" entkommen könnte, und trotzdem einen "schicken" Browser hat. Also habe ich mir Chromium in meinem Debian Wheezy installiert. Nun will ich nervige Werbung ausblenden und brauche dazu das AdBlockPlus-Plugin. Der Knopf "Apps" bzw. der Link "Erweiterungen" führt aber nur zum Google Store, wo ich mich mit einer Google-Benutzerkennung anmelden muss. Mache ich was falsch oder ist das Thema Anonymität vor Google damit wieder für den Bobbes?
--88.67.144.217 02:06, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Firefox Rôtkæppchen₆₈ 02:22, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Von dem möchte ich weg, weil dort unter Linux der Flash-Support nur noch befristet verfügbar ist. Ja, es ist noch ein bisschen hin, bis er abläuft, aber ich stelle ungern auf den letzten Drücker um. Und nun bitte keine Diskussion, dass Flash sterben muss, das weiß ich auch, aber noch kommt man nicht ohne aus. -- 109.193.25.144 02:33, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Auf meinem Firefox unter Windows 8.1 ist Flash standardmäßig deaktiviert und der Browser meines Mobiltelefons kann sowieso kein Flash: So wichtig scheint das nicht zu sein. Da kommt eh nur Werbung. --Rôtkæppchen₆₈ 03:03, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Leider doch. Es gibt da so eine kleine amerikanische Website (man hört gelegentlich, dass sie mit der GEMA im Clinch liegt), deren Inhalte sind leider nicht alle mit HTML5 zu betrachten, manches dort geht nach wie vor nur mit Flash. -- 109.193.25.144 08:39, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Ich habe seit etwa 4 Wochen kein Flash mehr (eher durch Zufall). Hab bisher noch nicht festgestellt das irgendein Video auf youtube nicht funktioniert hätte. Da scheint sich vieles getan zu haben.--Trockennasenaffe (Diskussion) 11:40, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Leider doch. Es gibt da so eine kleine amerikanische Website (man hört gelegentlich, dass sie mit der GEMA im Clinch liegt), deren Inhalte sind leider nicht alle mit HTML5 zu betrachten, manches dort geht nach wie vor nur mit Flash. -- 109.193.25.144 08:39, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Auf meinem Firefox unter Windows 8.1 ist Flash standardmäßig deaktiviert und der Browser meines Mobiltelefons kann sowieso kein Flash: So wichtig scheint das nicht zu sein. Da kommt eh nur Werbung. --Rôtkæppchen₆₈ 03:03, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Von dem möchte ich weg, weil dort unter Linux der Flash-Support nur noch befristet verfügbar ist. Ja, es ist noch ein bisschen hin, bis er abläuft, aber ich stelle ungern auf den letzten Drücker um. Und nun bitte keine Diskussion, dass Flash sterben muss, das weiß ich auch, aber noch kommt man nicht ohne aus. -- 109.193.25.144 02:33, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Ich habe Chromium (Version 35.0.1916.114 (270117)) installiert und kann Erweiterungen ohne Googlekonto hinzufügen. Wenn ich jedoch Apps auswähle, soll ich mich anmelden.--178.200.244.40 11:38, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn man die crx-Datei für eine Erweiterung findet, kann man diese per Drag&Drop aus einem Dateimanager in chrome://extensions/ ziehen und dann installieren. Speziell AdblockPlus bekommt man aber auch direkt auf deren Webseite. --FGodard|✉|± 13:59, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Des Rätsels Lösung: Es gibt Apps und es gibt Erweiterungen. Auch wenn man unter "Erweiterungen" im Menü nach neuen Erweiterungen sucht, werden einem zuoberst Apps angeboten. Es gibt eine App die "AdBlock Plus" heißt, und eine Erweiterung gleichen Namens. Warum auch immer. Jedenfalls muss man für die Apps ein Google-Konto angeben, für die Erweiterugen nicht. -- 188.105.118.208 23:25, 7. Jun. 2014 (CEST)
Wie haben die USA ihre ganze Militärausrüstung (Panzer, Helikopter) nach Afghanistan transportiert?
--95.112.175.116 10:04, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Mit dem Schiff in die Türkei, von dort per Flugzeug. Der Nachschub kommt per LKW aus Pakistan. --Rôtkæppchen₆₈ 10:44, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Per Hercules-Transportflugzeug von Tschechien, mit Tankstopp in Usbekistan. Der Nachschub kommt teilweise über Pakistan, teilweise über Usbekistan. Bei einem vollständigen Rückzug aus Afghanistan gibt es übrigens gravierende Probleme. Pakistan ist unsicher und nicht mehr ganz so pro-amerikanisch wie zu Beginn des Krieges und die Route über den Chaiber-Pass führt leide auf beiden Seiten der Grenze durch Pashtunengebiet durch. Und auch Usbekistan hat sich von den USA politisch entfernt und sucht wieder mehr die Nähe zu Russland. Der US-Army bleibt daher nur der Rückzug über Lufttransport. Was zu schwer ist, oder zu teuer per Flugzeug zu transportieren, wird deshalb unschädlich gemacht und zurückgelassen und an Alteisenhändler verkauft. Im Prinzip ist das eine unglaubliche Materialvernichtung, wo Milliardenwerte vernichtet werden. Die ganzen Panzer und schweren Fahrzeuge kriegen sie jedenfalls nicht mehr zu wirtschaftlich sinnvollen Bedingungen aus Afghanistan raus. --El bes (Diskussion) 03:14, 7. Jun. 2014 (CEST)
@El bes ich glaube du irrst gewaltig. Das Air Mobility Command verfügt über 150.000 Soldaten. Das ist schon mal eine gewaltige Hausnummer. Sowas haben andere Staaten als komplette Armee. Als Flugzeuge stehen C-5 Galaxy für den Transport von Kampfpanzern oder C-17 Globemaster III, für SpZ oder Artillerie sowie die kleine Hercules zur Verfügung. Nach der Maßgabe des Joint Staff können zivile Transportflugzeuge für das AMC requiriert werden. Die Flugzeuge die requiriert werden können sind bereits bekannt und werden im Bedarfsfall direkt unterstellt. Dabei kann es sich um Transporter oder sogar um 747s für den Truppentransport handeln. Ein Abzug würde auch nicht über Nacht erfolgen, weil ein Abzug ≠ Rückzug ist. Das gleiche gilt für Transportschiffe. In Reichweite aller Transportflugzeuge befinden sich genügend Stützpunkte um Fahrzeuge, Material und Soldaten vom Flugzeug auf Schiffe umzuladen. Alle Maschinen ausser den zivilen wurden für Starts und Landungen auf verkürzten und unebenen Startbahnen (STOL) optimiert. Via NATO können auch Transporter verbündeter Staaten angefordert werden etwa der A-400. Lustigerweise würden sogar die Russen mit der großen Antonow helfen, nur um die Amis aus Afghanistan loszukriegen. Alles in allem würde so ein Rückzug mehrere Monate in Anspruch nehmen aber er würde genauso erfolgen. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, das die einen M1-A2 oder einen Bradley auch nur stückweise da lassen würden. Anders sieht das mit Verbrauchsmaterial aus. Medizinische Güter könnten im Land verkauft oder verschenkt werden, das gleiche gilt für Nahrungsmittel. Munition wird zumeist per Nachschub reduziert übriggebliebenes verschossen. --Ironhoof (Diskussion) 12:31, 7. Jun. 2014 (CEST) PS: Der Hintransport hat genauso funktioniert einfach rückwärts lesen ;)
- @Ironhoof: Operation Rückzug - Die Bundeswehr verlässt Afghanistan --El bes (Diskussion) 23:43, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Der Fragesteller fragte nach den Streitkräften der Vereinigten Staaten, nicht nach der Bundeswehr. --Rôtkæppchen₆₈ 23:50, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Das Rückzugsproblem ist aber genau das selbe. Wenn man einen Geldscheisser hat, kann man natürlich alles per Luftfracht nach Hause zurück transportieren. Hat man keinen, bleibt eben einiges vor Ort. --El bes (Diskussion) 00:21, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Der Fragesteller fragte nach den Streitkräften der Vereinigten Staaten, nicht nach der Bundeswehr. --Rôtkæppchen₆₈ 23:50, 7. Jun. 2014 (CEST)
El bes was die Amerikaner zurücklassen werden sind Landminen nichts weiter. Du glaubst doch nicht allen ernstes, dass die irgendwelches Equipment stehen lassen. Auch die Bundeswehr lässt keine Schützenpanzer zurück. Was mit Verbrauchsmaterial passiert schrub ich ja schon. --Ironhoof (Diskussion) 10:05, 8. Jun. 2014 (CEST)
Übrigens tolles Youtube-Video, das eigentlich genau das beschreibt was ich gesagt habe. Das geht wie ich ebenfalls bereits erwähnte in beide Richtungen. Hin und Zurück. --Ironhoof (Diskussion) 10:11, 8. Jun. 2014 (CEST)
- lt. diesem Artikel[5] in The Washington Post bleibt einiges zurück:"Military planners have determined that they will not ship back more than $7 billion worth of equipment — about 20 percent of what the U.S. military has in Afghanistan — because it is no longer needed or would be too costly to ship back home." --Advanceddeepspacepropeller (Diskussion) 13:16, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Zerstörung, Verwundung und Tod lassen die Amerikaner natürlich auch da. Und die ganzen toten Zivilisten bleiben natürlich auch - was sollen die auch in den USA? --88.130.121.20 15:50, 8. Jun. 2014 (CEST)
Ich hab den Artikel gelesen. Oben schrieb ich was von Panzern und SpZ oder motorisierter Artillerie. Der Artikel spricht von MRAP-Vehicles. Übersetzt handelt es sich dabei um gepanzerte speziell minensichere LkW. Sowas könnte man gut und gern unter "Verbrauchsgut" deklarieren, verglichen mit einem schweren Kampfpanzer. Insgesamt werden, laut deinem Artikel, nur etwa 76 % aller Güter retourniert. Mit Masse bleibt also das Verbrauchsgut und eben 12000 der 25000 gepanzerten, minensicheren LkW. Laut deinem Artikel werden die in Afghanistan verschrottet. Allein die Zahl müsste schon darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Massengut handelt. Sicher redet man hier von großen Summen, die im Endeffekt vernichtet werden aber betrachtet man den Militäretat an sich ist es eine verschwindend geringe Summe. Dann steht zusätzlich im Artikel das diese Fahrzeuge, aufgrund der veränderten Lage (Nichtvorhandensein der Armee in Afghanistan), nicht mehr benötigt werden. Da stellt sich die Frage warum man die Kosten für eine Rückführung übernehmen sollte, wenn die Verschrottung sowieso durchgeführt werden soll und auch in Afghanistan erfolgen kann? Speziell wird eine Firma in Kandahar erwähnt. Das Prinzip , das dahinter steht ist simpel: Wir nehmen nur mit zurück was wir brauchen den Schrott lassen wir da sollen die sich damit rumprügeln. Das macht übrigens jede Armee. Aufräumen ist nicht wirklich deren Stärke. El Bes vielleicht haben wir uns missverstanden. Dein Post klang so als würden die Amerikaner ihr Säckel schnüren, aus ihren Basen zum Flugplatz marschieren und alles aber auch alles stehen und liegen lassen das schwerer ist als ein Sturmgewehr. --Ironhoof (Diskussion) 10:18, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Bundeswehrsoldaten sind übrigens angehalten, Patronenhülsen größerer Kaliber von über 5 cm einzusammeln, weil sonst Kinder kommen, die einsammeln, diese an Altmetallhändler verkaufen, von wo sich die Aufständischen wieder versorgen um daraus die improvised explosive devices (IED) zu bauen. Und dann lässt man auf der anderen Seite ganze Autofriedhöfe im Land. --El bes (Diskussion) 21:38, 9. Jun. 2014 (CEST)
Zulassungsbescheinigung Teil 2 und Fahrzeugbrief - diverse Fragen
Vor knapp einem Jahrzehnt wurde der Fahrzeugbrief ja durch die Zulassungsbescheinigung Teil 2 ersetzt. Unter anderem aus Gründen des Datenschutzes und der Vereinheitlichung. Da stellen sich mir einige Fragen:
- Dürfte ich dann im Datenschutzsinne überhaupt noch die Uralt-Fahrzeugbriefe aufheben, wo alle Vorhalter mit Addresse draufstehen, die ich gar nicht kenne?
- Wenn ja, dürfte ich die Uralt-Briefe auch beim Verkauf des Fahrzeuges im Datenschutzsinne weitergeben?
- Haben die alten Fahrzeugbriefe überhaupt noch irgendeinen Wert? Ich meine: Bei allen Neuwagen ab 2005 sind ja dann ohnehin maximal der vorherige Halter und die Gesamtzahl der Halter bekannt und "Brief-Autos" sind inzwischen 10+ Jahre alt.
Dass man bei noch jungen Autos lieber einen Zettel mehr als zuwenig aufhebt, ist klar. Aber bei alten Autos (13+ Jahre, weit über 150.000km, max. 1000 Euro Restwert, 3+ Vorbesitzer) interessiert doch eh niemanden mehr, wer der Erstbesitzer war, oder? Ich war grade am Ausmisten Jahrzehnte alter Unterlagen, und bin mir hierbei unsicher, daher die Fragen. --2003:63:2F35:5C00:9B3:5E18:557F:DD5E 16:21, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Ein prominenter Vorbesitzer erhöht den Wert eines Young- oder Oldtimers unter Umständen ungemein, das muss nicht unbedingt der letzte Vorbesitzer gewesen sein. Feststellen und nachweisen lässt sich das nur mit dem klassischen Brief. Darüber hinaus kann eine geringe Zahl von Vorbesitzern wertsteigernd wirken. Und nicht zuletzt gehört für einige Sammler der Brief zur Geschichte des Fahrzeuges einfach dazu. Im Old- und Youngtimerbereich gibt es also durchaus Gründe, den Brief aufzuheben. --91.178.233.230 18:37, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Das sehe ich auch so. Man denke an einen dunkelblauen VW Golf IV, dessen Vorbesitzer Joseph Aloisius Ratzinger war.[6] --Hans Haase (有问题吗) 21:07, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Bei mir ist es weder Kultauto noch hat irgendwer Bekanntes den Wagen besessen. Anzahl Vorbesitzer steht ja auf der Zulassungsbescheinigung Teil 2 trotzdem noch drauf (nur eben nicht alle Addressen mehr). Versteh nicht ganz, wie "Horst Meier, Pupsstraße, 0815 Hinteroberdorf" den Wert steigern soll. --2003:63:2F35:5C00:DCC:6B33:A2A9:9609 10:53, 7. Jun. 2014 (CEST)
- „Versteh nicht ganz, wie …“ musste auch nicht :-)
- Entscheidend ist, dass es für eventuelle Liebhaber dieses speziellen Typs wichtig sein kann, wenn eine Eigner-Historie vorhanden ist. Was spricht dagegen, den ganzen Kram in einen großen Umschlag zu packen und aufzuheben? --87.163.87.118 13:24, 7. Jun. 2014 (CEST)::::::
- Aber meine Frage war ja zusätzlich auch, ob das formal überhaupt erlaubt ist (unabhängig von der gelebten Praxis). Denn der Brief wurde ja gerade aus Datenschutzgründen durch die ZB-II ersetzt, um eben das Weiterverteilen rechtlich irrelvanter Daten zu verhindern. Abgesehen davon bin ich jemand, der gerne Ordnung hält und keine Daten (weder meine noch die von anderen) unnötigerweise gesammelt wissen will. Auf die 100 Euro-plus-minus Unterschied, die das ausmachen könnte für die alte Mühle, kommt's mir nicht an (neuer Wagen kostet eh viele Tausend und wird nur alle 10+ Jahre gekauft, da kommt's auf 100€ für den Alten auch nicht mehr an). --2003:63:2F35:5C00:617A:474D:86D5:30E4 16:49, 7. Jun. 2014 (CEST)
Von deinen 10 Vorbesitzern wohnen wahrscheinlich sowieso nur noch ca. 3-4 an der alten angegebenen Adresse. Wer soll sich also daran datenschutzrechtlich stören?--Motorolakzrz (Diskussion) 20:04, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Auch nach dem Wegzug kann eine ehemalige Adresse immer noch missbraucht werden: „Kuck mal, der hat mal im sozialen Brennpunkt gewohnt.“ --Rôtkæppchen₆₈ 23:11, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Warum sind meine Beweggründe überhaupt wichtig, um die Frage beantwortet zu bekommen? Ich möchte sowenig wie nur irgendmöglich Daten gesammelt wissen. Punkt. Frage: Welche oder wie viel von den Autopapieren muss ich per Gesetz zwingend aufbewahren und welche kann ich aufbewahren und welche darf ich per Gesetz(!) nicht aufbewahren? --2003:63:2F35:5C00:657E:3F01:F452:810 11:01, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die beiden Papiere vom Amt neben dem Kaufvertrag und der Quittung (ggf. Kontoauszug) solltest Du dringend aufbewahren. Die anderen Daten können im Ausnahmefall relevant werden. Du solltest auch bedenken, dass mit den Papieren bereits Unfug passiert ist, wie gestohlene Zulassungsbescheinigungen, von denen die Behörden die Dokumentseriennummern zurückhielten. Der einzige der davon profitiert, ist der Hehler. Ein Schelm, der daran denkt, die Zahl der Einbrüche in Behörden solle geheimgehalten werden. Schau mal in andere Länder und deren Sitten. --Hans Haase (有问题吗) 17:07, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Da habe ich ganz andere Probleme - alle zwei Jahre: ich habe seit 20 Jahren einen Anhänger, den ich fast nicht nutze (max. 500 km im Jahr). Da war im Fahrzeugschein alles voller TÜV-Stempel und ich musste eine neue Zulassungsbescheinigung 1 + 2 ausstellen lassen. Nun hat man damals beide alten Papiere nicht ausgehändigt, sondern bei der Zulassung geschreddert. Damit sind alle alten Daten - wie die alternativen Reifengrößen - weg. Da noch die Originalreifen drauf sind, die es jetzt schon lang nicht mehr gibt, fragt mich jedesmal der TÜV-Mann nach den Alternativreifen und ich kann ihm keine Antwort geben. Er empfiehlt dann immer, die Reifen auf die einzige zugelassene Größe zu ändern. Mag ich aber nicht, die sind zwar alt, aber mit dem Grünabfall zum Wertstoffhof reichen die Reifen nach 10.000 km noch immer. Aber die alten Daten der damals zugelassenen Reifen sind eben weg und ich kann nichts dafür (heute werden die Altpapiere entwertet zurückgegeben). --Mef.ellingen (Diskussion) 23:11, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Passende wirst Du bestimmt bekommen, ggf. gebrauchte Felgen, die passen für'n Appel und'n Ei. Machbar ist da viel. Auf den vorhandene steht drauf, was Du brachen wirst. Reifen sollten beim Kauf nicht älter als 3 Jahre sein. Wenn die Pneus keine Risse haben, halten die sehr lange, denn die Starrachse der Anhänger hat keine Probleme Spur- und Sturz. Ich vermute zudem einen ungebremsten Kleinanhänger. Mit Typenschildangaben im Internet, mit der VIN beim Hersteller oder Vertreter sollte immer etwas rauszubekommen sein. Du musst neben der Zulassung nur schauen, dass das nicht das Dilemma wird, wie es Ford in den USA hatte. Hier hilft das freundliche Einschrieben ans Amt, denn Du hast das nicht zu verantworten. Übrigens sollten die Daten dort hinterlegt sein. --Hans Haase (有问题吗) 20:54, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Da habe ich ganz andere Probleme - alle zwei Jahre: ich habe seit 20 Jahren einen Anhänger, den ich fast nicht nutze (max. 500 km im Jahr). Da war im Fahrzeugschein alles voller TÜV-Stempel und ich musste eine neue Zulassungsbescheinigung 1 + 2 ausstellen lassen. Nun hat man damals beide alten Papiere nicht ausgehändigt, sondern bei der Zulassung geschreddert. Damit sind alle alten Daten - wie die alternativen Reifengrößen - weg. Da noch die Originalreifen drauf sind, die es jetzt schon lang nicht mehr gibt, fragt mich jedesmal der TÜV-Mann nach den Alternativreifen und ich kann ihm keine Antwort geben. Er empfiehlt dann immer, die Reifen auf die einzige zugelassene Größe zu ändern. Mag ich aber nicht, die sind zwar alt, aber mit dem Grünabfall zum Wertstoffhof reichen die Reifen nach 10.000 km noch immer. Aber die alten Daten der damals zugelassenen Reifen sind eben weg und ich kann nichts dafür (heute werden die Altpapiere entwertet zurückgegeben). --Mef.ellingen (Diskussion) 23:11, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die beiden Papiere vom Amt neben dem Kaufvertrag und der Quittung (ggf. Kontoauszug) solltest Du dringend aufbewahren. Die anderen Daten können im Ausnahmefall relevant werden. Du solltest auch bedenken, dass mit den Papieren bereits Unfug passiert ist, wie gestohlene Zulassungsbescheinigungen, von denen die Behörden die Dokumentseriennummern zurückhielten. Der einzige der davon profitiert, ist der Hehler. Ein Schelm, der daran denkt, die Zahl der Einbrüche in Behörden solle geheimgehalten werden. Schau mal in andere Länder und deren Sitten. --Hans Haase (有问题吗) 17:07, 8. Jun. 2014 (CEST)
Wer könnte sich für ein Haushaltsbuch 1925-45 interessieren?
Ich habe das aus dem Nachlass meiner Mutter; jedes eingekaufte Lebensmittel ist einzeln eingetragen. Ein Zeitdokument. Wen jönnte das interessieren, wer könnte das verfielfältigen? Gruß -- Dr.cueppers - Disk. 18:59, 6. Jun. 2014 (CEST)
- "Vervielfältigen" ist unproblematisch, das dürfte unproblematisch einzuscannen oder abzuphotographieren sein, und wäre m. E. auf den Commons als Scan willkommen. Wen das interessiert? Wenn es jetzt niemanden interessiert, dann vielleicht später. Solche Quellen halte ich auf jeden Fall für potentiel sehr interessant. Wenn es darum geht, wohin man so ein Buch zur Rettung vor dem Papiermüll der nächsten Generation abgeben kann, dann wäre vielleicht das Archiv oder historische Museum des jeweiligen Ortes, um den es geht, ein Ansprechpartner. Da der Platzbedarf überschaubar sein könnte, aber lokale Alltagsgeschichte dokumentiert wird, könnten die interessiert sein. --AndreasPraefcke (Diskussion) 19:03, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Original klar an so ein Museum, eventuell sogar ans DHM. Die digitale Kopie vielleicht an den Spiegel / einestages? Hummelhum (Diskussion) 19:33, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Hä? Dir ist Hummelhum- trotz deiner 6 Edits im ANR (was 2,94% deiner Gesamtleistung hier betrifft) - hoffentlich klar, in welchem Projekt du bist? --Hubertl (Diskussion) 22:29, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Was hat der Prozentsatz meiner Beiträge ("Leistung" ist ein großes Wort) damit zu tun?
- Ich bin in keinem Projekt, da irrst du. Im wirklichen Leben bin ich in etwa drei Projekten, die du aber wohl nicht meinen kannst. Hier "bin" ich nicht, sondern schreibe nur mal kurz eine sinnvolle Antwort und das ist alles.
- Du hältst DHM und einestages nicht für sinnvolle Adressaten des Dokuments? Dann erklär (gar nicht mal so mir, sondern vor allem dem Fragesteller), warum du das so siehst. Aber verzichte bitte auf sinnlose argumenta ad hominem. Hummelhum (Diskussion) 22:55, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Hä? Dir ist Hummelhum- trotz deiner 6 Edits im ANR (was 2,94% deiner Gesamtleistung hier betrifft) - hoffentlich klar, in welchem Projekt du bist? --Hubertl (Diskussion) 22:29, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Original klar an so ein Museum, eventuell sogar ans DHM. Die digitale Kopie vielleicht an den Spiegel / einestages? Hummelhum (Diskussion) 19:33, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Als Erbe des Urheberrechts kannst du das, so weit ich das sehe, problemlos unter einer freien Lizenz als Scan in die Commons stellen. --Chricho ¹ title=BD:Chricho&action=edit§ion=new ² ³ 21:54, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Wie soll denn da ein Urheberrecht zustandekommen? --AndreasPraefcke (Diskussion) 23:05, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Das Haushaltsbuch genießt als Datenbankwerk urheberrechtlichen Schutz. --Rôtkæppchen₆₈ 23:09, 6. Jun. 2014 (CEST)
- <Quetsch>Davon bin ich nicht überzeugt. Meines Wissens (ich bin nicht unfehlbar) hat noch nicht einmal ein Tagebuch ausreichende Schöpfungshöhe, um urheberrechtlich geschützt zu werden (BHG vom 22. 12. 1959 VI ZR 175/58); ein Tagebuch geniesst höchstens Schutz nach allgemeinem Persönlichkeitsrecht. Ob das für ein simples Haushaltsbuch anwendbar ist, darf bezweifelt werden. --Désirée2 (Diskussion) 19:59, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Da ich kein Spezialist für Urheberrechtsfragen bin, kann ich nicht abschließend und mit Sicherheit sagen, ob das fragliche Haushaltsbuch ausreichende Schöpfungshöhe besitzt - ich tendiere allerdings dazu, es zu bejahen (mag an meiner vorsichtigen Natur liegen: lieber einmal zu viel Schutz annehmen als einmal zu wenig). Das von dir angeführte Urteil des BGH (nicht: BHG) befasst sich allerdings in keinster Weise mit Tagebüchern und deren Schutz durch Urheber- oder Persönlichkeitsrechte; es ging vielmehr um Äußerungen in einer verbandsinternen Publikation, Rundschreiben eines Mitglieds dieses Verbands an andere Mitglieder sowie um den Inhalt von Leserbriefen oder Anschreiben an einen Verlag. Das Wort Tagebuch kommt im Urteil kein einziges mal vor. --Snevern 20:24, 8. Jun. 2014 (CEST)
- <Quetsch>Davon bin ich nicht überzeugt. Meines Wissens (ich bin nicht unfehlbar) hat noch nicht einmal ein Tagebuch ausreichende Schöpfungshöhe, um urheberrechtlich geschützt zu werden (BHG vom 22. 12. 1959 VI ZR 175/58); ein Tagebuch geniesst höchstens Schutz nach allgemeinem Persönlichkeitsrecht. Ob das für ein simples Haushaltsbuch anwendbar ist, darf bezweifelt werden. --Désirée2 (Diskussion) 19:59, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Das Haushaltsbuch genießt als Datenbankwerk urheberrechtlichen Schutz. --Rôtkæppchen₆₈ 23:09, 6. Jun. 2014 (CEST)
- Wie soll denn da ein Urheberrecht zustandekommen? --AndreasPraefcke (Diskussion) 23:05, 6. Jun. 2014 (CEST)
Das überaus wertvolle Zeitzeugnis könnte dort zugänglich sein, wo über Alltags- Sozial- und Kulturgeschichte geforscht wird. Als nichtstaatliche Institution fällt mir da z.B. das Hamburger Institut für Sozialforschung ein, obwohl dein Dokument auch in den Bereich Volkskunde paßt. Ich würde, wäre ich an deiner Stelle, anders herangehen. Ich würde danach suchen, welche wissenschaftlichen Publikationen die Haushaltsbücher verwertet hätten, was die Autoren so schreiben und wie dir das gefällt und an welchen wissenschaftlichen Einrichtungen die sitzen. Wenn du dir dann im Klaren bist, was für Bedingungen du an eine Abgabe knüpfen möchtest (Zugänglichkeit, keine Privatisierung und stattdessen Aufnahme in ein wissenschaftliches Archiv, möglicherweise Digitalisierung und Publikation im Web etc.) würde ich entsprechend Kontakt aufnehmen. Du redest dann gleich mit Leuten, die das, was du hast, zu schätzen wissen und von denen du bereits weißt, was für Arbeitsergebnisse sie so publizieren. --212.184.142.183 01:40, 7. Jun. 2014 (CEST)
commons/wikisource? --79.253.17.73 09:04, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Danke für die Tips; die konkret Gennanten werde ich mal anschreiben. Und wenn es im Internet verfügbar würde, könnten die Letztgenannten das genau so auswerten, als wenn sie selber das Original hätten. Gruß -- Dr.cueppers - Disk. 09:41, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Das Deutsche Tagebucharchiv nimmt leider keine Haushaltsbücher entgegen, aber es sollte wohl darüber Auskunft geben können, wohin dieses Dokument der Alltagsgeschichte sinnvoll zur Bewahrung, Digitalisierung, Vervielfältigung, Publikation o.ä. gegeben werden kann. Es verspricht spannende und aufschlussreiche Lektüre (sagt die Besitzerin eines ähnlichen Buches). Sollte es online gehen, würde ich gerne benachrichtigt werden. --Désirée2 (Diskussion) 01:53, 8. Jun. 2014 (CEST)
Wo bist Du denn das von Oma aus Bremen los geworden? Und was ist mit dem Mus. f. Zeitgeschichte in DD, das ich empfohlen hatte, wollten die nicht?--G-Michel-Hürth (Diskussion) 17:46, 8. Jun. 2014 (CEST)
- @G-Michel-Hürth: Vielen Dank, dass Du mich daran erinnerst. Damals begann eine bis März 2014 dauernde Reihe von Krankenhausaufenthalten, die das in Vergessenheit geraten ließ. Übrigens: Ein "Museum für Zeitgeschichte" gibt es in Dreden nicht (siehe Liste der Museen in Dresden). Gruß -- Dr.cueppers - Disk. 10:12, 10. Jun. 2014 (CEST)
7. Juni 2014
rdiff-backup script erstellung
Hallo zusammen, ich brauch eure hilfe und zwar möchte ich mit rdiff-backup meinen nas backupen auf meinem server der per ssh angesprochen werden soll. benutzer sind alle soweit angelegt ich bräucht nur die hilfe beim scrpit, er soll den des ordners ihnalt "/share/MD1_DATA/RAID2" auf dem server im ordner "/home/backup/backup" als ein file und Differenziell speichern. Könnt ihr mir bitte helfen?-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 01:05, 7. Jun. 2014 (CEST)
- 1. für n full backup könnte man `tar cjf /home/backup/backup/<zeitstempel>.tbz /share/MD1_DATA/RAID2` verwenden... 2. für n differentielles backup könnte man sich Dateien suchen deren Größe oder Modify(?)-Zeitstempel geändert hat, und davon dann n patch mit `bsdiff` machen (wobei man für beides allerdings n Schnappschuss der Dateien bräuchte, von dem dann auch das full backup stammen sollte, falls sich eine Datei während des Backups geändert hat)... 3. oder man macht alles selbst und speichert sich Checksummen für 1MiB Blöcke jeder Datei (nebst Zeitstempel und Größe), im Moment des letzten Backups, und benutzt diese „Fingerabdrücke“ dann für differentielle Backups... 4. ob's sowas schon fertig gibt, weiß ich nich... XFS bietet wohl Snapshots an, mit denen Backups ganz leicht gehen (also das mit vorher/nachher und so)... --Heimschützenzentrum (?) 08:06, 7. Jun. 2014 (CEST)
- ähm ja, du hast gesehen das ich es per "rdiff-backup" machen möchte?-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 09:56, 7. Jun. 2014 (CEST)
- hmm... das meinst du? da steht, dass es ganz einfach geht... wieso sollte man da noch n extra skript schreiben müssen? --Heimschützenzentrum (?) 12:00, 7. Jun. 2014 (CEST)
- reicht vllt n beispiel von da: [7]? --Heimschützenzentrum (?) 12:01, 7. Jun. 2014 (CEST)
- warum als script? kann ihc dir ganz leicht erklären, also ich möchte das rdiff-backup nachts ein backup meienr nass hdd macht und es per ssh auf meinem server hochläd. Ein script muss es sein das es nachts automatisch gemacht wird. ich hab google seid gestern umgewältz, ich finde zwar scripts, aber ich raffe nciht so ganz wie ich das verzeichniss eintragen muss wo gespeichert werden soll, es steht zwar dabei "alles was im / befindet" aber ich sehe die stelle nicht wo das fest gelegt wird.-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 12:12, 7. Jun. 2014 (CEST)
- ist doch n einzeiler... also ohne script: einfach in die crontab `rdiff-backup /some/local-dir hostname.net::/whatever/remote-dir` eintragen (das macht ssh und so automatisch)? oder ich versteh das problem nich... sorry... --Heimschützenzentrum (?) 12:37, 7. Jun. 2014 (CEST)
- es soll aber nicht nur ne 1zu1 kopie sein sondern ein Differenzielles.-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 12:42, 7. Jun. 2014 (CEST)
- ist doch n einzeiler... also ohne script: einfach in die crontab `rdiff-backup /some/local-dir hostname.net::/whatever/remote-dir` eintragen (das macht ssh und so automatisch)? oder ich versteh das problem nich... sorry... --Heimschützenzentrum (?) 12:37, 7. Jun. 2014 (CEST)
- das macht es doch von allein, oder? „but extra reverse diffs are stored in a special subdirectory of that target directory, so you can still recover files lost some time ago.“ (Übersetzung: „aber einige zusätzliche rdiffs werden gespeichert in einem speziellen Unterverzeichnis des Ziel-Verzeichnisses, so dass man immernoch Dateien wiederherstellen kann, die einige Zeit zuvor verloren gingen.“ (oder so))... --Heimschützenzentrum (?) 12:59, 7. Jun. 2014 (CEST)
- öhm, sorry ich hb keinen schimmer vom programm.-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 13:15, 7. Jun. 2014 (CEST)
- das macht es doch von allein, oder? „but extra reverse diffs are stored in a special subdirectory of that target directory, so you can still recover files lost some time ago.“ (Übersetzung: „aber einige zusätzliche rdiffs werden gespeichert in einem speziellen Unterverzeichnis des Ziel-Verzeichnisses, so dass man immernoch Dateien wiederherstellen kann, die einige Zeit zuvor verloren gingen.“ (oder so))... --Heimschützenzentrum (?) 12:59, 7. Jun. 2014 (CEST)
- *kicher* dann probier's doch erstmal mit nem kleinen Test-Verzeichnis aus? --Heimschützenzentrum (?) 13:36, 7. Jun. 2014 (CEST)
- wen ich das programm beherschen könnte würde ich nciht hier fragen oder ;) ich musste auf meinem server auch rdiff-backup, wobei in welchem format speichert rdiff eingetlich die backups ab?-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 14:23, 7. Jun. 2014 (CEST)
- och je... :-) also auf dem Rechner, auf dem die zu backuppenden Daten liegen, muss das rdiff-backup Paket installiert sein... oder du mountest dessen Verzeichnis, auf dem die zu backuppenden Daten liegen, auf dem NAS-Knoten... oder du machst alles auf dem NAS-Knoten... und das Format kann dir erstmal total egal sein, sonst verzetteln wir uns nur... --Heimschützenzentrum (?) 17:31, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Vielleicht hilft auch
man rdiff-backup. --Rôtkæppchen₆₈ 18:32, 7. Jun. 2014 (CEST)
- ja, genau... oder einfach die offizielle WebSite, die ich gleich als zweites verlinkt hab... zwei Clicks: Doc->man->[8]... :-) --Heimschützenzentrum (?) 07:27, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Also ich muste nicht nur auf meiner nas rdiff innstallieren sondern auch auf meinem server, sontst hätte er keine verbindung bekommen in dem ich "rdiff-backup /share/MD1_DATA/RAID2/Backup_vom_XXX backup@XXX.XXX.XXX.XXX ::/home/backup/backup" eingetippt hätte -- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 20:12, 8. Jun. 2014 (CEST)
- so leute ich bekomme eine fehlermwldung, was will sie mir sagen?-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 21:40, 8. Jun. 2014 (CEST) hier als pastebin ist augenfreundlicher [9] -- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 22:40, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Also ich muste nicht nur auf meiner nas rdiff innstallieren sondern auch auf meinem server, sontst hätte er keine verbindung bekommen in dem ich "rdiff-backup /share/MD1_DATA/RAID2/Backup_vom_XXX backup@XXX.XXX.XXX.XXX ::/home/backup/backup" eingetippt hätte -- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 20:12, 8. Jun. 2014 (CEST)
- ja, genau... oder einfach die offizielle WebSite, die ich gleich als zweites verlinkt hab... zwei Clicks: Doc->man->[8]... :-) --Heimschützenzentrum (?) 07:27, 8. Jun. 2014 (CEST)
- sieht nach nem EPERM aus... das könnte was mit Zugriffsrechten des Benutzers, der auf dem NAS zu schreiben versucht, zu tun haben... vgl: 1. „/usr/include/asm-generic/errno-base.h:#define EPERM 1 /* Operation not permitted */“ und 2. man-page open(2)... --Heimschützenzentrum (?) 22:50, 8. Jun. 2014 (CEST) vllt isses auch was mit ner Firewall oder so? mal an „--terminal-verbosity“ rumgedreht? gleich auf 9? *huch* :-) --Heimschützenzentrum (?) 22:55, 8. Jun. 2014 (CEST)
- eprem öhm, ok... welcher user ist das dann? der vom nas (admin) oder vom server (admin)?friewall gibt es nur in der fritzbox wo die (oder das?) nas hängt und die ist nicht so berauschend (für technick freaks) was meinst du mit rumgedreht?- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 23:01, 8. Jun. 2014 (CEST)
- sieht nach nem EPERM aus... das könnte was mit Zugriffsrechten des Benutzers, der auf dem NAS zu schreiben versucht, zu tun haben... vgl: 1. „/usr/include/asm-generic/errno-base.h:#define EPERM 1 /* Operation not permitted */“ und 2. man-page open(2)... --Heimschützenzentrum (?) 22:50, 8. Jun. 2014 (CEST) vllt isses auch was mit ner Firewall oder so? mal an „--terminal-verbosity“ rumgedreht? gleich auf 9? *huch* :-) --Heimschützenzentrum (?) 22:55, 8. Jun. 2014 (CEST)
- *nach links rutsch* einfach „rdiff-backup --terminal-verbosity 9 [...]“? ich würde vermuten, dass es der user „backup“ auf dem NAS ist, der nicht (schreibend) zugreifen darf... --Heimschützenzentrum (?) 23:13, 8. Jun. 2014 (CEST)
- nope user backup ist vom vom server wo das backup haben soll, ok ich probeire es mal aus.-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 23:26, 8. Jun. 2014 (CEST)
- schick --terminal-verbosity 9 macht ein tolles log da hilft mir schon weiter-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 23:31, 8. Jun. 2014 (CEST)
- nope user backup ist vom vom server wo das backup haben soll, ok ich probeire es mal aus.-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 23:26, 8. Jun. 2014 (CEST)
- und was war's? *neugierig sei* :-) --Heimschützenzentrum (?) 23:46, 8. Jun. 2014 (CEST)
- läuft ncoh, das log output von putty ist jetzt schon >250mb gross-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 23:56, 8. Jun. 2014 (CEST)
- und was war's? *neugierig sei* :-) --Heimschützenzentrum (?) 23:46, 8. Jun. 2014 (CEST)
- *staun* also ist der Fehler jetzt wech? --Heimschützenzentrum (?) 07:46, 9. Jun. 2014 (CEST)
- nope es dauert immer lange bis der fehler auftritt so auch hier [10] -- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 09:48, 9. Jun. 2014 (CEST)
- *staun* also ist der Fehler jetzt wech? --Heimschützenzentrum (?) 07:46, 9. Jun. 2014 (CEST)
- und was sagt „ls -ld /home/backup/backup /home/backup/backup/trashbox“? also auf dem NAS ausgeführt, wenn ich das richtig verstehe... --Heimschützenzentrum (?) 10:31, 9. Jun. 2014 (CEST)
- also ich hab 3leere ordner (ras, SCANS, trashbox) gelöscht und hab vom /home/backup/backup die rechte nochmal settzten llassen und den besitzer und gruppe auf "backup" geändert. jetzt lief rdiff ohne probleme durch. so leute wie tell ich es jetzt an das der befehl automatisch morgen um 1uhr nachts macht? noch besser wäre es wen er mir dan eine email schickt mit seinem log bzw. ergebniss. auf jedefall danke für eure hilfe-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 10:57, 9. Jun. 2014 (CEST)
- also unter UNIXoiden OSen könnte man es in die crontab schreiben und bekommt dann auch brav die Ausgabe des Progis per eMail... wie es unter MS Winblöds ist, weiß ich nich... da müsstest du vllt ne neue Frage aufmachen, fallse user:Eike sauer oder user:Rotkaeppchen68 hier nich mehr mitlesen... --Heimschützenzentrum (?) 13:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
- dan past es ja gut das die nas und der server linux sind.-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 13:27, 9. Jun. 2014 (CEST)
- also unter UNIXoiden OSen könnte man es in die crontab schreiben und bekommt dann auch brav die Ausgabe des Progis per eMail... wie es unter MS Winblöds ist, weiß ich nich... da müsstest du vllt ne neue Frage aufmachen, fallse user:Eike sauer oder user:Rotkaeppchen68 hier nich mehr mitlesen... --Heimschützenzentrum (?) 13:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
- supi! dann isses „<min> <std> <tag> <mon> <wochentag> <kommando>“... also in deinem Fall: 1. „crontab -e“ ausführen und dann die Zeile „0 1 * * * rdiff-backup blah blub“ einfügen... --Heimschützenzentrum (?) 13:39, 9. Jun. 2014 (CEST)
- darum kümmer eich mich gleich jetzt hab ich gerade ein anderes probleme, ich hab versucht danach [11] dem user backup ein login ohne passwort zu ermöglichen, also über puplick key, ich hab alles so gemacht wie es dort steht, also auf der nas per ssh eingelogt und eingetippt "ssh-keygen -t rsa" ordner " /share/Public/id_rsa" kein "passphrase" und dan " cat /root/.ssh/id_rsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys" "chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys" und dan genau das gemacht was dort steht [12] aber wen ich zu testzewcken "ssh backup@servewr" im shh der nas eintippen fragt er mich nach einem passwort. findest du den fehler?-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 15:16, 9. Jun. 2014 (CEST)
- also wenn du auf S bist und dich auf N per ssh-ohne-passwort einloggen willst, dann musst du auf S den secret-key haben und auf N den public-key (dazu habe ich auf S ssh-keygen gestartet)... bei mir liegen die in dem jeweiligen ~/.ssh Verzeichnis... auf S heißt die Datei dann „~/.ssh/id_dsa“ und auf N heißt sie „~/.ssh/authorized_keys“ (eine Zeile pro berechtigtem Account)...--Heimschützenzentrum (?) 18:59, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich bin doch auf n und will auf s die backups werfen (so hb ich rdiff verstanden) also muss ich "ssh-keygen" auf N, den scret-key von N muss auf S. ich muss doch rdiff, auf n ausführen, oder muss das S machen? -- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 19:10, 9. Jun. 2014 (CEST)
- also wenn du auf S bist und dich auf N per ssh-ohne-passwort einloggen willst, dann musst du auf S den secret-key haben und auf N den public-key (dazu habe ich auf S ssh-keygen gestartet)... bei mir liegen die in dem jeweiligen ~/.ssh Verzeichnis... auf S heißt die Datei dann „~/.ssh/id_dsa“ und auf N heißt sie „~/.ssh/authorized_keys“ (eine Zeile pro berechtigtem Account)...--Heimschützenzentrum (?) 18:59, 9. Jun. 2014 (CEST)
- hm... also du startest doch rdiff-backup auf S, oder? dann loggt der sich über ssh auf N ein und startet dort einen weiteren rdiff-backup prozess, oda? also ssh-keygen auf S und dann den public-key in die ~backup/.ssh/authorized_keys Datei auf N eintragen... so klappt's bei mir jedenfalls... --Heimschützenzentrum (?) 20:28, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ähm, nein ich mach rdiff-backup /share/MD1_DATA/RAID2/Backup_vom_nas backup@server::/home/backup/backup auf der nas-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 20:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
- update ich konnte jetzt dem linux auf s beibringen das der user "backup" nur noch per publickey sich einlogen darf, (hab die falsche datei bearbeitet) aber jetzt hab ich woll irgendwie einen bock geschossen und bekomme die meldung "permission denied (publickey)" jetzt muss ich den publickey auf n vom "backup" s löschen bzw. ändern, die frage ist nur wie..-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 22:16, 9. Jun. 2014 (CEST)
- hm... also du startest doch rdiff-backup auf S, oder? dann loggt der sich über ssh auf N ein und startet dort einen weiteren rdiff-backup prozess, oda? also ssh-keygen auf S und dann den public-key in die ~backup/.ssh/authorized_keys Datei auf N eintragen... so klappt's bei mir jedenfalls... --Heimschützenzentrum (?) 20:28, 9. Jun. 2014 (CEST)
- wieso nur noch per publickey? hast du die /etc/ssh/sshd_config geändert? ssh kennt den Parameter „-v“ (für extra viel Meldungen)... vllt hilft das? --Heimschützenzentrum (?) 23:01, 9. Jun. 2014 (CEST)
- weil ich den user backup nciht überreden konnte auf eine passwort eingabe zu verzichten. der user backup soll auschlslich fürs backups da sein, deswegen nur per pubkey-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 23:19, 9. Jun. 2014 (CEST)
- normal fängt er mit publickey an, weil's 1000x kühler ist als alles andere... :-) also kein Grund die sshd_config zu ändern... ich hab die nur geändert, weil ich Passwörter für zu unsicher halte... die ersten gefühlten 100 ssh Installationen hatte ich auch Schwierigkeiten, aber jetzt geht's ganz leicht... meistens weil die Permissions vom Home-Verzeichnis oder vom .ssh Verzeichnis oder von den key-Files zu lasch waren... die sollten 0700 respektive 0600 sein oder so... und der Owner muss stimmen... --Heimschützenzentrum (?) 23:38, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Irgendwie woltle er bei mir nicht, naja egal jetzt gehts, ich musste id_rsa in den ordner /root/.ssh auf N kopieren und dan die rechte jetzt gehts. nexte baustelle crontab -e, wie muss ich es eintragen das es nachts um 1 uhr startet? woher weis crontab das er mir ne mail schicken soll?-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 00:18, 10. Jun. 2014 (CEST)
- normal fängt er mit publickey an, weil's 1000x kühler ist als alles andere... :-) also kein Grund die sshd_config zu ändern... ich hab die nur geändert, weil ich Passwörter für zu unsicher halte... die ersten gefühlten 100 ssh Installationen hatte ich auch Schwierigkeiten, aber jetzt geht's ganz leicht... meistens weil die Permissions vom Home-Verzeichnis oder vom .ssh Verzeichnis oder von den key-Files zu lasch waren... die sollten 0700 respektive 0600 sein oder so... und der Owner muss stimmen... --Heimschützenzentrum (?) 23:38, 9. Jun. 2014 (CEST)
- steht doch oben schon (gestern 13:39+02:00)... die email ginge wohl an root@N... wer kriegt die denn? --Heimschützenzentrum (?) 07:27, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Du könntest dirvish verwenden, das kann glaub ich schon, was du brauchst. --Eike (Diskussion) 10:23, 10. Jun. 2014 (CEST)
- @Eike oh toll damit kommst du jetzt daher wo ich rdfii am laufen habe ;) @Heimschützenzentrum wen ich in die crontab „0 1 * * * rdiff-backup blah blub" eintrage macht er es dan nachts um 1uhr von alleine und nciht alle stunde? GRuss-- Conan (Nachricht an mich? Bitte hier lang.) 15:51, 10. Jun. 2014 (CEST)
- komm und hol's dir... :-) ich meine: probiers doch mit „28 16 * * * ls“ aus, wenn du mir nich glaubst (was ich auch nich ohne Test täte...)... *kicher* --Heimschützenzentrum (?) 16:27, 10. Jun. 2014 (CEST)
- also ich hab jetzt "09 21 * * * ls" ausprobiert, im "crontab -e" steht es drin, aber ne mail hab ihc nciht bekommen.--21:15, 10. Jun. 2014 (CEST)
- komm und hol's dir... :-) ich meine: probiers doch mit „28 16 * * * ls“ aus, wenn du mir nich glaubst (was ich auch nich ohne Test täte...)... *kicher* --Heimschützenzentrum (?) 16:27, 10. Jun. 2014 (CEST)
CE-Kennzeichen bei "Kleinprodukten"
Moin alle, ich spiele mit dem Gedanken, einen Raspberry Pi mit SD-Karte und TV-Stick als "Settopbox to go" zu vertreiben (bis jetzt haben das ein paar Kumpels von mir für gut befunden). Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das mit nichtprivatem Vertrieb. Gewerbeschein hab ich schon, aber die CE-Kennzeichnung ist kritisch. Brauche ich die auch, wenn ich nur CE-gekennzeichnete Einzelkomponenten zusammenstecke und muss ich das "Endprodukt" zwingend prüfen lassen? Was würde mich das in etwa kosten? Und wer macht sowas? --84.153.11.7 03:39, 7. Jun. 2014 (CEST)
- steht da was dazu: CE-Kennzeichnung? --Heimschützenzentrum (?) 07:55, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Hmm, es gibt ja Computershops, die Computer für einen zusammenbauen (entweder individuell oder vordefinierte Modelle). Die werden auch nur CE-Bauteile zusammenstecken und nicht jeden fertigen Computer zertifizieren können, von daher gehe ich davon aus, das sowas auch bei dir möglich ist. -- Jonathan 08:29, 7. Jun. 2014 (CEST)

- CE + CE ≠ CE. Steht in Büchern wie „CE-Kennzeichnung leicht gemacht“. Dein Produkt in Serie wird unter die EN 55011 Klasse A fallen. Das Netzteil im System unter EN 55022. Die elektrische und mechanische Sicherheit sowie Wärmeübertragung auf berührbare Teile fallen unter die EN 60950, der europäischen Variante der IEC-950, wobei diese Antwort sich auf 10 Jahre altes Wissen bezieht. Das ganze Gesetzespaket hatte lediglich den deutschen Markt der Consumer-IT fluktuiert. Die Gehäuse sind seither allgemein schlechter geworden. (Die Esoterik um die NSA nimmt bereits zu, dass Computer senden würden.) In Folge haben einige Anbieter ihre Prüfdienste eingestellt. Da die Himbeerschnitte in der Hardware-Ausstattung sich nicht wesentlich verändert, wird das auf eine Serie hinauslaufen. Computer unterscheiden sich nicht von Störspannungsdiagramm, wenn Du eine andere Festplatte einbaust. Boards und Grafikkarten siehst Du, das Gehäuse nicht zu unterschätzen. Die Computershops, die selbst zusammenbauen, sind hier in der Grauzone. Ein Trick wäre es, Bausätze zu liefern, was aber die Garantieansprüche in die Höhe treiben würde. Das läuft daraus hinaus, dass Du die AGBs entsprechend formulierst und Kundendummheit wie Elektrostatik, Leiterplatte biegen, Kurzschlüsse auf Datenleitungen von der Garantie ausschießt, was sich in Bewertungsportalen wiederspiegeln wird. (Dummheit und Rache sind auf Augenhöhe.) Die Himbeerschnitte kommt als Modul. Sie könnte der physikalischen Eigenschaften nach völlig problemlos sein, aber die Stecker sind nicht besonders dazu ausgelegt, ein eventuelles Problem mit der CE abzustellen. Anmerkung, die Mobiltelefone können es auch. --Hans Haase (有问题吗) 09:23, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Das Problem ist nicht die CE-Kennzeichnung, sondern die Konformitätserklärung. Das heißt, dass Du ein Dokument liefern musst, auf dem Du als Hersteller erklärst, dass das Produkt „Settopbox to go“ mit den einschlägigen Normen (DIN EN ... etc) und Richtlinien (z.B. Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, WEEE-Richtlinie, R&TTE-Richtlinie, etc pp) übereinstimmt und dass dieses Gerät für die Vermarkung in der EU geeignet ist. --Rôtkæppchen₆₈ 13:01, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Außerdem brauchst Du gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz eine Registrierung beim Elektroaltgeräteregister. --Rôtkæppchen₆₈ 13:58, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Wobei die EU überprüft ja nur die Konformität und das auch nur stichprobenmäßig. Dass mans die Konformität wirklich getestet hat und nicht nur vermutet, muss man nicht nachweisen. Daher wenn man sich sicher genug ist, dass die Geräte konform sind, muss man sie nicht wirklich testen, wenn sie dann bei einer Stichprobe herausstellt, dass sie doch nicht konform sind, bekommt man halt eine Strafe. Es steht ja auch unter Konformitätserklärung: Die Konformitätserklärung ist eine schriftliche Bestätigung [...] mit der der Verantwortliche (z. B. Hersteller, Händler) für ein Produkt, [...] verbindlich erklärt und bestätigt, dass das Objekt (Produkt, Dienstleistung, Stelle, QMS) die auf der Erklärung spezifizierten Eigenschaften aufweist. --MrBurns (Diskussion) 14:40, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Für das Vorhaben könnte auch ein Gespräch mit dem VDE eine Überlegung wert sein. --87.163.87.118 15:30, 7. Jun. 2014 (CEST)
- @MrBurns: Die EU selbst überprüft garnichts. Sie erlässt nur die Richtlinien, denen ein Elektrogerät entsprechen muss. Verantwortlich für die Einhaltung der Richtlinien ist immer der Hersteller oder Importeur. Deswegen wird die Konformitätserklärung auch vom Hersteller oder Importeur ausgestellt. Der Hersteller oder Importeur kann sich für die Feststellung der Konformität seines Geräts natürlich auch eines externen Gutachters bedienen. Erklären muss aber immer der Hersteller oder Importeur. Die CE-Kennzeichnung ist dabei nur ein kleiner Teil, denn sie bedeutet ja nichts anderes, als dass die betreffende Ware mit den einschlägigen Richtlinien konform ist und dass eine Konformitätserklärung vorliegt. Welche Richtlinie das ist, geht aus der CE-Kennzeichnung nicht hervor, sollte sich aber aus der Art der Ware und der Konformitätserklärung ergeben. Für Medizinprodukte ist eine Übereinstimmung mit der Spielzeugrichtlinie natürlich ebenso sinnlos wie für Spielzeug eine Übereinstimmung mit der Medizinprodukterichtlinie. Für Kleinstserienhersteller, die im wesentlichen nur Teile einkaufen, konfektionieren und weiterverkaufen, ist eine Konformitätserklärung natürlich ein extremer Aufwand, ebenso der ganze Wasserkopf, der die WEEE-Richtlinie hervorgebracht hat. In einem solchen Fall ist es evtl sinnvoller, die Komponenten einzeln zu verkaufen und vom Verbraucher zusammensetzen zu lassen. Damit ist der Verbraucher dann rechtlich gesehen der Hersteller des Geräts und das ganze Brimborium mit Komformitätserklärung, EAR und CE-Kennzeichnung kann entfallen. --Rôtkæppchen₆₈ 15:47, 7. Jun. 2014 (CEST)
- "Die EU überprüft" war wohl etwas ungenau ausgedrückt, abwr irgendwelche behördne/organisatione können wobl die einhaltung der richtlinien überprüfen und machen das auch stichprobenweise, aonst wären die richtlinien ja auch völlig wirkungslos (außer wenn durch die nichteinhaltung irgendein schaden entsteht und nemand klagt). --MrBurns (Diskussion) 17:12, 7. Jun. 2014 (CEST)
- In Deutschland ist die Gewerbeaufsicht dafür zuständig. Die Befunde wandern dann ins Rapex-Informationssystem. --Rôtkæppchen₆₈ 18:18, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Richtig, es gibt dafür Rapex. Allerdings sind die notorisch unterbesetzt und eigentlich nur damit beschäftigt, den wirklich gefährlichen elektrischen Chinamüll (der natürlich *mit* CE-Kennzeichen daherkommt) zu finden und auszusortieren. Im wesentlichen sind das Geräte mit völlig unterdimensionierten Zuleitungen und Geräte mit fehlender Schutzerdung, wo eine da sein müsste. Ich bezweifle, dass die jemals eine EMV-Messung mit irgendeinem Gerät durchführen, das nicht ohnehin von außen erkennbar einen Funksender drinhat, mit dem es rumsauen könnte.
- Wenn der OP sicher gehen will, fragt er in einem Funkamateurforum nach, ob da einer ist, der Zugriff auf Messequipment hat und weiß, wie man das bedient. Dann tut's ein Kasten Bier. Man hat dann zwar kein Prüfprotokoll, kann aber ziemlich sicher sein, dass die eigene Gerätschaft nicht rumsaut und eine spätere Messung, z.B. durch einen Wettbewerber, kein anderes Ergebnis erzielt. -- Janka (Diskussion) 18:30, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Das in China draufgeklatschte CE-Zeichen, das fast so aussieht wie das europäische, nur mit kleinerem Buchstabenabstand, bedeutet übrigens was ganz anderes: China Export, also dass das Gerät für die Ausfuhr aus China geeignet ist. Über eine Eignung im Zielland sagt das chinesische CE-Zeichen gar nichts aus. --Rôtkæppchen₆₈ 19:08, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn die es sich so leicht machen würden – nee so leicht ist es auch nicht. Bei PCs ist eine große Quelle der Sauerei selbst der Taktgenerator. Die Bussysteme sind relativ ruhig. Administrativ kannst Du Dir das vorstellen wie das Silikon für Brustimplantate eines gewissen Herstellers: Das Original zum Zertifizieren gegeben und hinterher für die Produktion die Zutaten getauscht. Das verpflichtet schlimmstenfalls die gesamte Lieferkette, wenn die Herstellungsverfahren nicht nach besser als ISO zertifiziert dokumentiert sind. Mit der Konformitätserklärung unterschreibst Du, dass alles OK ist und Du verantwortlich bist. --Hans Haase (有问题吗) 19:21, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Und wenn es dumm läuft, versaut der Taktgenerator der Himbeertorte die Empfangsgüte des DVB-T-Adapters. Wenn man das wirlich gut machen will, muss die Sache gut gekapselt sein, Himbeerkuchen und DVB-T-Stick jeweils separat, die Stromversorgung des DVB-T-Teils gefiltert und die USB-Leitung kurz und gut geschirmt sein. --Rôtkæppchen₆₈ 20:37, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Bei der Himbeerschnitte sind die Osillatoren, beschriftet mit X1 und X2, als SMD auf der Unterseite, wo auch die SD-Karte sitzt. Ich vermute die L8 (Unterseite, bei X2) und die L3 (Oberseite, über X1) filtern die zusammen mit den Kerkos auf der Unterseite die Oszillatoren gegen die Betriebsspannung. Sollte es je Probleme geben, müsstest Du hier Teile tauschen und schirmen! Das Abschirmen lernst Du an I/O-Shields und wenn Du einen TFT-Monitor aufschraubst. Besonder verlässlich ist es nicht, aber das Problem haben wohl schon andere gelöst.[13][14] --Hans Haase (有问题吗) 23:29, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Zum PC-Taktgenerator: dort gibts ja Spread Spectrum, was dafür sorgen soll, das auch bei undichten Gehäusen nicht zu viel emittiert wird (vor allem nicht die hochfrequenten Harmonischen (siehe auch Rechteckschwingung), die dann bei kleinen Öffnungen im Gehäuse austreten können). Allerdings lässt sich das im BIOS deaktivieren, was z.B. bei Übertaktern aber auch Undervoltern Standardvorgehen ist, das Spread Spectrum das Taktsignal schlechter macht. Auch viele, die sich auskennen, aber nicht übertakten oder undervolten, deaktivieren mittlerweile Spread Spectrum, weils damit z.B. bei SATA Probleme gab.[15][16][17] Die Emissionen sind dann zwar stärker (und möglicherweise in Einzelfällen auch außerhalb vom legalen Bereich), aber stören meistens nicht. --MrBurns (Diskussion) 00:57, 8. Jun. 2014 (CEST) PS: zu China: es gibt auch genug chinesische Produkte, die echte CE-Zeichen drauf haben. Dass alles aus China Müll ist, ist ohnehin nur ein Klischee, mittlerweile wird ja ohnehin fast alles im Elektronikbereich in China produziert... --MrBurns (Diskussion) 01:00, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Und wenn es dumm läuft, versaut der Taktgenerator der Himbeertorte die Empfangsgüte des DVB-T-Adapters. Wenn man das wirlich gut machen will, muss die Sache gut gekapselt sein, Himbeerkuchen und DVB-T-Stick jeweils separat, die Stromversorgung des DVB-T-Teils gefiltert und die USB-Leitung kurz und gut geschirmt sein. --Rôtkæppchen₆₈ 20:37, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn die es sich so leicht machen würden – nee so leicht ist es auch nicht. Bei PCs ist eine große Quelle der Sauerei selbst der Taktgenerator. Die Bussysteme sind relativ ruhig. Administrativ kannst Du Dir das vorstellen wie das Silikon für Brustimplantate eines gewissen Herstellers: Das Original zum Zertifizieren gegeben und hinterher für die Produktion die Zutaten getauscht. Das verpflichtet schlimmstenfalls die gesamte Lieferkette, wenn die Herstellungsverfahren nicht nach besser als ISO zertifiziert dokumentiert sind. Mit der Konformitätserklärung unterschreibst Du, dass alles OK ist und Du verantwortlich bist. --Hans Haase (有问题吗) 19:21, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Das in China draufgeklatschte CE-Zeichen, das fast so aussieht wie das europäische, nur mit kleinerem Buchstabenabstand, bedeutet übrigens was ganz anderes: China Export, also dass das Gerät für die Ausfuhr aus China geeignet ist. Über eine Eignung im Zielland sagt das chinesische CE-Zeichen gar nichts aus. --Rôtkæppchen₆₈ 19:08, 7. Jun. 2014 (CEST)
- In Deutschland ist die Gewerbeaufsicht dafür zuständig. Die Befunde wandern dann ins Rapex-Informationssystem. --Rôtkæppchen₆₈ 18:18, 7. Jun. 2014 (CEST)
- "Die EU überprüft" war wohl etwas ungenau ausgedrückt, abwr irgendwelche behördne/organisatione können wobl die einhaltung der richtlinien überprüfen und machen das auch stichprobenweise, aonst wären die richtlinien ja auch völlig wirkungslos (außer wenn durch die nichteinhaltung irgendein schaden entsteht und nemand klagt). --MrBurns (Diskussion) 17:12, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Wobei die EU überprüft ja nur die Konformität und das auch nur stichprobenmäßig. Dass mans die Konformität wirklich getestet hat und nicht nur vermutet, muss man nicht nachweisen. Daher wenn man sich sicher genug ist, dass die Geräte konform sind, muss man sie nicht wirklich testen, wenn sie dann bei einer Stichprobe herausstellt, dass sie doch nicht konform sind, bekommt man halt eine Strafe. Es steht ja auch unter Konformitätserklärung: Die Konformitätserklärung ist eine schriftliche Bestätigung [...] mit der der Verantwortliche (z. B. Hersteller, Händler) für ein Produkt, [...] verbindlich erklärt und bestätigt, dass das Objekt (Produkt, Dienstleistung, Stelle, QMS) die auf der Erklärung spezifizierten Eigenschaften aufweist. --MrBurns (Diskussion) 14:40, 7. Jun. 2014 (CEST)

- Trotzdem sind viele der in Rapex gelisteten Produkte chinesischen Ursprungs. Es sind halt nicht alle chinesischen Elektronikfabriken so fit wie Foxconn. Ich hab mal für zehn Euro einen chinesischen IDE/SATA-USB-Adapter mit Netzteil gekauft. Das mitgelieferte Kabel sah zwar aus wie ein Kaltgerätekabel, nachdem aber der Kabelmantel an einer Stelle gebrochen war, offenbarte das Kabel sein wahres Inneres: Der Schutzleiter an beiden Steckverbindern war nur vorgetäuscht, inklusive gefälschtem Typenaufdruck auf dem Kabel und das Kabel entsprach weder in Aderanzahl, noch in Aderfarbe oder Leiterquerschnitt dem aufgedruckten Typ. Dieses Kabel habe ich sofort außer Betrieb genommen, bewahre es aber als schlechtes Beispiel auf. --Rôtkæppchen₆₈ 01:27, 8. Jun. 2014 (CEST)

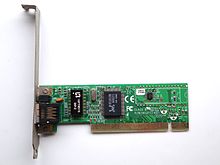
- Spread Spectrum beim Taktgenerator (Computer) wird gemacht, indem der Digitalzähler / Teiler in PLL seine Referenz nach oben oder unten verändert, vorzugsweise gezählt mit vertauschter Bitfolge im Wert des Datenwortes, was ein Rauschen bewirkt und die damit verbundene Streuung. Bei einem Oszillator mit festem Takt geht das nicht! Taktsignale werden verzögert durch länger hin und her geführte Leiterbahnen. Das siehst Du an dieser Netzwerkkarte, über der linken Gap des PCI-Busses, unter dem Stempel, links vom Controller. Das wird auch durch kleine Widerstände wie 10 … 47 Ω erreicht. Nur kostet das Bauteil, aber es hat eine RC-Tiefpass-Charakteristik. Bei 4,7 kΩ und mehr Impedanz auf den Eingängen, ist das fast nichts, was das Signal im Pegel beschädigt, aber verzögert, die Flankensteilheit abnehmen lässt und das Überschwingen dämpft. Mehr noch: Der Oszillator hat seinen Verstärker eingebaut. Seine Ausgangslast gibt er an die Betriebsspannung ab, wenn er schaltet. Für die Verschwörungstheoretiker: Ja, wenn Du den Taktgenerator über die SO-Schnittstelle umprogrammierst, kannst Du damit FM-Senden und den Keylogger-Output ein paar Meter durch die Luft übermitteln. Das bedeutet auch, dass der Empfänger nicht weit ist. Ein anderer Computer ist das nicht, da er ähnlich stört. Du solltest Dir dann überlegen, welche Bauteile am Taktgenerator eingespart wurden. --Hans Haase (有问题吗) 08:50, 8. Jun. 2014 (CEST) PS: Hier werden Sie gefunden[18].
Auch römisch-katholisch, aber etwas anderes
Der obige Thread brachte mich auf eine Frage, die ich mir früher oft gestellt habe: Seit wann heißt in der Schiffersprache das Anlegemanöver rückwärts mit Buganker und Heckleinen "römisch-katholisch"? Die gängige Erklärung (von lustig gemeinten Anspielungen auf jüngste Skandale abgesehen) ist ja, dass diese Art anzulegen besonders im katholischen Mittelmeerraum verbreitet sei. Kam dieser Begriff dann erst mit dem Segeltourismus im späteren 20. Jahrhundert auf, oder ist er traditioneller? Grüße Dumbox (Diskussion) 08:06, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Der katholische Mittelmeerraum ist ja durchweg nicht so deutschsprachig. Vielleicht sollte man nach dem entsprechenden Begriff auf Spanisch, Französisch, Italienisch suchen? In welcher Sprache hast du denn davon gehört und wie heißt diese a-tergo-Anlegerei dort? Hummelhum (Diskussion) 22:30, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Vielen Dank für die Denkhilfe! Englisch "stern-to berthing" heißt, wie ich sehe, auch "Mediterranean berthing",französisch "amarrage à la méditerranéenne", gelegentlich sogar "Roman Catholic berthing". Es scheint also wirklich darauf hinauszulaufen, dass norddeutsche (daher natürlich protestantische) Segler diese Art des Anlegens scherzhaft mit dem katholischen Süden konnotierten, seit wann auch immer. Grüße Dumbox (Diskussion) 23:13, 7. Jun. 2014 (CEST) In der WP findet sich nicht viel dazu, also wenn sich jemand berufen fühlt... Dumbox (Diskussion) 23:30, 7. Jun. 2014 (CEST)
Zeitstempel von eingehenden WhatsApp-Nachrichten
Moin,
Falls eine WhatsApp-Nachricht z.B. wegen nicht vorhandenem Empfang nicht sofort versendet wird (sondern erst Stunden später), welchen Zeitpunkt des Nachrichteneinganges bekommt der Empfänger dann angezeigt? Es gibt da im Prinzip drei Möglichkeiten:
1. Der Zeitpunkt, an dem der Versender auf den Button geklickt hat
2. Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht das Handy des Versenders verlassen hat
3. Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht beim Empfänger eintrifft
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Es geht um Geräte vom Typ Samsung Galaxy S III und Samsung Galaxy S4 mini, falls das was helfen sollte. --Waver8500 (Diskussion) 15:33, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Bei unterschiedlichen Zeitzonen gibt es dann noch mehr Möglichkeiten. Welche umgesetzt wird, weiß ich nicht. --mfb (Diskussion) 15:35, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Nein, es ist die exakt gleiche Zeitzone. Ich möchte gerne wissen, ob zwischen dem Abschicken zweier Nachrichten, von denen eine zwei Stunden später, als die andere ankam, wirklich zwei Stunden lagen oder ob die zweite Nachricht theoretisch doch sofort nach der ersten versendet worden sein könnte. --91.21.2.41 15:49, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Falls bei dir möglich: Beide Handys zeitsynchronisieren, nebeneinander legen und ein paar Testnachrichten verschicken. Am besten dann jeweils bei "Sekunde 59", dann kann man gleich sehen, ob's bei dem anderen bei "Sekunde 59" oder wegen Verzögerung bei "Sekunde 00" ankommt. --2003:63:2F35:5C00:617A:474D:86D5:30E4 16:55, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Möglichkeit 3 ist zutreffend (Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht beim Empfänger eintrifft). Genau dann erschient auch beim Absender ein zweites grünes Häkchen unter der versendeten Nachricht (Empfangsbestätigung (≠ Lesebestätigung)). --Buchling (Diskussion) 00:52, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Möglichkeit 3 ist es nicht. Dann hätten ja alle Nachrichten, die jemand geschickt hat während ich das Telefon aus hatte, bei mir den Zeitstempel des Zeitpunkts an dem ich es wieder einschaltete (bzw. wieder Internetempfang hatte). Sie haben aber eine frühere Uhrzeit (und inzwischen sogar ein Datum, ich meine, dass das früher nicht der Fall war, so dass man nach ein paar Tagen Smartphone-Internet-Abstinenz tatsächlich lauter Nachrichten hatte, von denen man nicht sagen konnte, ob sie von gerade eben oder doch von vorvorgestern waren). Ob es nun 1 oder 2 ist, kann ich nicht sagen. --YMS (Diskussion) 16:33, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Möglichkeit 3 ist zutreffend (Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht beim Empfänger eintrifft). Genau dann erschient auch beim Absender ein zweites grünes Häkchen unter der versendeten Nachricht (Empfangsbestätigung (≠ Lesebestätigung)). --Buchling (Diskussion) 00:52, 8. Jun. 2014 (CEST)
Bleiben im Router gespeicherte Einstellungen bei 6monatiger Trennung vom Strom erhalten?
z.B. in der FBox 7490? Danke und viele Grüße - Fritzchen --80.135.249.103 15:57, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Der von Dir genannte Router nutzt einen Flash-Speicher, der seinen Inhalt auch ohne Stromzufuhr mindestens zehn Jahre halten sollte. --Rôtkæppchen₆₈ 16:09, 7. Jun. 2014 (CEST)
Das ist sehr, sehr beruhigend für mich. Vielen Dank für die schnelle Antwort!! (nicht signierter Beitrag von 80.135.249.103 (Diskussion) 18:07, 7. Jun. 2014 (CEST))
- Bei aktuellen Flashroms überlebt uns der Erhalt der Information. Die Passivbauteile außenrum segnet vorher das zeitliche. --Hans Haase (有问题吗) 19:18, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Auch bei Trennung vom Strom? --Rôtkæppchen₆₈ 20:12, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, im Datenblatt genannt „shelf life“ oder „shelflife“.[19] --Hans Haase (有问题吗) 21:14, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Zum Glück wurde mittlerweile der Polymerkondensator erfunden. --Rôtkæppchen₆₈ 21:23, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, im Datenblatt genannt „shelf life“ oder „shelflife“.[19] --Hans Haase (有问题吗) 21:14, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Auch bei Trennung vom Strom? --Rôtkæppchen₆₈ 20:12, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Bei aktuellen Flashroms überlebt uns der Erhalt der Information. Die Passivbauteile außenrum segnet vorher das zeitliche. --Hans Haase (有问题吗) 19:18, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Das kannst Du laut sagen. Die EPROMs waren früher auf 10 Jahre Datenerhalt gebaut. Die heutigen Flashs können erheblich länger. Wenn Du meinst, Du holst OTPs, vergiss es. Du bekommst mit großer Wahrscheinlichkeit EEPROMs, die Du genauso per Command löschen kannst. Ich vermute, dass sie lediglich die spezifizierte Zahl der Wiederbeschreibzyklen nicht aushalten. Viele sind eh nur 1x mit Daten bestückt und das war es dann. --Hans Haase (有问题吗) 21:26, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Meint ihr das ernst? Bei Al-Elkos ist das "shelf life" wichtig, weil sie mit der Zeit ihre Formierung verlieren. Sie dürfen also nicht allzu lange rumliegen, bevor sie verbaut werden, sonst BUMM beim Einschalten. Bei anderen Bauteilen setzt die Verzinnung der Anschlussbeinchen Grenzen, weil Zinn unterhalb 16°C langsam die Modifikation ändert und danach viel leichter oxidiert. Lagerräume sind selten temperiert.
- Mit der Haltedauer der Daten in einem EPROM/EEPROM/FlashROM hat das alles nichts zu tun. Den Wert findet man unter "Data rentention time". Die Speicherdauer der Daten in einer Zelle hängt vom Ladungsverlust im Floating Gate ab, ist daher sogar im stromlosen Zustand besser als wenn der Chip bestromt wird, weil eben jeder Ladungswechsel in der Nähe auch das Floating Gate beeinflusst. -- Janka (Diskussion) 21:31, 7. Jun. 2014 (CEST)
- „Data rentention time“: Hier steht was von bis zu 20 Jahren. --87.163.84.92 10:02, 8. Jun. 2014 (CEST)
- @Janka: Unterhalb von 13,2 bis 16 °C wandelt sich metallisches β-Zinn in nichtmetallisches bzw halbleitendes α-Zinn um. Diese sogenannte Zinnpest hat nichts mit Oxidation zu tun, sondern mit Allotropie. Früher, als es RoHS noch nicht gab, wurde dem Lötzinn 40 bis 60 Prozent giftiges Blei beigemischt, was außerdem für eine ordntliche Oberflächenspannung sorgte. Bleifreies Lötzinn, wie es seit einigen Jahren Pflicht ist, ist beim Handlöten eine Katastrophe. Zum Glück hab ich noch eine Spule gutes Bleilot daliegen. --Rôtkæppchen₆₈ 00:04, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Genau, es wandelt die Modifikation um. Da die alpha-Modifikation aber mehr Raum einnimmt als die beta-Modifikation, bricht die Oberfläche auf und die Verzinnung verwandelt sich in Zinnstaub. Und der oxidiert dann wunderbar und verhindert einen benetzbaren Kontakt zur Lötpaste auf der Platine beim Löten. Dagegen hilft nur abätzen und neuverzinnen der Beinchen. Oder wegschmeißen. Fatal ist vor allem, dass es einzelne Beinchen so'n bisschen betreffen kann und das ganze dann erst bei mechanischer Belastung kaputtgeht. So erzeugt man zusätzlichen, giftigen Elektroschrott. -- Janka (Diskussion) 01:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Was das Handlöten betrifft: Hobby-Lote sind ja ausdrücklich von RoHS ausgenommen, daher gibts noch immer genug bleihältige Lote zu kaufen, siehe z.B. [20] --MrBurns (Diskussion) 02:20, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich löte aber auch gelegentlich für meinen Arbeitgeber irgendwelche nicht zur Veräußerung bestimmten Einzelstücke zusammen, ohne mich um RoHS-Vorschriften zu kümmern. --Rôtkæppchen₆₈ 02:50, 9. Jun. 2014 (CEST)
Wie dimensioniere ich eine Leuchtdiodenschaltung?
Ich beabsichtige, mir eine LED-Leuchte selbst zu bauen. Diese soll aus einem handelsüblichen Steckernetzteil, Leuchtdioden und Vorwiderständen bestehen. Wie ich aus Versorgungspannung, Leuchtdiodenspannung und Leuchtdiodenstrom den Vorwiderstand berechne, ist mir auch klar. Die Betriebsspannung ist noch nicht festgelegt, soll aber eine gängige sein (5, 12, 15, 24 Volt). Was ich leider nicht weiß ist, wie sich der Innenwiderstand der Leuchtdiode zum Vorwiderstand verhalten soll. Gibt es da irgendwelche Faustregeln oder Dimensionierungsformeln? --Elkofragesocke (Diskussion) 17:17, 7. Jun. 2014 (CEST)
- das da find ich ganz nützlich: [21]... --Heimschützenzentrum (?) 17:25, 7. Jun. 2014 (CEST)
- ach so: jetzt seh ich erst, welche Schaltung angestrebt wird: mit nem ohmschen, halbwegs konstanten Vorwiderstand und ner halbwegs konstanten Eingangsspannung... das ist ja eigentlich unlustig, wenn man Energie sparen will... schöner wär es doch ne Konstantstromquelle zu basteln: also sowas Buck-Converter mit nem Stromsensor als Feedback... --Heimschützenzentrum (?) 17:52, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Vorwiderstände sind für Leuchten Käse, weil sie die Energie verheizen, die man durch den Umstieg vom Glühobst doch gerade sparen will. Ohne Schaltwandler wird das nix. Wenn du tatsächlich selbst basteln willst, probiere die einfache Schaltwandler-Schaltung im Leuchtdioden-Artikel aus. Einen passenden Ferritkern lötest du von einem defekten PC-Mainboard runter, da sind heutzutage etliche drauf.
- Sinnvoller ist es allerdings, sich ein fertig aufgebautes 12V-LED-Leuchtmittel in 50mm-Rewflektorform im Elektromarkt oder bei IKEA oder aktuell beim Aldi zu kaufen, kostet etwa 6..8€. Daran ein stinknormales 12V/300mA-Steckernetzteil anschließen, fertig. Regelung ist im Leuchtmittel eingebaut. -- Janka (Diskussion) 18:14, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Die Joule thief-Schaltung gibt auch fertig zu kaufen.[22] --Rôtkæppchen₆₈ 18:26, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Bei Indikations-LEDs genügt ein Vorwiderstand. Dabei wird die Spannung der Spannungsquelle von der für die der LED typischen Durchlassspannung abgezogen und mit dem Betriebsstrom der LED errechnet. Ohmsches Gesetz: Rvor=Uvorwiderstand/Idurchflussstrom. Bei LeistungsLEDs oder CompactLightSources würde da zuviel Verlust entstehen. Prinzipiell wird die Schaltung gleich dimensioniert, um ein Verständnis der Grundlagen zu geben. Die Kennlinie einer LED unterscheidet sich nur unwesentlich von der einer Diode. Der größte Unterschied ist die Durchflusspannung. Bei Silizium 0,6…0,7V; bei roten LEDs 1,6V; grün 2,2V usw. siehe Datenblatt. --Hans Haase (有问题吗) 19:05, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Weiße LEDs haben um die 3,3 bis 3,4 Volt Durchlassspannung. Typische Durchlassströme sind 20 oder 30 Milliampere. --Rôtkæppchen₆₈ 19:13, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Guter Anhaltspunkt, nur kommt das auf die Leistung der LED an. RTFD! (Datasheet/Manual) --Hans Haase (有问题吗) 19:21, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Weiße LEDs haben um die 3,3 bis 3,4 Volt Durchlassspannung. Typische Durchlassströme sind 20 oder 30 Milliampere. --Rôtkæppchen₆₈ 19:13, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Bei Indikations-LEDs genügt ein Vorwiderstand. Dabei wird die Spannung der Spannungsquelle von der für die der LED typischen Durchlassspannung abgezogen und mit dem Betriebsstrom der LED errechnet. Ohmsches Gesetz: Rvor=Uvorwiderstand/Idurchflussstrom. Bei LeistungsLEDs oder CompactLightSources würde da zuviel Verlust entstehen. Prinzipiell wird die Schaltung gleich dimensioniert, um ein Verständnis der Grundlagen zu geben. Die Kennlinie einer LED unterscheidet sich nur unwesentlich von der einer Diode. Der größte Unterschied ist die Durchflusspannung. Bei Silizium 0,6…0,7V; bei roten LEDs 1,6V; grün 2,2V usw. siehe Datenblatt. --Hans Haase (有问题吗) 19:05, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Die Joule thief-Schaltung gibt auch fertig zu kaufen.[22] --Rôtkæppchen₆₈ 18:26, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Die XM-L 2 U2 von Cree mag 3A... *kicher* --Heimschützenzentrum (?) 19:28, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Übrigens gibt es für -,30 … 2,50 € SMD-8-Füßler als Abwärtswandler, speziell für die Anwendung für LEDs. Diese benötigen 1 bis 3 Widerstände, eine Induktivität um die 2,2µH und eine Schottky-Diode neben der LED / den LEDs. Damit wird alles was Gleichspannung von 5 bis 30 V ist, für die LED(s) aufbereitet. --Hans Haase (有问题吗) 23:37, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Vielleicht auch hilfreich, was man auf der Seite so findet: http://www.led-treiber.de ?--StYxXx ⊗ 04:31, 10. Jun. 2014 (CEST)
Urbane Seilbahnen in Südamerika
Nachdem unser Mitstreiter @Ohrnwuzler: hier im Moment nicht mehr mitmacht, versuche ich teils vergebens genaue geografische Standorte von Seilbahnstationen für die Liste der Luftseilbahnen und Artikel, grade im ÖPNV zusammenzutragen. Weder die WP in Südamerika, OpenStreetMap, noch die Luftbilder kommerzieller Anbieter sind ausreichend aktuell und gepflegt, um da reputables rauszubekommen. Hinzukommen meine Sprachkenntnisse von ES-0. Kann jemand helfen?
--Hans Haase (有问题吗) 19:36, 7. Jun. 2014 (CEST)
Ich biete dir meine Hilfe an. Wenn du eine Spanische oder Portugiesische Webseite findest werde ich sie für dich nach Aktualität und quellen überprüfen und dir mitteilen was da genau steht. Und wenn du eine Seilbahn gefunden hast in südamerika, in einer bestimmten stadt, kann ich mittels Twitter und Schrottbook jemanden finden, der dort in der Nähe wohnt und der Einheimische kann dann genau sagen "ja die gibts" oder "nein der schrott wurde seit jahren nicht mehr bewegt / ein Vogel hat die seile durchgefressen". Hoffe also du hast mitlerweile schon etwas zum Überorüfen oder kannst mir einen Standort nennen. --Motorolakzrz (Diskussion) 19:50, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Danke, schau mal es:Mi Teleférico an und sage mit, ob der Google-Übersetzer falsch liegt. Koordinaten fehlen ganz hoffnungslos.
- Metro de Medellín habe ich die Linie K eindeutig gefunden. Die Line L und J sind nicht eindeutig nachvollziehbar. Zwar knüpft eine an die Linie K an, nur die andere Station scheint viele km weiter weg zu liegen. Das kann ich so unbelegt nie in den Artikel bringen. Es müssen eindeutige Belege her. Das interessante an den Dingern ist, dass die sich teils schon amortisiert haben. Eine weitere Zeitung schreibt, dass sich die Kriminalität durch die Mobilität (vielleicht auch Augen von oben) deutlich abgesunken ist. Von 3 Städten weis ich, dass es Seilbahnen gibt. Den Nachrichten nach, dürften das weit mehr sein oder werden. Ab wo die stehen und was die leisten und kosten fehlt ganz einfach. --Hans Haase (有问题吗) 21:38, 7. Jun. 2014 (CEST)
„Freiräume“
In den Achtzigerjahren forderten Jugendliche ein Autonomes Jugendzentrum (AJZ), heute fordern sie „Freiräume“. Weiß jemand etwas Genaueres zur Begriffsgeschichte des letzteren Begriffs. Wer hat ihn geprägt, wo tauchte er erstmals auf, wie verbreitete, popularisierte er sich? --= (Diskussion) 20:32, 7. Jun. 2014 (CEST)
P.S. Der Artikel Freiraum (Mensch) scheint mir eine löschwürdige Theoriebildung zu sein.
- Einige an sich unverdächtige Quellen, die nur leider mit dem zu etablierenden Begriff nichts zu tun haben, dazu ein blog und eine "Diplomarbeit" von wenigen Seiten und in Form einer "bunten Kartierung", die aus einigen flotten Sprüchen besteht ("Mmh, in meiner Jugend war meiner liebste Box die mit Lego, nun ist es eine Kiste Bier.").
- Das ist kein Enzyklopädie-Artikel, sondern (gerade, da tief empfunden) etwas, das auch den bescheidensten Ansprüchen, die man an die Karikatur eines Enzyklopädie-Artikels stellen müsste, nicht entspricht. Vermutlich bleibt so ein Müll drin, weil er sich vage links oder alternativ oder so anhört (und damit zu den "Guten" gehört). Hummelhum (Diskussion) 22:25, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Frage dem Ngram Viewer gestellt (hach, ich mag ihn). Seine Antwort: Die 68er!--Antemister (Diskussion) 22:45, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Du hast den englischen Corpus verlinkt, daher hier noch der deutsche Corpus im Ngram Viewer. An dem Artikel Freiraum (Mensch) ist auch zu beanstanden, dass die Definition im ersten Satz, „Ein Freiraum ist...“ mit www.wortbedeutung.info als Referenz belegt wird, die zwar die Definition genauso hat, aber sich dafür auf den Wikipedia-Artikel beruft, also der beliebte circulus vitiosus.--Pp.paul.4 (Diskussion) 00:01, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Frage dem Ngram Viewer gestellt (hach, ich mag ihn). Seine Antwort: Die 68er!--Antemister (Diskussion) 22:45, 7. Jun. 2014 (CEST)
Politische Positionierung von Partei-Landesverbänden
Ich suche nach einer Untersuchung, wo die Landesverbände von SPD und CDU zu verorten sind, also ob sie eher dem rechten oder dem linken Parteiflügel zuzuordnen sind . So gilt die CDU Hessen ja als vergleichsweise konservativ. Was ich mich nun frage, ob es eine entsprechende Einordnung für alle Landesverbände gibt. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen? Ich konnte jetzt nichts finden, habe aber vielleicht die falschen Suchbegriffe verwendet. --BHC (Disk.) 21:22, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Würde mich wundern, wenn es zu einer so schwammigen, schwer zu objektivierenden Fragestellung wissenschaftliche Untersuchungen mit belastbaren Ergebnissen gibt. --188.107.141.255 22:24, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Eine allgemeine Verortung im Politischen Spektrum würde genügend oder eine Störmungszuordnung wie bei den Jusos (Jusos#Strömungen). --BHC (Disk.) 12:21, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die Fragestellung ist weder schwammig noch schwer zu objektivieren. Das Stichwort heißt Parteienforschung und ist eine alte Disziplin der political science. Es wäre allerdings bei solchen Fragen sinnvoll, den Untersuchungszeitraum einzugrenzen. Wenn das für die gesamte Geschichte der Bundesrepublik gefragt ist, wird es vielleicht viel Leseaufwand. --87.149.169.112 16:24, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Es geht um Heute, also wie die Landesverbände aktuell eingeschätzt werden. --BHC (Disk.) 17:07, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Da wirst du um etwas OR nicht herumkommen. Beispiel Hessen, von dir eingangs erwähnt: Vom traditionellen Erzkonservativismus a la Dregger und Kanther spürt man nicht viel; immerhin regiert hier eine schwarz-grüne Koalition. Seit Koch herrscht der Pragmatismus, durchaus verbunden mit Sicherung der eigenen Altersversorgung der, in toto, studierten Juristen. Die Tankstellen-Connection hat sich durchgesetzt. Grüße Dumbox (Diskussion) 18:08, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Klar, die Einordnung ist immer schwierig, aber zumindest bei der SPD (mit den offiziellen Strömungen) sollte sich eigentlich eine Einordnung wie bei den Jusos finden (Jusos#Strömungen). Ich finds nur selbst nicht. --BHC (Disk.) 14:54, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Da wirst du um etwas OR nicht herumkommen. Beispiel Hessen, von dir eingangs erwähnt: Vom traditionellen Erzkonservativismus a la Dregger und Kanther spürt man nicht viel; immerhin regiert hier eine schwarz-grüne Koalition. Seit Koch herrscht der Pragmatismus, durchaus verbunden mit Sicherung der eigenen Altersversorgung der, in toto, studierten Juristen. Die Tankstellen-Connection hat sich durchgesetzt. Grüße Dumbox (Diskussion) 18:08, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Es geht um Heute, also wie die Landesverbände aktuell eingeschätzt werden. --BHC (Disk.) 17:07, 8. Jun. 2014 (CEST)
Lustige Urteile
Zufällig mal beim googeln auf ein "Bierkutscher-Urteil" gestoßen, von dem ich dachte der Seitenbetreiber hat da eine banale Geschichte etwas ausgeschmückt. Aber nein, das gab es wirklich [23], auch in der WP wird es bei Eugen Menken erwähnt. Frage: Hat so etwas den vor höheren Instanzen bestand?--Antemister (Diskussion) 23:17, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Höhere Instanzen prüfen, falls solche Urteile vor sie gelangen, die juristische Fundiertheit der Entscheidung und nicht die sprachliche Qualität der Urteilsbegründung. Und ja, dann können solche Urteile durchaus Bestand haben. Sie machen dann zwar gerne mal die Runde in Kantinen und auf den Fluren, manche gelangen auch in Fachzeitschriften oder heutzutage ins Internet - aber Einfluss auf Berufungs- oder Revisionsentscheidungen hat das alles nicht. --Snevern 23:32, 7. Jun. 2014 (CEST)
- Manchmal schafft es halt auch der Richter nicht, ganz ohne Witz und/oder Sarkasmus aus zu kommen. Gerade wenn es um wirkliche Banalitäten geht. Da kann sich der Richter manchmal schon fragen, was ER verbrochen hat, dass er diesen Fall bearbeiten muss. Und mit einem entsprechendem Unterton können dann die Fragen an die beiden Streithähne ausfallen. Oder eben dass sich die Punkte und Begründungen, die ihm vorgetragen wurden, sich mehr oder weniger wortwörtlich auch im Urteil wieder finden. Und die sind zum Teil wirklich am besten mit „lächerlich“ Umschrieben. Endsprechen zum schmunzeln ist dann natürlich auch die Urteilsbegründung. --Bobo11 (Diskussion) 09:35, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Diesem Richter gebührt der Orden wider den tierischen Ernst! Gruß -- Dr.cueppers - Disk. 09:50, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Das Urteil ist klasse, ich lach mich hier gerade schlapp. Denn in „sämtlichen ziviliserten Nationen Europas, sowie Bayerns“ ist die Einführung „Kuh-Bier-Kutschenbetriebes“ nicht durchsetzbar, obwohl doch das „Rindvieh verherrlicht“ wird. ;-) --BHC (Disk.) 10:08, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Formfehler: Der 12. Oktober 1984 liegt außerhalb der Narrenzeit. --Hans Haase (有问题吗) 08:32, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das Urteil ist klasse, ich lach mich hier gerade schlapp. Denn in „sämtlichen ziviliserten Nationen Europas, sowie Bayerns“ ist die Einführung „Kuh-Bier-Kutschenbetriebes“ nicht durchsetzbar, obwohl doch das „Rindvieh verherrlicht“ wird. ;-) --BHC (Disk.) 10:08, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Diesem Richter gebührt der Orden wider den tierischen Ernst! Gruß -- Dr.cueppers - Disk. 09:50, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Manchmal schafft es halt auch der Richter nicht, ganz ohne Witz und/oder Sarkasmus aus zu kommen. Gerade wenn es um wirkliche Banalitäten geht. Da kann sich der Richter manchmal schon fragen, was ER verbrochen hat, dass er diesen Fall bearbeiten muss. Und mit einem entsprechendem Unterton können dann die Fragen an die beiden Streithähne ausfallen. Oder eben dass sich die Punkte und Begründungen, die ihm vorgetragen wurden, sich mehr oder weniger wortwörtlich auch im Urteil wieder finden. Und die sind zum Teil wirklich am besten mit „lächerlich“ Umschrieben. Endsprechen zum schmunzeln ist dann natürlich auch die Urteilsbegründung. --Bobo11 (Diskussion) 09:35, 8. Jun. 2014 (CEST)
8. Juni 2014
CSS-Frage
Kann ich per CSS-Code für kursive Textteile (generell) eine andere Schriftart setzen als für den Rest: also zum Beispiel Kursives in Times New Roman, restlicher Text in Arial?
Der eigentliche Hintergrund ist folgender: Nachdem ich anfangs skeptisch gewesen bin, verwendet ich mittlerweile auch Ebooks, und zwar mittels Lese-App auf dem Smartphone, wo ich meine bevorzugte Schfriftart einstellen konnte. Besagter Font verfügt aber über keinen kursiven Schnitt. Schöne Grüße • ![]() • hugarheimur 00:10, 8. Jun. 2014 (CEST)
• hugarheimur 00:10, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Geht es nun um Ebooks, oder um Wikipedia? -- Janka (Diskussion) 00:44, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Beides … primär zwar um meinen EBook-Reader (sonst hätte ich auf FzW gefragt), aber eventuell auf meine vector.css übertragbar. Ich möchte kursiv gesetzten Textstellen eine andere Schriftart zuweisen als nicht kursiv gesetzten. Grüße •
 • hugarheimur 01:48, 8. Jun. 2014 (CEST)
• hugarheimur 01:48, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Mit den Doppel-Ticks kursiv gemachtes wird im Mediawiki zu <i>Foo</i> umgesetzt, da brauchst du also im vector.css nur "i {font-family: Times New Roman, Times;}" zu schreiben. Wie dein Ebook-Reader es umsetzt, weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung, ob das Ding überhaupt CSS annimmt. Du solltest mal verraten, um was für ein Gerät es sich überhaupt handelt. -- Janka (Diskussion) 02:11, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Danke, damit kann ich jetzt auf jeden Fall experimentieren. Die Lese-App auf meinem Xperia X10 heißt Moon+ Reader. Grüße •
 • hugarheimur 02:20, 8. Jun. 2014 (CEST)
• hugarheimur 02:20, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Kannst du auf deinem Smartphonebzw. in Moonreader keinen anderen Font installieren, der Kursive enthält? Auswahl gibts ja genug, es sieht besser aus als so ein Mix, und du musst das nur einmal machen. Rainer Z ... 10:29, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Danke, damit kann ich jetzt auf jeden Fall experimentieren. Die Lese-App auf meinem Xperia X10 heißt Moon+ Reader. Grüße •
- Mit den Doppel-Ticks kursiv gemachtes wird im Mediawiki zu <i>Foo</i> umgesetzt, da brauchst du also im vector.css nur "i {font-family: Times New Roman, Times;}" zu schreiben. Wie dein Ebook-Reader es umsetzt, weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung, ob das Ding überhaupt CSS annimmt. Du solltest mal verraten, um was für ein Gerät es sich überhaupt handelt. -- Janka (Diskussion) 02:11, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Beides … primär zwar um meinen EBook-Reader (sonst hätte ich auf FzW gefragt), aber eventuell auf meine vector.css übertragbar. Ich möchte kursiv gesetzten Textstellen eine andere Schriftart zuweisen als nicht kursiv gesetzten. Grüße •
Personalausweis
Hallo,
Ab welchem alter muss man einen Personalausweis besitzen.
Viele Gruesse, --2.201.212.113 00:49, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Gar nicht, siehe Personalausweis (Deutschland)#Allgemeines: „Deutsche Staatsangehörige müssen ab Vollendung des 16. Lebensjahrs einen Ausweis zur Feststellung der Identität besitzen […]. Diese Pflicht kann durch einen Personalausweis oder einen Reisepass erfüllt werden […]. Wer einen Reisepass besitzt, muss also keinen Personalausweis besitzen.“ — ireas (Diskussion) 00:52, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Wobei der Reisepass merklich teurer ist als der Perso. --88.130.121.20 11:55, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Und auch unhandlicher. --mfb (Diskussion) 14:09, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Und die Adresse steht nicht drin. Wenn man die nachweisen soll, muss man sich erst eine Meldebescheinigung besorgen. --dapete 15:15, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Wobei der Reisepass merklich teurer ist als der Perso. --88.130.121.20 11:55, 8. Jun. 2014 (CEST)
Himbeeren - Rutenkrankheit
Himbeeren - Rutenkrankheit
kann ich keinen Hinweis auf ein Gegenmittel finden. Welches Fungizit ist wirksam ? --84.187.94.148 09:18, 8. Jun. 2014 (CEST)
- In der Schweiz wird mit Kupfer wie im Weinanbau gearbeitet.[24] Die Erreger der Rutenkrankheit sind jedoch mehrere. Die Ministerien hier setzen auf resistente Sorten.[25] --Hans Haase (有问题吗) 09:46, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Eigentlich sollst Du Suchmaschinen benutzen bevor Du hier Fragen einträgst, wie ganz oben auf dieser Seite zu lesen ist.
- Fundstellen im Internet gibt es zu Deiner Frage einige, sowohl mit Fungiziden zur Gegenmaßnahme als auch ohne. --87.163.84.92 09:41, 8. Jun. 2014 (CEST)
- [26] --Hans Haase (有问题吗) 12:05, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Himbeeren wachsen am liebsten auf sonnigen gerodeten Waldflächen. Dort brauchen sie auch keine Pestizide, Herbizide oder Fungizide. Dort wo ich derzeit wohne, in Siebenbürgen, gibt es an den Karpathenhängen hektargroße Himbeerfelder, die nach einem Kahlschlag ganz wild entstanden sind. Wenn man Probleme mit der Rutenkrankheit hat, ist der Standort einfach ungeeignet, weil zu feucht. Da sollte man lieber über eine Drainage nachdenken, als die Chemie-Keule auszupacken. Wer will denn sowas bitte noch essen? --El bes (Diskussion) 23:31, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist aber immer noch besser als norovirenverseuchte Tiefkühlhimbeeren aus China, die vor zwei Jahren in Deutschland für eine Brechdurchfallepidemie mit über 10.000 Erkrankten gesorgt haben. --Rôtkæppchen₆₈ 00:11, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Teile Chinas liegen in der selben Klimazone wie Mitteleuropa, weshalb es auch die selben Kulturpflanzen dort gibt. Aber angesichts der Umweltverschmutzung dort, den katastrophalen hygienischen Standards und der nicht-existenten Umweltgesetzgebung, sollten Lebensmittelimporte aus China eigentlich komplett verboten sein. Von den Sozialstandards gar nicht zu sprechen. Dass solche Lebensmittel überhaupt in der EU in den Handel kommen, zeugt davon, wie wenig die Bürokraten in Brüssel das Wohl der europäischen Verbraucher interessiert. --El bes (Diskussion) 00:20, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich finde es auch unverantwortlich. Umgekehrt sind chinesische Mütter aber von deutschen und europäischen Säuglings- und Kindermilchprodukten begeistert, weil so etwas wie der Melaminskandal in Deutschland nicht vorkommen kann. Dafür haben wir hier andere Lebensmittelskandale: Unkrautvernichtungsmittel, Dioxin, Nematoden, Glykol, Gammelfleisch jtnaf. --Rôtkæppchen₆₈ 00:25, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Diese Probleme gibt es in China genau so, nur noch schlimmer. Aber nur selten wird ein Medienskandal draus. --El bes (Diskussion) 00:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Nun ja, als jemand der seit vier Jahren dort lebt und dem in der Zeit dort zwei Kinder geboren wurden und bisher gesund aufwachsen: Es ist zwar auf der einen Seite richtig und man wird ein mulmiges Gefuehl nicht ganz los, was die Ernaehrung anbetrifft. Auf der anderen Seite kann es wiederum auch nicht ganz so schlimm sein: In Shanghai ist die Saeuglingssterblichkeit beispielsweise fuer 2012 mit 5.07 fast genau auf europaeischem Niveau und weit vor dem typischer Entwicklungslaender (Vergleichswerte). Dazu noch andere moegliche zu beruecksichtigende Risiken wie hohe Unfallrate, kaum Kindersitze in den Autos, Atemwegs-und Hauterkrankungen durch Luftverschmutzung etc. Dass die im laendlichen Bereich deutlich hoeher ist, deutet darauf hin, dass es eher am Wohlstand der Familie haengt als an der Gefahr durch Lebensmittel in den Kaufhaeusern. Zwischen klischeehafter Wahrnehmung aus der Ferne und dem Alltag ist es schon noch ein Unterschied. Genau wie man als Chinese Angst haben koennte, in Europa staendig auf offener Strasse von Neonazis verpruegelt zu werden. -- 160.62.10.13 05:42, 9. Jun. 2014 (CEST)
- +1 Dankeschön. Der sogenannte "katastrophale hygienische Zustand" ist durchaus vergleichbar mit dem in Deutschland in den 50ern. Kann mir auch nicht vorstellen, dass die heutige Situation in den östlichsten Europazipfeln so viel besser ist.--78.34.3.151 12:38, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Nun ja, als jemand der seit vier Jahren dort lebt und dem in der Zeit dort zwei Kinder geboren wurden und bisher gesund aufwachsen: Es ist zwar auf der einen Seite richtig und man wird ein mulmiges Gefuehl nicht ganz los, was die Ernaehrung anbetrifft. Auf der anderen Seite kann es wiederum auch nicht ganz so schlimm sein: In Shanghai ist die Saeuglingssterblichkeit beispielsweise fuer 2012 mit 5.07 fast genau auf europaeischem Niveau und weit vor dem typischer Entwicklungslaender (Vergleichswerte). Dazu noch andere moegliche zu beruecksichtigende Risiken wie hohe Unfallrate, kaum Kindersitze in den Autos, Atemwegs-und Hauterkrankungen durch Luftverschmutzung etc. Dass die im laendlichen Bereich deutlich hoeher ist, deutet darauf hin, dass es eher am Wohlstand der Familie haengt als an der Gefahr durch Lebensmittel in den Kaufhaeusern. Zwischen klischeehafter Wahrnehmung aus der Ferne und dem Alltag ist es schon noch ein Unterschied. Genau wie man als Chinese Angst haben koennte, in Europa staendig auf offener Strasse von Neonazis verpruegelt zu werden. -- 160.62.10.13 05:42, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Diese Probleme gibt es in China genau so, nur noch schlimmer. Aber nur selten wird ein Medienskandal draus. --El bes (Diskussion) 00:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich finde es auch unverantwortlich. Umgekehrt sind chinesische Mütter aber von deutschen und europäischen Säuglings- und Kindermilchprodukten begeistert, weil so etwas wie der Melaminskandal in Deutschland nicht vorkommen kann. Dafür haben wir hier andere Lebensmittelskandale: Unkrautvernichtungsmittel, Dioxin, Nematoden, Glykol, Gammelfleisch jtnaf. --Rôtkæppchen₆₈ 00:25, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Teile Chinas liegen in der selben Klimazone wie Mitteleuropa, weshalb es auch die selben Kulturpflanzen dort gibt. Aber angesichts der Umweltverschmutzung dort, den katastrophalen hygienischen Standards und der nicht-existenten Umweltgesetzgebung, sollten Lebensmittelimporte aus China eigentlich komplett verboten sein. Von den Sozialstandards gar nicht zu sprechen. Dass solche Lebensmittel überhaupt in der EU in den Handel kommen, zeugt davon, wie wenig die Bürokraten in Brüssel das Wohl der europäischen Verbraucher interessiert. --El bes (Diskussion) 00:20, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist aber immer noch besser als norovirenverseuchte Tiefkühlhimbeeren aus China, die vor zwei Jahren in Deutschland für eine Brechdurchfallepidemie mit über 10.000 Erkrankten gesorgt haben. --Rôtkæppchen₆₈ 00:11, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Himbeeren wachsen am liebsten auf sonnigen gerodeten Waldflächen. Dort brauchen sie auch keine Pestizide, Herbizide oder Fungizide. Dort wo ich derzeit wohne, in Siebenbürgen, gibt es an den Karpathenhängen hektargroße Himbeerfelder, die nach einem Kahlschlag ganz wild entstanden sind. Wenn man Probleme mit der Rutenkrankheit hat, ist der Standort einfach ungeeignet, weil zu feucht. Da sollte man lieber über eine Drainage nachdenken, als die Chemie-Keule auszupacken. Wer will denn sowas bitte noch essen? --El bes (Diskussion) 23:31, 8. Jun. 2014 (CEST)
- [26] --Hans Haase (有问题吗) 12:05, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Was hier nur indirekt gesagt wird: Die abgestorbenen Triebe und die, die es nicht schaffen werden entfernen, damit der aufprallende Regen nicht die Pilze auf gesunde Triebe transportiert. Bei Obst sollten Fruchtleichen (die Früchte des Vorjahres) ebenfalls entfernt werden, sonst kannst Du behandeln wie Du willst. Die Fungizide bekommst Du nur auf die Oberflächen, von denen sie abgewaschen werden und die Pilze aus dem Inneren der gestorben Triebe nachkommen. Diesbezüglich sollte ein Garten nicht versifft sein. Mit Motten und und anderen Insekten, die nicht bestäuben, sieht es ähnlich aus. Die überwintern in ungepflegten Ecken und Pflanzen wie sie im Wald vorkommen. Egal in welcher Hinsicht bei Schädlingen im Garten: Grundlage entfernen bringt mehr als jegliche Behandlung. Behandlung kostet teuer verkaufte Substanzen, aufräumen und zurückschneiden muss man in jedem Garten, der ein Garten bleiben soll. --Hans Haase (有问题吗) 08:22, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Jüngst in den Nachrichten: Chlorhuhn und jedes 5te Huhn im Supermarkt ist mit Salmonellen belastet. Siehe auch: Ammoniumhydroxid. --Hans Haase (有问题吗) 14:48, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das hat mit Himbeeren jetzt nicht mehr so viel zu tun ... Salmonellen dürften schon seit sehr langer Zeit auf Geflügelfleisch zu finden sein. Es scheint den meisten Menschen nicht geschadet zu haben. Rainer Z ... 15:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das Chlordioxid ist am Chlorhuhn nicht das wirklich gefährliche, sondern die Möglichkeit, Hygieneschlampereien bei Aufzucht und Schlachtung des Huhns damit zu kaschieren. Streng genommen ist auch gechlortes Freibadwasser karzinogen, was aber keine Badeanstalt davon abhält, ihr Wasser zu chloren, weil die Vorteile einfach überwiegen. --Rôtkæppchen₆₈ 01:52, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Jüngst in den Nachrichten: Chlorhuhn und jedes 5te Huhn im Supermarkt ist mit Salmonellen belastet. Siehe auch: Ammoniumhydroxid. --Hans Haase (有问题吗) 14:48, 9. Jun. 2014 (CEST)
Fussball-WM-Fanmeile in Berlin - kindergeeignet? (erl.)
Hallo
Hat jemand aus vorhergehenden Fussball-WMen Erfahrungen, ob man mit einer Gruppe von 20 Siebt- und Achtklässlern auf Klassenfahrt in Deutschland gefahrlos die Fanmeile in Berlin besuchen kann? Die Kinder sind sportbegeistert, aber ich weiss nicht, wie zivilisiert, es dort zu geht. Ich möchte nicht, dass ihr erster Eindruck besoffene, sich übergebende Fussball-Rowdies sind. Sprich geht es da einigermassen manierlich zu oder wird die Sau rausgelassen? Vielen Dank. Ich habe keine Angaben des Veranstalters finden können. Vielen herzlichen Dank! Catfisheye (Diskussion) 15:57, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Ich würde zunächst gar nicht mal an die rausgelassene SchweinIn denken, sondern einfach an das drangvoll enge Gedrängel und daran, ob in diesem die üblichen zwo Begleitpersonen ausreichen, um nachher mit einer Anzahl von Schülern wieder nach Hause zu fahren, die sich möglichst eng an die der Hinfahrer anlehnt, um möglichst wenig Ärger wegen verlorengegangener minderjähriger Schüler zu bekommen. Hummelhum (Diskussion) 16:07, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die Gröler und Kotzer wird es nicht nur auf der Fan-Meile geben, sondern überall. Leider.--87.162.252.141 19:41, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Auch ich rate von einem solchen Abenteuer dringend ab. Zum einen aus dem vorgenannten Grund - zwanzig Teenager im Gewühl nicht aus den Augen zu verlieren, ist eine Herkulesaufgabe. Und nach meiner persönlichen Erfahrung geht es immer dann, wenn eine mehr als einstellige Zahl von Fußballbegeisterten zusammenkommt, zwar immer außerordentlich zivilisiert zu, aber dabei rede ich von den Schattenseiten der Zivilisation. Das ist in meinen Augen definitiv nicht kindgerecht, auch nicht für sportbegeisterte Kinder im Alter von rund 14 Jahren. --Snevern 19:43, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Ich war schon ein paar mal auf Fanmeilen. Das schlimmste, was die Fans machen werden, ist wahrscheinlich schimpfen auf die eigenen und/oder gegnerischen Spieler. Schlägereien etc. bei Fanmeilen sind äußerst selten, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einer beliebigen ÖPNV-Fahrt eine Schlägerei beobachtet wahrscheinlich größer als auf der Fanmeile. Ich bin der Meinung, dass ca. 13-14 Jährige die Schimpfwörter eh alle kennen und davon nicht seelisch oder moralisch beeinträchtigt werden. Auch sollten sie wohl schon selbstständig genug sein, nachher einen Treffpunkt wiederzufinden, falls jemand im Gedränge "verloren" geht, natürlich vorausgesetzt dass erstens der Treffpunkt leicht zu finden ist und zweitens beim Treffpunkt selbst nicht auch ein großes Gedränge herrscht. Ich bin der Meinung, dass falls sich das mit einem Treffpunkt falls einer verloren geht gut organisieren lässt, sowas durchaus bei dieser Altersstufe schülergerecht ist, man sollte sich aber die Situation vor Ort jedenfalls anschauen bevor man entscheidet, mit den Schülern dort hinzugehen. --MrBurns (Diskussion) 20:35, 8. Jun. 2014 (CEST)
| Bitte den Hinweis zu Radschlägern beachten! --Dansker 20:52, 8. Jun. 2014 (CEST) |
- Nimm's mir bitte nicht übel, MrBurns, aber warst nicht du derjenige, der hier vor einiger Zeit mit Vehemenz gegen das generelle Verbot von Bengalfeuer in Stadien argumentiert hat? Ich weiß ja nicht, wie es Catfisheye geht, aber für mich würde das deine Einschätzung der Situation auf der Fanmeile in ein anderes Licht rücken. --Snevern 20:49, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Ich habe nicht "hier vor einiger Zeit mit Vehemenz gegen das generelle Verbot von Bengalfeuer in Stadien argumentiert". Ich habe nur auf Diskussion:Bengalisches Feuer argumentiert, dass die Meinung der aktiven Fanszene für den Artikel Bengalisches Feuer relevant ist und gegen einige unbelegete oder unneutrale Formulierungen im Artikel Bengalisches Feuer argumentiert. Auch stellt sich die Frage, ob meine Meinung zu Pyrotechnik in dem Fall überhaupt relevant ist, nach meiner Wahrnehmung wird bei Public Viewing eher selten Pyro gezündet. --MrBurns (Diskussion) 21:26, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Da habe ich mich wohl geirrt und bitte um Entschuldigung. --Snevern 21:50, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Diese fast 2 Jahre alte Diskussion habe ich ganz vergessen. Trotzdem halte ich das für diesen Abschnitt für eher nicht relevant. --MrBurns (Diskussion) 23:30, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Nein? Weil es nicht Berlin, sondern Köln war, wo "Bengalo- und Prügel-Irrsinn" die Veranstalter zwang, das Public Viewing einzuschränken? --Snevern 00:00, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es gibt bei jeder WM oder EM bundesweit sicher hunderte Public-Viewing-Veranstaltungen, also wenn bei einer etwas passiert, beweist das noch nicht, dass Public Viewing gefährlich ist. Man kann seine Schüler nicht zu 100% vor jedem Risiko schützen, ich denke das Risiko Zeuge oder gar Betroffener eines Zwischenfalls zu werden ist schon bei einer ÖPNV-Fahrt größer als bei so einer Public-Viewing-Veranstaltung. --MrBurns (Diskussion) 00:19, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Nein? Weil es nicht Berlin, sondern Köln war, wo "Bengalo- und Prügel-Irrsinn" die Veranstalter zwang, das Public Viewing einzuschränken? --Snevern 00:00, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Diese fast 2 Jahre alte Diskussion habe ich ganz vergessen. Trotzdem halte ich das für diesen Abschnitt für eher nicht relevant. --MrBurns (Diskussion) 23:30, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Da habe ich mich wohl geirrt und bitte um Entschuldigung. --Snevern 21:50, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Ich habe nicht "hier vor einiger Zeit mit Vehemenz gegen das generelle Verbot von Bengalfeuer in Stadien argumentiert". Ich habe nur auf Diskussion:Bengalisches Feuer argumentiert, dass die Meinung der aktiven Fanszene für den Artikel Bengalisches Feuer relevant ist und gegen einige unbelegete oder unneutrale Formulierungen im Artikel Bengalisches Feuer argumentiert. Auch stellt sich die Frage, ob meine Meinung zu Pyrotechnik in dem Fall überhaupt relevant ist, nach meiner Wahrnehmung wird bei Public Viewing eher selten Pyro gezündet. --MrBurns (Diskussion) 21:26, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Nimm's mir bitte nicht übel, MrBurns, aber warst nicht du derjenige, der hier vor einiger Zeit mit Vehemenz gegen das generelle Verbot von Bengalfeuer in Stadien argumentiert hat? Ich weiß ja nicht, wie es Catfisheye geht, aber für mich würde das deine Einschätzung der Situation auf der Fanmeile in ein anderes Licht rücken. --Snevern 20:49, 8. Jun. 2014 (CEST)
Vielen Dank Euch allen. Ich würde mir ja gern vorher die Fanmeile ansehen, reise aber erst gemeinsam mit der Gruppe aus dem nördlichen Nachbarland an. (Alle Schimpfworte dürften die Schüler noch nicht kennen, so fleissig sind sie beim Vokabelnlernen dann doch nicht. :) ) Hm, ich werde aufgrund Eurer Bedenken, die die meinigen bestätigen, mal schauen, ob ich stattdessen eine "Public-Viewing"-Möglichkeit in der Nähe der Unterkunft finde. Liebe Grüsse! Catfisheye (Diskussion) 21:14, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die ganzen Kommentare (von denen die allermeisten offensichtlich noch nie auf einer Fanmeile waren) haben ein völlig falsches Bild gezeichnet. Gib doch einfach mal "Fanmeile WM Berlin" bei der Google Bildersuche ein und verschaff dir einen Eindruck. Da sind keine "Gröler und Kotzer" sondern viele begeisterte ("normale") Leute die zusammen die Spiele verfolgen. Die Clichees, dass ein Fussballfan ein prügelnder und saufender Hooligan ist sind doch echt von vorvorgestern. Was man natürlich bedenken muss, sind die riesigen Menschenmengen. Da wird es sicher nicht einfach die Gruppe zusammenzuhalten, aber vor Ausschreitungen muss man mal gar keine Angst haben. --EdwinVanCleef (Diskussion) 23:02, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Mir würden einzelne Ausschreitungen, Prügeleien, Randalierer, abgebrannte Feuerwerkskörper, erhöhter Alkoholkonsum, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und der Einsatz von Pfefferspray durch Polizeibeamte ausreichen, um 20 mir anvertraute Teenager nicht dorthin mitzunehmen (B.Z. vom 8.7.2010).
- Aber du hast recht: Ich war noch nie auf einer Fanmeile. --Snevern 23:42, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Ich auch noch nicht, aber Nachkommen von mir. Die wollen da nie wieder hin. Gestört haben sie die gegnerischen Fangruppen, die, von Ordnungskräften mühsam auseinandergehalten, sich gegenseitig und laufend mit Parolen niederschrien. Eine Eskalation lag permanent in der Luft. Das Polizeiaufgebot und die Sicherheitsvorkehrungen/Absperrungen sind beim Public Viewing nicht mit denen in den Stadien zu vergleichen. Hier ist alles freier, es wird mehr gesoffen, die Reizschwelle zu Tätlichkeiten ist niedrig. Einzelne Schlägereien werden von der Polizei/Veranstaltern/ Medien schon gar nicht mehr registriert. Es ist schade, dass sich Menschen nicht kultiviert versammeln können und eine Minderheit von Saufköppen und potentiellen Randalierern das verhindert. Es ist leider nicht die Intelligenz die da säuft. --87.162.248.248 10:24, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Intelligenz säuft nicht, weil sie intelligent ist und es bleiben will. --Zerolevel (Diskussion) 15:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Du warst wohl noch nie auf einem Studentenfest. --MrBurns (Diskussion) 01:32, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Intelligenz säuft nicht, weil sie intelligent ist und es bleiben will. --Zerolevel (Diskussion) 15:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich auch noch nicht, aber Nachkommen von mir. Die wollen da nie wieder hin. Gestört haben sie die gegnerischen Fangruppen, die, von Ordnungskräften mühsam auseinandergehalten, sich gegenseitig und laufend mit Parolen niederschrien. Eine Eskalation lag permanent in der Luft. Das Polizeiaufgebot und die Sicherheitsvorkehrungen/Absperrungen sind beim Public Viewing nicht mit denen in den Stadien zu vergleichen. Hier ist alles freier, es wird mehr gesoffen, die Reizschwelle zu Tätlichkeiten ist niedrig. Einzelne Schlägereien werden von der Polizei/Veranstaltern/ Medien schon gar nicht mehr registriert. Es ist schade, dass sich Menschen nicht kultiviert versammeln können und eine Minderheit von Saufköppen und potentiellen Randalierern das verhindert. Es ist leider nicht die Intelligenz die da säuft. --87.162.248.248 10:24, 9. Jun. 2014 (CEST)
Fanmeile hin oder her: so eine Idee ist die beste Art, sich sein Grab zu schaufeln. Da reicht an sich das Wort Aufsichtspflicht. Ich war über 10 Jahre Ferienbetreuer von 6-13 Jährigen und da hat man so manches erlebt. Schon ein gut gefülltes Freibad verursacht da Bauchgrummeln. Entweder es haben alle eine klar identifizierbare und farbige Kappe auf und lassen diese auch auf oder man läßt es lieber. Es gibt Dinge, bei denen man sein Glück nicht herausfordern muß. Ich war in den Osterferien mit Familie (2 Kinder) bei sehr schönem Wetter in Berlin. Wenn ich mir vorstelle, zur WM, bei vielleicht Temperaturen wie jetzt und dazu 20 Halbwüchsige, no way. Es wird mit Sicherheit auch genügend Kneipen in der Nähe geben, wo man vorab was klar machen kann, auch unter Beachtung des Jugendschutzes. Das ist aber wesentlich beherrschbarer als die Fanmeile. Zudem wäre jede Jugenherberge mit dem Klammersack gepudert, wenn sie keinen großen TFT auftreibt. Die Jugendherberge am Wannsee hat einen ;-)--scif (Diskussion) 00:41, 10. Jun. 2014 (CEST)
Zugverbindung Danzig - Krakau
Guten Tag,
leider konnte ich online keine Informationen darüber finden, ob es gute tägliche Zugverbindungen zwischen Danzig und Krakau gibt. Hat irgendjemand Erfahrungen damit (Fahrtzeit, Preis)?
Vielen Dank! --92.74.77.18 17:43, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Na ja, die DB Fahrplanauskunft würde hier helfen. Wenn man sich darum bemühen würde. Die übersetzt sogar die deutschen Schreibweisen auf polnisch, und findet dann auch welche. An einem Werktag gibt es 4 direkte Verbindung.--Bobo11 (Diskussion) 17:58, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Jein. Die beiden Städte sind gerade mal nicht deutsch und man kann problemlos hier schauen: http://beta.rozklad-pkp.pl/de - auch auf Deutsch. "Danzig" kann man allerdings nicht buchstäblich eingeben, aber wenn jemand in Polen reisen will, wird er schon wissen, wie die Stadt heute heißt...
- Übrigens von mir mit polnisch null in etwa einer Minute gefunden... Hummelhum (Diskussion) 18:09, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Ich schrieb „Die übersetzt sogar die deutschen Schreibweisen auf polnisch“, klar spuckt die dann den Fahrplan mit den polnischen Stationsnamen aus. Das ist es ja, wenn die IP die erste Anlaufstelle für Fahrplan-Abfragen in Deutschland benutzt hätte, hätte sie eine Antwort gekriegt (Der Preis spukt allerdings auch die polnische Seite nicht aus). Sie hätte bei der Abfrage sogar die "falschen", sprich deutschen Ortsnamen benutzen können. --Bobo11 (Diskussion) 18:15, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Von Gdansk Glowny nach Wroclaw Glowny fahren in der Woche folgende Züge durch:
- 05:34 - 12:14
- 12:48 - 19:51
- 16:19 - 23:02
- 22:56 - 06:17
- Die Züge sind vergleichbar mit IC in Deutschland, sie sind reservierungspflichtig. --Pölkky 18:23, 8. Jun. 2014 (CEST) Korrektur: die Züge fahren nicht täglich.
- Diese Antwort ist ja perfekt, passt aber nicht zur Frage. Krakau heißt Krakow und nicht Wroclaw, was das Nordwestliche ehem. Breslau ist.--87.162.252.141 19:26, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die Auskunft ist aber nur noch eine Woche gültig, denn am 14. Juni ist in Polen Fahrplanwechsel. --Bobo11 (Diskussion) 18:35, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Von Gdansk Glowny nach Wroclaw Glowny fahren in der Woche folgende Züge durch:
- Ich schrieb „Die übersetzt sogar die deutschen Schreibweisen auf polnisch“, klar spuckt die dann den Fahrplan mit den polnischen Stationsnamen aus. Das ist es ja, wenn die IP die erste Anlaufstelle für Fahrplan-Abfragen in Deutschland benutzt hätte, hätte sie eine Antwort gekriegt (Der Preis spukt allerdings auch die polnische Seite nicht aus). Sie hätte bei der Abfrage sogar die "falschen", sprich deutschen Ortsnamen benutzen können. --Bobo11 (Diskussion) 18:15, 8. Jun. 2014 (CEST)
Alkoholfreies Bier
Guten Abend, ich hätte mal eine Frage zum Thema Alkoholfreies Bier. Darf mir mein Arbeitgeber den Genuss von Alkoholfreien Bier während der Arbeitszeit verbieten? Ich weiß das Alkoholfreies Bier u.U. bis zu 0,5% Alkohol enthalten kann, aber ist das nicht vernachlässigbar und zählt das Getränk zu den Alkoholischen Getränken? Der Artikel zum Thema ist leider nicht sehr aussagekräftig. (Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, dürfen in D. Personen unter 18 Jahren Alkoholfreies Bier erwerben?). Danke für eure Antworten; Gruß -- 92.229.53.157 19:36, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn sie mindestens 16 sind, sicherlich, man darf nämlich ab 16 auch normales Bier trinken.
- Grüße, --Altſprachenfreund: Selbſtwerbung • Plapperrunde • Senfabgabe 19:39, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Aber nicht an jedem Arbeitsplatz.
- Alkoholfreies Bier hat unter einem Volumenprozent Alkohol und gilt daher nach ständiger Rechtsprechung nicht als alkoholhaltiges Getränk - manche Fruchtsäfte haben einen ähnlichen Alkoholgehalt. Ich sehe daher keine rechtliche Handhabe, den Genuss von alkoholfreiem Bier am Arbeitsplatz zu verbieten, wenn andere alkoholfreie Getränke erlaubt sind. Es ist nur schwerer zu kontrollieren und könnte "echte" Biertrinker zur Annahme verleiten, auch sie dürften - aber das ist in meinen Augen kein rechtlich relevanter Gesichtspunkt.
- Achja, zur Zusatzfrage: Ja, auch Jugendliche unter 18, sogar Jugendliche unter 16, dürfen aus dem gleichen Grunde alkoholfreies Bier erwerben. --Snevern 19:49, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Du musst hier aufpassen, das du nicht unterschiedliche Sachen vermischt. Der Arbeitgeber kann dir unter gewissen Umständen das Trinken am Arbeitsplatz grundsätzlich verbieten (also auch kein Wasser). Sondern kann von dir verlangen, dass du zum trinken einen anderen Raum aufsuchst, das rein aus dem Gesundheitsschutz-Aspekt. Und er kann auch verlangen das du da keine mitgebrachten Getränke trinkst (Dann ist er aber im Gegenzug dazu verpflichtet dir welche zum Selbstkostenpreis oder umsonst abzugeben).
- Zum Restalkohol. Es gibt etliche Berufe wo vom Gesetzgeber Nüchternheit verlangt wird (Fahrer im öffentlicher Verkehr z.B.), also die 0,1‰ Grenze gilt. Hier ist er sicher berechtigt dich auf das Problem mit Restalkohol hinzuweisen, und eben notfalls einzugreifen.
- Er ist unter gewissen Umständen also durchaus berechtigt, dich vom Trinken -auch von alkoholfreiem Bier- am Arbeitsplatz abzuhalten. Denn er hat unter Umständen sogar die Pflicht es dir zu verbieten. Im Pausenraum sieht die Sache natürlich schon bisschen anders aus. Dann ist es in der Regel aber auch keine Arbeitszeit. Die Verwechslungsgefahr ist natürlich ein Aspekt der hier durchaus zu einem berechtigten Verbot führen kann. Man denke nur an den Busfahrer der hinter den Steuerrad eine Bierflasche in der Hand hält.--Bobo11 (Diskussion) 20:13, 8. Jun. 2014 (CEST)
- (BK)Dass bei gewissen Tätigkeiten Essen, Trinken und Rauchen generell verboten sind, hat andere Gründe. Beim Umgang mit Giften z.B. könnte man mit Essen, Trinken und Rauchen unbeabsichtigterweise Gift aufnehmen. Bei wieder anderen Tätigkeiten könnten Spuren von Essen, Trinken und Rauchen die Produktion empfindlich stören, z.B. Reinraumfertigung. Ein Alkoholverbot während der Arbeitszeit, also auch in Kantine und Pausenraum, ist ebenfalls unter Umständen sinnvoll. Nichtalkoholische Getränke, also auch Fruchtsäfte oder alkoholfreies Bier kann der Arbeitgeber aber wahrscheinlich nicht verbieten. Das Rauchen am Arbeitsplatz oder in öffentlichen oder gewerblich genutzten Räumen ist ja mittlerweile fast überall gesetzlich oder hausrechtlich verboten. --Rôtkæppchen₆₈ 20:31, 8. Jun. 2014 (CEST)
- @Bobo11: Aufgrund deiner Einrückung fühle ich mich angesprochen und wage zu widersprechen:
- Die Fälle, in denen in der Thermoskanne nicht nur Kaffee, sondern auch hochprozentiges zu finden ist, sind Legion. Und heutzutage muss man einfach damit rechnen, dass sich in einer Bierflasche auch mal alkoholfreies Bier befindet. Ich selbst hätte früher auf Arbeit meine Pausengetränke liebend gerne aus dem Flachmann getrunken, weil er sich so schön der Hosentasche anpasst - hätte mehr reingepasst, hätte ich das zweifellos auch getan.
- Man muss stets die Umstände des jeweiligen Einzelfalls prüfen, aber von Ausnahmefällen abgesehen (z.B. Arbeitsplatz in einer Entziehungsklinik) müsste ein generelles Verbot von alkoholfreiem Bier (bei gleichzeitiger Zulassung anderer alkoholfreier Getränke - das schrieb ich bereits) schon sehr gut begründet sein, um einer gerichtlichen Überprüfung standzuhalten. --Snevern 20:43, 8. Jun. 2014 (CEST)
- @Snevern er fragte aber ausdrücklich während der Arbeitszeit. Und da lautet die Antwort nun mal leider JA unter bestimmten Umständen ist so ein Verbot zulässig. Denn es ist in gewissen Arbeitsbereichen aus Arbeitsschutzgründen grundsätzlich das Trinken zu verbieten. Auch Kundenkontakt wäre so ein Problemfeld. Auch hier ist ein Verbot von gewissen Getränkearten - eben z.b. alkoholfreies Bier wegen Verwechslungsgefahr mit echtem Bier usw.- durchaus als zulässig zu betrachten. Im Pausenraum, also ohne Kundenkontakt usw., da sieht die Sache schon ganz anders aus. Da muss der Arbeitgeber verdammt gute Argumente haben, das gute Beispiel der Entziehungsklinik hast du schon genannt. Denn das liefe ja auf ein generelles Verbot hinaus, und da hast du Recht, dieses allgemeine Verbot wäre vermutlich angreifbar. Kurzfassung am Arbeitsplatz währen der Arbeitszeit kann dir der Arbeitgeber das alkoholfreie Bier recht einfach verbieten, im Pausenraum während einer Pause nicht. Ich kenne einen Arbeitgeber wo die Belegschaft prinzipiell nur seine Getränke trinken darf, das dafür umsonst, die alkoholfreien sogar unlimitiert (Und erstaunlicher Weise reklamiert da keiner von der Gewerkschaft, obwohl das ein einschneidendes Verbot wäre). Man kann da als Arbeitnehmervertreter durchaus für die Belegschaft was raus holen, wenn der Arbeitgeber auf so ein Verbot einer gewissen Getränkeart besteht. @92.229.53.157 Frag dich einfach ob dein alkoholfrei Bier wirklich ein Grund ist das Arbeitsklima (und nach Möglichkeit sogar den Arbeitsplatz) auf das Spiel zu setzen. --Bobo11 (Diskussion) 22:00, 8. Jun. 2014 (CEST)
- IRL würde ich fragen: "Nuschel ich?" Hier muss ich fragen: Drücke ich mich so unklar aus? Ich rede doch die ganze Zeit schon ausschließlich von Arbeitsplätzen, an denen alkoholfreie Getränke prinzipiell erlaubt sind, und nicht von solchen, an denen man überhaupt nichts trinken darf. Ich weiß leider nicht, wie ich es noch deutlicher sagen kann. --Snevern 22:09, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Und ich sag es dir gern auch ganz deutlich. Eine Bank kann ihren Mitarbeitern einfach SO verbieten, das z.B. in der Schalterhalle etwas getrunken wird (egal was). Wenn der Arbeitgeber der Wunsch äusser währedn der Arbeitsziet kein alkoholfries Bier zu trinken, und dies nicht beachtet wird. Hat er die Möglichkeit das trinken am Arbeitsplaz allgemein zu verbieten, und alle die Mitarbeiter zum trinken in den Pausenraum zu schicken. Das ist sein Recht, und er wird auch Gründe finden die vor Gericht standhalten (und sei das jetzt Kaffeeflecken auf dem Papier). Logischerweise muss er dann den Arbeitnehmer erlauben sich kurz vom Arbeitsplatzz zu entfernen damit sie etwas trinken können. Oder er darf auch Bestimmern das generell in den Arbeiträumen nur Wasser getrunken werden darf (das er z.B. im Wasserspender zur Verfügung stellt). Dagegen wist du Mühe haben vor Gericht anzukommen, wenn das Verbot/Anweisung nur den Arbeitsplatz und nicht den Pausenraum betrifft. Man muss hier einfach aufpassen was man sich verdirbt wenn der Arbeitgeber so eine "Verbot" ausspricht, und wünscht das am Arbeitsplatz während der Arbeitszeit kein alkoholfreies Bier getrunken wird. --Bobo11 (Diskussion) 22:22, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Ich geb's auf. Du hast Recht und ich meine Ruhe. --Snevern 22:29, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Alkoholfreies Bier ist nach allgemeiner Rechtsauffassung in DE kein alkoholisches Getränk, es darf Kindern, wie Malzbier oder Milch auch, verkauft werden. Dass am Arbeitsplatz das Trinken (und Essen) generell untersagt werden kann, weil dabei Gesundheitsgefahren verbunden sind, ist in vielen Bereichen der DE-Industrie Usus und meistens von den Berufsgenossenschaften auch vorgeschrieben. Darüber sollte es keine Diskussion geben. Dafür müssen dann entsprechend geschützte Pausenräume geschaffen werden. Das gilt auch für die Arbeitgeber, die darüberhinaus in nicht Gesundheitsgefährdeten Arbeitsstätten aus optischen oder Image-Gründen oder auch willkürlich nicht zulassen wollen, wie die genannte Schweizer Beispielbank, dass am Arbeitsplatz weder gegessen und/ oder getrunken wird. Zwischenzeitlich ist in den Arbeitsstättenverordnungen sogar festgehalten, dass kein Mitarbeiter am Arbeitsplatz essen oder Trinken muss, wenn er es nicht will. Entsprechende Pausenräume sind da gefordert. Hier in der Wikipedia ist es einfacher, da darf beim Schwadronieren jeder so viel trinken, bis er sich nur noch im Kreis dreht und das Fänli schwenkt. Prost --87.162.252.141 00:05, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hier in der Auskunft dürfen ja sogar Fragen beantwortet werden, die so nie gestellt worden sind... --93.137.122.174 07:42, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Alkoholfreies Bier ist nach allgemeiner Rechtsauffassung in DE kein alkoholisches Getränk, es darf Kindern, wie Malzbier oder Milch auch, verkauft werden. Dass am Arbeitsplatz das Trinken (und Essen) generell untersagt werden kann, weil dabei Gesundheitsgefahren verbunden sind, ist in vielen Bereichen der DE-Industrie Usus und meistens von den Berufsgenossenschaften auch vorgeschrieben. Darüber sollte es keine Diskussion geben. Dafür müssen dann entsprechend geschützte Pausenräume geschaffen werden. Das gilt auch für die Arbeitgeber, die darüberhinaus in nicht Gesundheitsgefährdeten Arbeitsstätten aus optischen oder Image-Gründen oder auch willkürlich nicht zulassen wollen, wie die genannte Schweizer Beispielbank, dass am Arbeitsplatz weder gegessen und/ oder getrunken wird. Zwischenzeitlich ist in den Arbeitsstättenverordnungen sogar festgehalten, dass kein Mitarbeiter am Arbeitsplatz essen oder Trinken muss, wenn er es nicht will. Entsprechende Pausenräume sind da gefordert. Hier in der Wikipedia ist es einfacher, da darf beim Schwadronieren jeder so viel trinken, bis er sich nur noch im Kreis dreht und das Fänli schwenkt. Prost --87.162.252.141 00:05, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich geb's auf. Du hast Recht und ich meine Ruhe. --Snevern 22:29, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Und ich sag es dir gern auch ganz deutlich. Eine Bank kann ihren Mitarbeitern einfach SO verbieten, das z.B. in der Schalterhalle etwas getrunken wird (egal was). Wenn der Arbeitgeber der Wunsch äusser währedn der Arbeitsziet kein alkoholfries Bier zu trinken, und dies nicht beachtet wird. Hat er die Möglichkeit das trinken am Arbeitsplaz allgemein zu verbieten, und alle die Mitarbeiter zum trinken in den Pausenraum zu schicken. Das ist sein Recht, und er wird auch Gründe finden die vor Gericht standhalten (und sei das jetzt Kaffeeflecken auf dem Papier). Logischerweise muss er dann den Arbeitnehmer erlauben sich kurz vom Arbeitsplatzz zu entfernen damit sie etwas trinken können. Oder er darf auch Bestimmern das generell in den Arbeiträumen nur Wasser getrunken werden darf (das er z.B. im Wasserspender zur Verfügung stellt). Dagegen wist du Mühe haben vor Gericht anzukommen, wenn das Verbot/Anweisung nur den Arbeitsplatz und nicht den Pausenraum betrifft. Man muss hier einfach aufpassen was man sich verdirbt wenn der Arbeitgeber so eine "Verbot" ausspricht, und wünscht das am Arbeitsplatz während der Arbeitszeit kein alkoholfreies Bier getrunken wird. --Bobo11 (Diskussion) 22:22, 8. Jun. 2014 (CEST)
- IRL würde ich fragen: "Nuschel ich?" Hier muss ich fragen: Drücke ich mich so unklar aus? Ich rede doch die ganze Zeit schon ausschließlich von Arbeitsplätzen, an denen alkoholfreie Getränke prinzipiell erlaubt sind, und nicht von solchen, an denen man überhaupt nichts trinken darf. Ich weiß leider nicht, wie ich es noch deutlicher sagen kann. --Snevern 22:09, 8. Jun. 2014 (CEST)
- @Snevern er fragte aber ausdrücklich während der Arbeitszeit. Und da lautet die Antwort nun mal leider JA unter bestimmten Umständen ist so ein Verbot zulässig. Denn es ist in gewissen Arbeitsbereichen aus Arbeitsschutzgründen grundsätzlich das Trinken zu verbieten. Auch Kundenkontakt wäre so ein Problemfeld. Auch hier ist ein Verbot von gewissen Getränkearten - eben z.b. alkoholfreies Bier wegen Verwechslungsgefahr mit echtem Bier usw.- durchaus als zulässig zu betrachten. Im Pausenraum, also ohne Kundenkontakt usw., da sieht die Sache schon ganz anders aus. Da muss der Arbeitgeber verdammt gute Argumente haben, das gute Beispiel der Entziehungsklinik hast du schon genannt. Denn das liefe ja auf ein generelles Verbot hinaus, und da hast du Recht, dieses allgemeine Verbot wäre vermutlich angreifbar. Kurzfassung am Arbeitsplatz währen der Arbeitszeit kann dir der Arbeitgeber das alkoholfreie Bier recht einfach verbieten, im Pausenraum während einer Pause nicht. Ich kenne einen Arbeitgeber wo die Belegschaft prinzipiell nur seine Getränke trinken darf, das dafür umsonst, die alkoholfreien sogar unlimitiert (Und erstaunlicher Weise reklamiert da keiner von der Gewerkschaft, obwohl das ein einschneidendes Verbot wäre). Man kann da als Arbeitnehmervertreter durchaus für die Belegschaft was raus holen, wenn der Arbeitgeber auf so ein Verbot einer gewissen Getränkeart besteht. @92.229.53.157 Frag dich einfach ob dein alkoholfrei Bier wirklich ein Grund ist das Arbeitsklima (und nach Möglichkeit sogar den Arbeitsplatz) auf das Spiel zu setzen. --Bobo11 (Diskussion) 22:00, 8. Jun. 2014 (CEST)
Ups, hier hat sich ja einiges getan ... Besten Dank für eure Informationen! Also wenn ich das richtig zusammenfasse darf ich an meinem Arbeitsplatz Alkoholfreies Bier trinken. Mein Arbeitgeber gestattet der Belegschaft jederzeit Getränke zu sich zu nehmen - eine Einschränkung gibt es bei uns nicht. Es herrscht nur Alkoholverbot. Um ganz sicher zu gehen, die Frage werde ich an den zuständigen Betriebsrat oder Sicherheitsbeauftragten weitergeben. Dank euch und Gruß -- 78.52.170.207 11:06, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Schön, dass wenigstens der Fragesteller die Antworten richtig verstanden hat - genau darauf kommt es ja schließlich an. --Snevern 15:05, 9. Jun. 2014 (CEST)
Wiesenblumen in einem Kornfeld


Hallo zusammen, mir ist heute wieder besonders aufgefallen, dass in vielen der hiesigen Felder eine wahre Pracht von Mohn und Kornblumen blüht. Auffällig ist, dass diese Blumen nur auf zwei bis drei Metren neben dem Straßenrand vorhanden sind. Weiter im Feld gibt es nur ganz vereinzelt mal einen Farbklecks. Schaffen die Bauern das mit Herbiziden und wenn ja, warum hören sie dann auf den letzten Metern damit auf? Ansähen werden sie die Blumen ja wohl eher nicht, nur damit unsereins gute Laune bekommt. Grüße an-d (Diskussion) 22:09, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Verkehrswege kosten nicht nur Landschaftsfläche und zerschneiden Biotope, sie sind auch ihrerseits als Biotope bekannt und geschätzt: An Verkehrswegen (Straßenränder, Bahndämme etc.) findet sich ein Vielzahl von Arten, die anderswo kaum noch vorkommen. Bunte Wiesen gibt es fast gar nicht mehr, und auch zwei Sorten von Blumen am Straßenrand ist ja nicht gerade viel. --Snevern 22:27, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die Wahrscheinlichkeit eines Eintrages von Fremdsamen ist am Feldrand am höchsten. Da die Samen in der Regel nur eine begrenzte Flugreichweite haben (Für „über die Strasse“ reicht es aber in der Regel). Auch das übersehen von Blumen beim abernten ist nun mal am Rand am höchsten. Endsprechen finden sich dann auch in der Nähe wo sie ihm Vorjahr standen, auch deren Samen für dieses Jahr im Boden. Beides Zusammen ergibt eben Folgendes; Wenn irgend wo "ungewollte" Blumen in der intensiven Landwirtschaftlich überleben können, dann ist es am Rand des Feldes. --Bobo11 (Diskussion) 22:41, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Am Feldrand ist auch die Dichte der gesäten Weizensamen geringer. Würde der hochtechnisierte Bauer mit seiner Gerätschaft auch den Feldrand dicht besäen wollen, würde die Hälfte der Körner auf der Straße landen. So haben die Mohnblumen dort (am letzten Meter) noch eine kleine Chance, zwischen den weniger dichten Weizenhalmen noch etwas Licht zu bekommen und so zu wachsen. --El bes (Diskussion) 22:50, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Der Punkt hab ich prompt vergessen. Der kommt natürlich noch dazu. Der Rand kriegt gern auch weniger Dünger, Pestizid usw. ab. Somit ist es eben auch der Feldrand der Platz, wo der Fremdling auch eher die Chance hat, sich gegen über dem gewollten Saatgut durchzusetzen. Es sind mehrere kleine Sachen die sich eben summieren.--Bobo11 (Diskussion) 23:35, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Am Feldrand ist auch die Dichte der gesäten Weizensamen geringer. Würde der hochtechnisierte Bauer mit seiner Gerätschaft auch den Feldrand dicht besäen wollen, würde die Hälfte der Körner auf der Straße landen. So haben die Mohnblumen dort (am letzten Meter) noch eine kleine Chance, zwischen den weniger dichten Weizenhalmen noch etwas Licht zu bekommen und so zu wachsen. --El bes (Diskussion) 22:50, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Die Wahrscheinlichkeit eines Eintrages von Fremdsamen ist am Feldrand am höchsten. Da die Samen in der Regel nur eine begrenzte Flugreichweite haben (Für „über die Strasse“ reicht es aber in der Regel). Auch das übersehen von Blumen beim abernten ist nun mal am Rand am höchsten. Endsprechen finden sich dann auch in der Nähe wo sie ihm Vorjahr standen, auch deren Samen für dieses Jahr im Boden. Beides Zusammen ergibt eben Folgendes; Wenn irgend wo "ungewollte" Blumen in der intensiven Landwirtschaftlich überleben können, dann ist es am Rand des Feldes. --Bobo11 (Diskussion) 22:41, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Vielleicht läuft da auch noch das Ackerrandstreifen-Programm. --Optimum (Diskussion) 23:10, 8. Jun. 2014 (CEST)
- @El bes : Warum soll am Ackerrand die Dichte der, z.B., Weizensaat geringer sein? Gruß --Mikered (Diskussion) 09:34, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Probier es mal selber aus und streu Salz möglichst gleichmäßig auf eine Spielkarte ohne etwas über den Rand zu streuen. Dann wird die Korndichte am Rand geringer sein. Das könnte man ggf. sogar statistisch durch rechnen. --88.68.87.252 11:46, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Von Landwirtschaft habt ihr nicht viel Ahnung. Oder? Getreide und auch Mais werden mithilfe von Drillmaschinen gesät. Da ist es absolut egal, ob ich mich am Feldrand oder in der Feldmitte befinde... Gruß --Mikered (Diskussion) 12:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Schau dir folgendes Werbevideo von so einem Drillsaatmaschinenhersteller an. Da siehst du genau, dass er es nicht hinbekommt, bis exakt zur asphaltierten Straße zu säen. Natürlich könnte er sein Fahrtmuster um 90 Grad drehen und zum Schluss eine gerade Linie entlang der Straße machen. Dann hat er aber die freien Ecken einfach auf der anderen Seite, beim Feldweg. --El bes (Diskussion) 13:06, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Von Landwirtschaft habt ihr nicht viel Ahnung. Oder? Getreide und auch Mais werden mithilfe von Drillmaschinen gesät. Da ist es absolut egal, ob ich mich am Feldrand oder in der Feldmitte befinde... Gruß --Mikered (Diskussion) 12:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Probier es mal selber aus und streu Salz möglichst gleichmäßig auf eine Spielkarte ohne etwas über den Rand zu streuen. Dann wird die Korndichte am Rand geringer sein. Das könnte man ggf. sogar statistisch durch rechnen. --88.68.87.252 11:46, 9. Jun. 2014 (CEST)
- @El bes : Warum soll am Ackerrand die Dichte der, z.B., Weizensaat geringer sein? Gruß --Mikered (Diskussion) 09:34, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Am Ackerrand ist vor allem durch die vielen Wendevorgänge der Maschinen der Boden stärker verdichtet. Schon allein deshalb wächst da bevorzugt das widerstandsfähige, natürliche Zeug, nicht die hochgezüchteten Ackerfrüchte, die man intensiv pflegen muss, damit sie gedeihen. -- Janka (Diskussion) 13:47, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es wird ja nicht nur eingesät - das geht noch ziemlich akurat. Es wird auch mit Dünger und mit Giftstoffen gespritzt, und das geht eben nicht akurat. Bei fast allen Feldern findet man deswegen zum Rand hin kleiner werdende Pflanzen. Zwischen dem Feld/Acker und einer daneben verlaufenden Straße befindet sich sehr oft ein schmaler Streifen, der nicht bewirtschaftet wird, und genau diese Streifen bilden (zusammen mit Böschungen, Bahndämmen und ähnlichen Nischen) die wertvollen Biotope, in denen manche Pflanzen und Tiere noch zu finden sind, die es andernorts praktisch nicht mehr gibt. --Snevern 15:03, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Danke für die Antworten! Rechts noch zwei Fotos von den Feldrändern. VG an-d (Diskussion) 16:57, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Schön, das ihr allen einem Praktiker erklären wollt, wie Weizen, Gerste, Hafer usw. gesät werden. Und ja, man sät das sogenannte "Vorgewende" noch einmal extra ein. Genauso verhält es sich bei der mineralischen Düngung und auch beim Pflanzenschutz. Die Bilder zeigen ein Ackerrandstreifenprogramm. Gruß --Mikered (Diskussion) 19:14, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Du hältst an-d für einen Praktiker? Ohne ihm zu nahetreten zu wollen: ich nicht. Und von säen war doch nur am Rande die Rede (kein Wortspiel beabsichtigt). Aber falls du Praktiker sein solltest, erkläre doch mal bitte einem Laien, wie du es schaffst, dass bei dir auch die Pflanzen am Feldrand genauso groß werden wie die in der Mitte. Ich würde das dann meinen Nachbarn erklären, die allesamt Landwirte sind und es allesamt nicht hinkriegen. --Snevern 19:29, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Nun, vielleicht sollten deine Nachbarn eine landwirtschaftliche Ausbildung machen. Bei mir klappt das immer. Kann dir gerne bei Gelegenheit ein paar Bilder schicken. Gruß --Mikered (Diskussion) 19:32, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Bilder wären genehm, danke! Mais? --Snevern 19:40, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, kann ich die Tage gerne machen, falls ich es vergesse Ping mich an. Ja, Mais geht auch. Aber nicht mehr heute Abend. Gruß --Mikered (Diskussion) 19:54, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich schick dir dann gerne auch Bilder vom stümperhaft angebauten Mais in meiner Nachbarschaft. Allerdings isser noch nicht hoch genug dafür; vielleicht ein weiteres Zeichen für die fehlende Kompetenz der hiesigen Landwirte? --Snevern 20:01, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, keine Ahnung. Kann ja auch am Boden liegen. Weiss ja nicht was für Böden ihr habt und welche Anbaumethoden. Aber mein Mais steht gut. Gruß --Mikered (Diskussion) 20:11, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich schick dir dann gerne auch Bilder vom stümperhaft angebauten Mais in meiner Nachbarschaft. Allerdings isser noch nicht hoch genug dafür; vielleicht ein weiteres Zeichen für die fehlende Kompetenz der hiesigen Landwirte? --Snevern 20:01, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, kann ich die Tage gerne machen, falls ich es vergesse Ping mich an. Ja, Mais geht auch. Aber nicht mehr heute Abend. Gruß --Mikered (Diskussion) 19:54, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Bilder wären genehm, danke! Mais? --Snevern 19:40, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Schön, das ihr allen einem Praktiker erklären wollt, wie Weizen, Gerste, Hafer usw. gesät werden. Und ja, man sät das sogenannte "Vorgewende" noch einmal extra ein. Genauso verhält es sich bei der mineralischen Düngung und auch beim Pflanzenschutz. Die Bilder zeigen ein Ackerrandstreifenprogramm. Gruß --Mikered (Diskussion) 19:14, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Danke für die Antworten! Rechts noch zwei Fotos von den Feldrändern. VG an-d (Diskussion) 16:57, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es wird ja nicht nur eingesät - das geht noch ziemlich akurat. Es wird auch mit Dünger und mit Giftstoffen gespritzt, und das geht eben nicht akurat. Bei fast allen Feldern findet man deswegen zum Rand hin kleiner werdende Pflanzen. Zwischen dem Feld/Acker und einer daneben verlaufenden Straße befindet sich sehr oft ein schmaler Streifen, der nicht bewirtschaftet wird, und genau diese Streifen bilden (zusammen mit Böschungen, Bahndämmen und ähnlichen Nischen) die wertvollen Biotope, in denen manche Pflanzen und Tiere noch zu finden sind, die es andernorts praktisch nicht mehr gibt. --Snevern 15:03, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Am Ackerrand ist vor allem durch die vielen Wendevorgänge der Maschinen der Boden stärker verdichtet. Schon allein deshalb wächst da bevorzugt das widerstandsfähige, natürliche Zeug, nicht die hochgezüchteten Ackerfrüchte, die man intensiv pflegen muss, damit sie gedeihen. -- Janka (Diskussion) 13:47, 9. Jun. 2014 (CEST)
- @an-d beim zweiten Bild ist eindeutig zu erkennen, dass da nachgeholfen wurde. So schön gleichmässig in zwei Streifen mit zwei Blumenarten ohne wirkliche Durchmischung, das ist nicht auf natürlichem Weg hin zubekommen. Da muss jemand bewusst Samen aus gebracht haben. --Bobo11 (Diskussion) 19:27, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Beim zweiten Bild ist es offensichtlich, dass der Klatschmohn maschinell gesät wurde: Die innere Kontur des gleichmäßig breiten Klatschmohnstreifens verläuft parallel zum Feldrand. Die Kontur des Kornblumenstreifens ist nicht ganz so parallel, aber auch hier ist maschinelle Aussaat zu vermuten. --Rôtkæppchen₆₈ 19:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist dann der in Ackerrandstreifen erwähnte Blühstreifen.--Optimum (Diskussion) 20:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Bin Praktiker: Drillmaschine kann bis zum Rand säen. Ja. Problem: das schon vorhanden Unkraut und der fehlende Kalk/Dünger etc. Nächstes Problem: schwankendes Spritzgestänge: am Ende eines solchen meist 12 Meter langen Auslegers (ab Shcleppermitte gerechnet)hat man eine hohe Geshcwindigkeit wenn das Gestänge vor und zurückpendelt. Dadurch kommt es stellenweise zu deutlichen Minderdosierungen. Ackerrandstreifenprogramm ist erwähnt worden. Manchmal auch einfach fehlendes knowhow beim Pflügen. --blonder1984 (Diskussion) 21:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Danke euch allen! Ich bin natürlich nicht vom Fach - vom Ackerrandstreifenprogramm hatte ich noch nie etwas gehört. Das ist also Absicht, aber nicht damit Blumenliebhaber und die dort lebenden Insekten etwas davon haben, sondern weil der Landwirt dafür Geld (einen Ausgleich) bekommt. Es haben also alle (Steuerzahler mal außen vor) etwas davon. Reicht mir. --an-d (Diskussion) 22:04, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Bin Praktiker: Drillmaschine kann bis zum Rand säen. Ja. Problem: das schon vorhanden Unkraut und der fehlende Kalk/Dünger etc. Nächstes Problem: schwankendes Spritzgestänge: am Ende eines solchen meist 12 Meter langen Auslegers (ab Shcleppermitte gerechnet)hat man eine hohe Geshcwindigkeit wenn das Gestänge vor und zurückpendelt. Dadurch kommt es stellenweise zu deutlichen Minderdosierungen. Ackerrandstreifenprogramm ist erwähnt worden. Manchmal auch einfach fehlendes knowhow beim Pflügen. --blonder1984 (Diskussion) 21:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist dann der in Ackerrandstreifen erwähnte Blühstreifen.--Optimum (Diskussion) 20:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Beim zweiten Bild ist es offensichtlich, dass der Klatschmohn maschinell gesät wurde: Die innere Kontur des gleichmäßig breiten Klatschmohnstreifens verläuft parallel zum Feldrand. Die Kontur des Kornblumenstreifens ist nicht ganz so parallel, aber auch hier ist maschinelle Aussaat zu vermuten. --Rôtkæppchen₆₈ 19:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
9. Juni 2014
Fußball-WM - Kadergröße / gelbe Karten
GUten späten Abend. Folgende - wohl theoretische, aber immerhin mögliche - Frage: Falls nach dem zweiten Gruppenspiel der WM 14 Spieler einer Mannschaft wegen gelber Karten gesperrt sind; welche (außer den 9 übrigen, und somit einem Torwart als Feldspieler [oder?]) und wie viele Spieler dürfen dann im dritten Gruppenspiel für das betroffene Team antreten? --84.173.45.173 00:15, 9. Jun. 2014 (CEST)
- So lange mehr als 7 Leute auf dem Platz stehen, koennen sie theoretisch noch antreten. 11 ist lediglich die moegliche Hoechstzahl von Spielern einer Mannschaft. Ansonsten ist es eine gute Frage, auf die ich auch keine genaue Antwort geben kann. Eventuell braucht es in so einem Fall einen Entscheid am Gruenen Tisch. Beispielsweise eine automatische Wertung zu Gunsten des Gegners (doof nur, wenn automatisch mit 3:0 gewertet wuerde, der Gegner aber vier Tore zum Weiterkommen gebraucht haette). -- 160.62.10.13 05:09, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es ist aber ausgeschlossen, dass eine Mannschaft von einem Nichtantritt profitiert. Wenn eine Mannschaft z.B. mit einer 0:3 Niederlage noch weiterkommen würde, bei 0:4 aber nicht, dann hilft der als 0:3 gewertete Nichtantritt nichts, da jede mannschaft, die eine Nichtantritt hat, in der Tabelle einen Stern bekommt und automatisch hinter alle punktegleichen Mannschaften gereiht wird, unabhängig vom Torverhältnis. Blöd für den Gegner ist es also nur, wenn er höher als 3:0 gewinnen müsste, um vor einer anderen Mannschaft zu sein als dem Gegner. Also z.B. für Argentinien wärs 1978 wohl blöd gewesen, wenn Peru einfach nicht angetreten wäre, weil sie mindestens ein 4:0 brauchten, um vor Brasilien zu sein und ins Finale zu kommen. Peru ist aber angetreten und hat 0:6 verloren... --MrBurns (Diskussion) 14:53, 10. Jun. 2014 (CEST)
Nikäum
Was ist ein Nikäum? –ðuerýzo ?! SOS 02:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es gab zwar zwei davon, aber meistens ist genau das Erste Konzil von Nicäa damit gemeint und nicht unbedingt das zweite. --Rôtkæppchen₆₈ 03:08, 9. Jun. 2014 (CEST)
Jemand sollte sich mal die Weiterleitungen ansehen: Nicänum leitet auf Nicäno-Konstantinopolitanum und Nizänum auf Bekenntnis von Nicäa, obwohl beide ja eigentlich doch wohl nur unterschiedliche Schreibungen desselben Dings sein sollten (und sowohl die Schreibung mit n (Nizänum) als auch ohne n (Nizäum) sind offenbar möglich). Also, genau genommen geht es nicht um die Konzilien von Nicäa, sondern die dort beschlossenen Glaubensbekenntnisse. Wegen z und k, der Unterschied erklärt sich durch eine nachklassische Lautverschiebung (Palatalisierung), vgl. Caeasr, der sich selbst noch "Kaesar" (daher auch Kaiser) ausgesprochen hat, während später daraus die Aussprache "Zäsar" wurde; ebenso hat man also die Stadt des Konzils früher "Nikäa" ausgesprochen, später dann "Nizäa". --Proofreader (Diskussion) 04:06, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das mit der Aussprache ist eher der Unterschied zwischen Latein und Griechisch als zwischen Neuzeit/Antike, das Griechische hat die Romanische Palatalisierung nicht mitgemacht. —★PοωερZDiskussion 04:12, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Nikä(n)um/Niza(n)um hat allerdings die lateinische Endung; ich kann kein Griechisch, aber da müsste es ja vermutlich "Nikaion" heißen, oder? (oder halt das Äquivalent in griechischen Buchstaben). Aber ansonsten hast du natürlich recht, das k ist bei den Griechen geblieben. Wäre mal interessant, wo der Fragesteller diese Schreibung "Nikäum" aufgeschnappt hat, denn ungewöhnlich ist sie ja mit diesem alten lateinischen Lautstand allemal. Wenn er danach gegoogelt hat, findet er ganze 5 Treffer, da kann man schon auf die Idee kommen, sich bei unserer Auskunft schlau zu machen. --Proofreader (Diskussion) 10:28, 9. Jun. 2014 (CEST)
Die Weiterleitungen Nicänum/Nizänum sind allerdings seltsam. Sollte diese Unterscheidung zwischen c und z sprachlich und historisch tatsächlich irgendeinen Sinn haben, wäre da m.E. zumindest eine BKL Typ 2 angebracht. --Anna (Diskussion) 07:23, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Wow, danke für die fundierten Antworten. @Proofreader: Das Wort „Nikäum“ wurde von der KI beim Scrabble gelegt. Das Wort kannte ich nicht, sodass ich es nachschlug, allerdings ohne Erfolg. Wahrscheinlich wäre eine Weiterleitung der Begriffe Nikäum, Nikänum, Nicänum, Nizänum und weitere Varianten auf die von Anna vorgeschlagene BKL sinnvoll? –ðuerýzo ?! SOS 23:07, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich kenn's eigentlich nur mit "n". Die Version ohne "n" hätte ich jetzt für einen Tippfehler gehalten. Wenn, dann ist das m.E. eine seltene und ungebräuchliche Nebenform. Google findet da gerade mal sechs oder sieben Treffer. --Anna (Diskussion) 00:57, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Google Book Search hat mich jedenfalls ziemlich zielstrebig und schlüssig zu meiner obigen Antwort gebracht. --Rôtkæppchen₆₈ 01:08, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Nun ja, wenn Du Dir die Google-Books-Treffer anguckst, dann sind das - so jedenfalls wird's mir angezeigt - ungefähr 20, davon die allermeisten Fehlidentifikationen aus Frakturschrift-Büchern. Und die Handvoll regulärer Google-Treffer schließen schon diesen Thread hier mit ein und zwei Scrabble-Suchseiten, die auf den Duden führen zu einem dort nichtexistenten Begriff.
- Aber wie schon gesagt, ich schließe ja nicht aus, dass es diese Form gibt, aber ich halte sie für eine seltene und ungebräuchliche Nebenform. --Anna (Diskussion) 08:23, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Google Book Search hat mich jedenfalls ziemlich zielstrebig und schlüssig zu meiner obigen Antwort gebracht. --Rôtkæppchen₆₈ 01:08, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ich kenn's eigentlich nur mit "n". Die Version ohne "n" hätte ich jetzt für einen Tippfehler gehalten. Wenn, dann ist das m.E. eine seltene und ungebräuchliche Nebenform. Google findet da gerade mal sechs oder sieben Treffer. --Anna (Diskussion) 00:57, 10. Jun. 2014 (CEST)
Orientalische Mentalität?
Ich pflege seit einiger Zeit geschäftliche Kontakte zu einer deutschen Firma. Dort ist ein Mitarbeiter, dessen Eltern aus dem Iran stammen, und mit dem sich die Zusammenarbeit zuweilen schwierig gestaltet. Es gibt zu verschiedenen Themen immer wieder Gespräche, und es scheint alles klar zu sein, aber wenn es dann soweit ist, passiert gar nichts. Ich habe das in der Form noch nicht erlebt. Ist das vielleicht Mentalitätssache? Hängt es mit der Kultur zusammen? Kennt sich jemand aus? --46.114.55.183 09:20, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Anscheinend habt Ihr ein Kommunikationsproblem. Woher das kommt kann und sollte man nicht pauschal beantworten - erst recht nicht anhand einer mutmaßlichen Mentalität. Sprich das Problem gegenüber den beteiligten Personen offen an und schlage bspw. vor, die wichtigsten Punkte grundsätzlich schriftlich möglichst präzise zu fixieren - ohne dabei die Herkunft des Mitarbeiters zu thematisieren. --88.68.87.252 11:56, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es gibt ungefähr so viele Iraner wie Deutsche, jeweils so im 80-Millionen-Bereich. Wenn du NICHT davon ausgehst, dass die 80 Millionen Deutschen alle zusammen nur eine Mentalität haben (oder wenn du gar die Erfahrung gemacht hast, dass schon 2 oder 3 oder 10 von diesen Deutschen im Beruf unterschiedlich funktionieren), warum solltest du dann von einer Einheitsmentalität der 80 Millionen Iraner ausgehen?
- Die Antwort ist bekannt, sie ist einfach (und sie kam implizit neulich hier beim Thema "Was ist Rassismus oder Diskriminierung?" vor): Weil sie (von dir aus gesehen) weiter weg sind.
- Aber willst du wirklich deine Seele an eine derartige Antwort hängen?
- Wäre der Mann selbständig, könnte man vielleicht noch vermuten, dass er seinen Beruf zum Teil anders versteht als in Deutschland üblich. Nun soll er aber Arbeitnehmer in einer Firma sein - kann er da einfach ganz anders arbeiten als die Geschäftspolitik seines Chefs es vorsieht?
- Zu eurer Kommunikation gehören (mindestens) zwei. Woher wissen wir, dass es an ihm liegt? Rein theoretisch: Vielleicht hat der dortige Chef den Eindruck, DEINE Vorschläge seien inkonkludent und wenigversprechend, will es sich aber mit deiner Firma nicht verscherzen, und hat deshalb dekretiert "Da setzen wir den Kollegen Hāfez ran, der quatscht lange mit dem Typen, bleibt dabei immer höflich (anderes bekanntes Vorurteil gegen Iraner!) und wimmelt ihn dabei so freundlich ab, dass der Typ es immer erst hinterher merkt". Hummelhum (Diskussion) 16:24, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Und woher wissen wir, daß 46.114.55.183 der deutschen Firma mit dem iranischen Arbeitnehmer Vorschläge gemacht hat? --93.137.122.174 18:25, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Unterschiedliche Wertesysteme haben übrigens auch nicht unbedingt etwas mit der Entfernung zu tun, sondern eher damit, wie viele Menschen mit ihren landestypischen Mentalitäten wohin migrieren. Neuseeland ist weit entfernt, dennoch findet man dort diverse uns wohlbekannte (durch das britische Empire exportierte) Eigenschaften häufiger an, als beispielsweise im viel näher gelegenen Albanien. Und was die konkrete Frage zum Iran angeht: wer leugnet, daß dort tendenziell ein gänzlich anderes Schamgefühl („Haya“) vorherrscht, als in Deutschland, demonstriert damit einfach nur seine Ahnungslosigkeit. --93.137.122.174 20:19, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, dass es in der Frage um Schamgefühl ging, war auch mir entgangen. Hummelhum (Diskussion) 21:42, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es handelt sich dabei immerhin um einen Aspekt dessen, was der Fragesteller als Überschrift seiner Frage gewählt hat. Ich schrieb ja nicht, daß es in diesem konkreten Fall am Schamgefühl liegen muss – nur, daß es gerade in diesem Punkt eben ziemlich deutliche Unterschiede zwischen den typischen Mentalitäten der beiden angesprochenen Länder durchaus gibt. --93.137.166.94 09:34, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, dass es in der Frage um Schamgefühl ging, war auch mir entgangen. Hummelhum (Diskussion) 21:42, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Bei den mir aus dem Arbeitsleben bekannten (europaeischen) Iranern kann ich nicht bestaetigen, dass sie so lethargisch und vergesslich waeren, wie es in dem oben beschriebenen Fall zu sein scheint. Iran hat ja durchaus eine Menge faehiger Ingenieure, IT-Experten etc. hervorgebracht. Nun kann man nicht ausschliessen, dass manchmal eine Mischung aus Persoenlichkeit und interkulturellen Differenzen im Spiel ist, ich wuerde aber davon ausgehen, dass es sich vorrangig um ein individuelles und nicht um ein kulturelles Problem handelt. -- 160.62.10.13 03:44, 10. Jun. 2014 (CEST)
Wird jede ausgebrannte Raketenstufe als Satellit bezeichnet?
Ein (künstlicher) Satellit ist per Wikipedia-Definition der Raumfahrt ein künstlicher Raumflugkörper, der einen Himmelskörper – einen Planeten oder Mond – auf einer elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahn zur Erfüllung wissenschaftlicher,kommerzieller oder militärischer Zwecke umkreist.
Wenn nun nur ein Bakensender auf einer Raketenstufe fest montiert wurde, und für eine begrenzte Zeit, da der Sender Batterie betrieben wurde und nach 14 Tagen nicht mehr sendet, wird danach nun diese Raketenstufe, die als Weltraumschrott nun die Erde umkreist, dann als Satellit bezeichnet ? Hier steht die ausgebrannte Raketenstufe als Satellit IDEFIX CU2.
--HF Schule (Diskussion) 09:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
Dass ein künstlicher Satellit bestimmte Zwecke erfüllen muss, entspricht zwar dem, was man sich normalereise unter einem Satelliten vorstellt, aber ich halte das in dem Fall für eine zu enge Definition. "Satellit" ist von der Wortherkunft her erstmal alles, was die Erde "begleitet" und unser Artikel Weltraummüll steht auch nicht ohne Grund in der Kategorie "Künstlicher Satellit". Sonst müsste man sich zur Beschreibung mit dem etwas abstrakten Begriff "Objekt" behelfen. In der englischen WP heißt es übrigens, Satelliten seien künstliche Objekte, die "intentionally placed into orbit" (kann man übersetzen als "die bewusst/zielgerichtet in eine Umlaufbahn verbracht wurden"), da kann man sich streiten, ob man das so zu einem Stück Weltraummüll sagen kann, aber ein paar Absätze weiter wird Weltraummüll definitiv mit einbezogen. Übrigens ist die Unterscheidung künstliches vs. natürliches Objekt auch nicht immer trivial, rein von der Beobachtung her - so hat man schon künstliche Raketenstufen für natürliche Himmelskörper gehalten und umgekehrt. --Proofreader (Diskussion) 10:14, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Danke für die ausführliche Erklärung, als Weltraumschrott bezeichnet man nichtfunktionale künstliche Objekte in einer Umlaufbahn um die Erde. So sieht es zumindest unser Lehrer. --HF Schule (Diskussion) 10:19, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Der Sprachgebrauch geht hier leicht auseinander. Einerseits wird "Satellit" zur Bezeichnung der Nutzlast beim Raketenstart verwendet, in Abgrenzung zu den anderen Objekten, die dabei ebenfalls in die Erdumlaufbahn gelangen. Andererseits sind alle Objekte in der Erdumlaufbahn Satelliten, unabhänging von Größe, Zweck und Funktionszustand. Alle künstliche Objekte, die die Erde umkreisen, erhalten eine internationale COSPAR-Bezeichnung und eine amerikanische Satellite Catalog Number. Letzteres zeigt schon, dass es nicht abwegig ist, Raketenoberstufen als "Satellit" zu bezeichnen, auch wenn die Funktionsdauer wesentlich kürzer als bei den "richtigen" Satelliten ist. Ob da noch ein Sender an der Rakete klebt ist dabei belanglos. Die Definition des Lehrers von "Weltraumschrott" halte ich für zu eng gefasst. Weltraumschrott kreist nicht nur um die Erde, wie auch das von Proofreader verlinkte Beispiel J002E3 zeigt. Auch einige inzwischen längst funktionslose Raumsonden dürften sich in einer Sonnenumlaufbahn befinden. --Asdert (Diskussion) 14:57, 10. Jun. 2014 (CEST)
Bitte ganz schnell antworten: Haben Pfingsmontag die Supermärkte in Frankreich auf?
Speziell in Saargemünd oder Bitsch. Ich brauche dringend Brot und ein Babyschwimmbad. Benutzer:Rolz-reus (nicht signierter Beitrag von 84.166.150.220 (Diskussion) 09:30, 9. Jun. 2014 (CEST))
- Eher nein, der Pfingstmontag ist ein offizieller Feiertag in Frankreich. Feiertage in Frankreich --Bobo11 (Diskussion) 10:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die meisten haben zu, etwa der und der. Hier eine frankreichweite Liste für Carrefour. Aber sag mal, das kannst du doch auch? Ansonsten: Brot gibt's am Bahnhof und an der Tanke, und beim Planschbecken ist ggf. Improvisationstalent gefragt (Wäschbütt...). Grüße Dumbox (Diskussion) 10:15, 9. Jun. 2014 (CEST)
Markierungen auf Start- und Landebahn
Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Markierungen nichts mit Luftfahrt zu tun haben? --87.163.79.157 10:16, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das würde ich auch so sehen. Finden da auch Strassenrennen statt? --Bobo11 (Diskussion) 10:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das geht ja weiter rechts noch weiter. Sieht so aus, als stünde da am Rand der Fahrbahn ein Hindernis/Fahrzeug und als wolle man mit der Markierung davor warnen. Wenn eine Maschine von rechts kommend startet, macht die erste Markierung am Beginn der Startbahn auch für Flugzeuge Sinn nach dem Motto: Haltet euch rechts, damit ihr nicht mit dem Ding zusammenstoßt. Aber hinter dem Hindernis wird ja keine beschleunigte Maschine wieder den Tick nach links machen, das macht so höchstens für Pistenwartungfahrzeuge u.ä. Sinn. --Proofreader (Diskussion) 10:39, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Obwohl - eine Maschine kann ja auch von links starten, hm. --Proofreader (Diskussion) 10:41, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Der ehemalige Bundeswehrflugplatz Mendig heißt nun Gewerbe- und Testgelände Mendig und ja, es finden dort Autorennen (24h) statt. Der ADAC mischt da auch mit und eine Rennschule gibt es da auch. Es gibt einen kleinen und großen Rundkurs die teilweise markiert sind.--87.162.248.248 10:48, 9. Jun. 2014 (CEST)
Danke an Alle fürs Mitraten und insbesondere an 87.162.248.248 fürs Erklären.
Hitparaden(miß)erfolge der ESC-Gewinner
Gibt es eine Übersicht darüber, wie erfolgreich/erfolglos die Gewinner des Eurovision-Song-Contest in den deutschen Charts waren? Anlaß der Frage ist das (von mir erwartet) maue Abschneiden von Frau Wurst in den deutschen Charts. Eine Woche Platz 5, jetzt in der dritten Woche in den unteren Regionen. Gab es Gewinner, die noch schlechter abgeschnitten haben? --Geometretos (Diskussion) 10:28, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hier die komplette Siegerliste. Nach Anklicken des Titels bekommst du Infos zu den Charts. "Running Scared", 2011, Platz 33 in D. Weiter habe ich nicht gesucht, aber da kommen noch bedeutendere Misserfolge. Grüße Dumbox (Diskussion) 11:00, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Speziell in den 1990ern waren viele ESC-Sieger überhaupt nicht in den deutschen Charts vertreten. Conchita Wurst zählt da mit Platz 5 insgesamt gesehen schon zu den erfolgreicheren. --Euroklaus (Diskussion) 11:07, 9. Jun. 2014 (CEST)
Danke, ich habe das lange nicht mehr registriert, aber Frau Wurst konnte man ja (leider) kaum ausweichen. Offenbar sind die meisten der Gewinner echte Flops. Ich frage mich, wie das kommt, insbesondere wenn die Sieger durch Zuschauervoten bestimmt werden.--Geometretos (Diskussion) 14:12, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Sieger wurden exakt zur Hälfte durch Zuschauervoten bestimmt, die andere Hälfte durch sog. Expertenjurys. Ob das in allen Fällen wirkliche Experten sind, wage ich zu bezweifeln. Da sind oft Musiker dabei, die sich ihre Musik nicht einmal selbst schreiben. Zum anderen hat das ESC-Publikum einen ganz anderen Geschmack und ein ganz anderes Altersprofil als der typische Tonkonservenkäufer. --Rôtkæppchen₆₈ 14:25, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Nicht zu vergessen, dass der ESC-Gewinner ja nicht allein durch die das deutsche Telefonvoting bestimmt wird, sondern auch ein paar Menschen außerhalb Deutschlands Stimmrecht haben. -- southpark 14:30, 9. Jun. 2014 (CEST)
Was uns zu folgender, sehr interessanter Frage bringt: Die Jury kauft die Gewinner-CD ja nachher nicht - zumindest nicht mal ansatzweise in der Menge, in der die Zuschauermasse sie kauft. Man sollte doch denken, dass je mehr die Zuschauer ein Lied toll finden, es auch mehr Leute kaufen. Dadurch, dass jetzt auch eine Jury mitabstimmt, die eben nicht massenhafte Käufer dieser Lieder umfasst, ist das Endergebnis nicht mehr mit der Meinung der Anrufer identisch und es gewinnt und verkauft sich ggf. ein ganz anderer Titel - einer, den die Anrufer ggf. gar nicht mal so furchtbar gut fanden.
Warum stimmt zusätzlich zu den Zuschauerstimmen immer noch eine Jury ab? Das ist doch dumm. --88.130.91.32 15:13, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Jury wurde wieder eingeführt, nachdem reine Zuschauervoten in mehreren Ländern zu massiven Betrugsversuchen geführt haben. --Rôtkæppchen₆₈ 15:34, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ob eine Jury es besser macht, wage ich mal zu bezweifeln. --88.130.91.32 16:05, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Solange die nicht beim ESC Qatar zum Auto des Jahres wählen… *scnr* --Rôtkæppchen₆₈ 17:20, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ob eine Jury es besser macht, wage ich mal zu bezweifeln. --88.130.91.32 16:05, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ich behaupte mal, der ESC ist längst komplett eine Welt für sich. Da treten ja nicht die besten oder erfolgreichsten Popmusiker der Länder gegeneinander an, sondern es sind meistens Künstler aus der Retorte mit einem Song à la ESC. Dann amüsieren und/oder fremdschämen sich ein, zwei Abende lang ein paar Millionen Leute und geben halt eventuell ne Stimme ab. Warum sollte das großen Einfluss auf die Charts haben? Das Ganze ist Kasperltheater mit Musik. Rainer Z ... 15:49, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es geht beim ESC auch gar nicht um Popmusiker oder erfolgreich. Es geht um das beste neue Lied, und nicht um denjenigen, der das Lied vorträgt. Nur wenige ESC-Beiträge sind im Plattenladen erfolgreich oder schaffen es ins Mainstreamradio. Lena Meyer-Landrut wurde aber auch schon vor ihrer ESC-Teilnahme viel im ö.-r. Radio gespielt. --Rôtkæppchen₆₈ 15:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Genau, es ist der Eurovision SONG Contest. 1999 hat es übrigens kein einziger Wettbewerbstitel, auch nicht der deutsche Beitrag, in die deutschen Charts geschafft. Und die Situation, dass Interpreten schon vor ihrem ESC-Auftritt international bekannt waren, ist auch historisch eher selten - damals war es Cliff Richard, vor einigen Jahren Patricia Kaas. Selbst ABBA und Celine Dion waren vor dem ESC unbeschriebene Blätter. Um auf Herrn Wurst zurückzukommen: Nicht-Deutsche erreichten sehr selten die Top 10 der deutschen Charts, insofern kann man ihn durchaus als erfolgreich bezeichnen, auch wenn die zweitplatzierten Niederländer sogar noch mehr Einheiten verkauften. --Euroklaus (Diskussion) 16:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es geht beim ESC auch gar nicht um Popmusiker oder erfolgreich. Es geht um das beste neue Lied, und nicht um denjenigen, der das Lied vorträgt. Nur wenige ESC-Beiträge sind im Plattenladen erfolgreich oder schaffen es ins Mainstreamradio. Lena Meyer-Landrut wurde aber auch schon vor ihrer ESC-Teilnahme viel im ö.-r. Radio gespielt. --Rôtkæppchen₆₈ 15:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Der diesjährige deutsche Beitrag Is It Right schaffte es immerhin auf Platz 4 in Deutschland. Ich wage mal eine These, aktuell sind Platz 1,2,3 und 4 der Deutschen Charts deutschsprachig, vieleicht wurde da einfach ein Trend verpasst, das man entweder original in der Landessprache singt, oder international erfolgreich ist wie Bakermat (NED).Oliver S.Y. (Diskussion) 18:04, 9. Jun. 2014 (CEST)
"Nicht-Deutsche erreichten sehr selten die Top 10 der deutschen Charts"?!? Dann muss gerade der Tag sein, an dem die Hölle zufriert, im Moment ist sogar die Hälfte der Top Ten (Kiesza (Kanada), Clean Bandit (England), George Ezra (England), Calvin Harris (Schottland), Bakermat (Niederlande)) nicht aus Deutschand! Und ich wette, diese komischen US-Amerikaner schaffen es auch nie in unsere Top Ten! --Eike (Diskussion) 09:34, 10. Jun. 2014 (CEST)- Er meint wohl nichtdeutsche ESC-Gewinner. Rückblick letzte 10 Jahre: Ell & Nikki kamen 2012 nur auf Platz 33, Dima Bilan auf Platz 52, [[Marija Šerifović] keine Chartplatzierung, Elena Paparizou Platz 37 - also wirklich die Frage, was man als bedeutsam empfindet, TOP 3,5,10,20,25,50 oder 100.Oliver S.Y. (Diskussion) 09:49, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ah! Danke, es ist mir ein Licht aufgegangen. --Eike (Diskussion) 09:54, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Er meint wohl nichtdeutsche ESC-Gewinner. Rückblick letzte 10 Jahre: Ell & Nikki kamen 2012 nur auf Platz 33, Dima Bilan auf Platz 52, [[Marija Šerifović] keine Chartplatzierung, Elena Paparizou Platz 37 - also wirklich die Frage, was man als bedeutsam empfindet, TOP 3,5,10,20,25,50 oder 100.Oliver S.Y. (Diskussion) 09:49, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Vielleicht sollte man, um den ESC zu verstehen, auch darauf schauen, wer so hinter den Kulissen des ESC mitverdient. Mir fallen da (bezogen auf Deutschland) als Lektürevorschlag zum Beispiel die Artikel Ralph Siegel und Stefan Raab ein. Wäre ja interessant, mal zu untersuchen, ob es in anderen Ländern auch Produzenten mit einem gewissen Schwerpunkt auf diesem Geschäftsfeld gibt. --87.151.175.97 18:39, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Der NDR hat die Zusammenarbeit mit Brainpool, Raabs Firma, weitgehend eingestellt und Ralph Siegel hat dieses Jahr das Lied für San Marino geschrieben, das auf dem drittletzten Platz landete. --Rôtkæppchen₆₈ 18:51, 9. Jun. 2014 (CEST)
Die Erklärung für den Sieg von Conchita Wurst beim ESC ist ganz einfach und hat nichts mit der Musik zu tun: Seit Jahren ist der ESC ein ganz großes Ding in der Schwulen- und Lesbenszene, und die haben eben für C. Wurst gestimmt. --Sunks (Diskussion) 00:05, 11. Jun. 2014 (CEST)
Person gesucht, Schreibfehler in der Geburtsurkunde
berühmte Persönlichkeit in Brasilien geboren mit Schreibfehler des Vorbnamens in der Geburtsurkunde (nicht signierter Beitrag von 217.255.7.62 (Diskussion) 11:59, 9. Jun. 2014 (CEST))
- Da musste ich nur die Artikel zu mir bekannten beruehmten Brasilianern suchen, und schau, der zweite war's schon. Tipp 1: Oscar Niemeyer wars nicht. Tipp 2: Welches Sportereignis beginnt in ein paar Tagen, und welche Leute waren mal ganz gut in dieser Sportart? (Tipp: Wimbledon ist's nicht). -- 160.62.10.13 12:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
Künstler und Kreative mit bipolarer Störung
Hallo. Es gibt Menschen denen nachgesagt wird, dass ihre Kreativität an ihre bipolare Störung gekoppelt war (http://www.dgbs.de/kreativitaet.html , http://bipolar-shg-nt.jimdo.com/ber%C3%BChmte-bipolare/ , vgl. Bipolare_Störung#Kreativit.C3.A4t). Ich bin auf der Suche nach berühmten Persönlichkeiten die bewusst in Zeiten mögliche Medikationen auf diese verzichteten, um ihre Kreativität zu erhalten. Am besten mit zuverlässiger Quellenangabe (Zitat). Wer hat sich beispielsweise einer Lithiumtherapie verweigert mit der Begründung des "starving artist" en:Starving artist. Es dürften auch Beispiele für andere, ähnliche psychische Störungen sein. Vielen Dank, --WissensDürster (Diskussion) 12:52, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Vielmehr solltest Du die Unfähigkeit unserer Wirtschaft erkennen, die geistigen Potentiale dieser Leute nicht zu Geld machen zu können. Das klappt selbst in Hollywood.[27][28]. In den sein dern 1950ern immerwieder neu geschriebenen Handbuch der psychologischen Krankheiten könnte man meinen, stehen jedes Jahr mehr „Erfindungen“. --Hans Haase (有问题吗) 13:06, 9. Jun. 2014 (CEST)
- hört! hört! *kicher* zusätzlich scheint es mir so, dass die Psychiater die guten alten Diagnosen/Therapien (z. B. Folie à deux/sich allein beschäftigen, Kontakte zu Menschen reduzieren) „vergessen“... *grmpf* --Heimschützenzentrum (?) 13:14, 9. Jun. 2014 (CEST)
- ADHS ist nicht bipolare Störung. Zweiteres ist eine sehr ernste Krankheit, die das eigene Leben und vor allem das der unmittelbaren Mitmenschen (Eltern, Partner, Wohnungskollegen, Arbeitskollegen, etc.) zur Hölle machen kann. Wer mit dieser Krankheit eindeutig diagnostiziert ist und eine medikamentöse Therapie ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt absetzt, handelt grob fahrlässig, sich und seiner Umwelt gegenüber. In der manischen Phase können auch ganz leicht andere Menschen physisch zu Schaden kommen, da die Person dann überhaupt kein Risikobewusstsein mehr hat (Autounfall, etc.) --El bes (Diskussion) 13:16, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Zum Thema bipolare Störungen bei Künstlern gibt es das Buch Celebrities von Borwin Bandelow; eine Antwort auf Deine Frage ist aber meiner Erinnerung nach nicht in dem Buch enthalten. -- Aspiriniks (Diskussion) 13:26, 9. Jun. 2014 (CEST)
- ich hab vor einiger Zeit hier was dazu geschrieben, beachte da insbesondere den angegebene Aufsatz von Abigail Cheever (Prozac Americans) samt Verweis auf Walker Percy, eine halbwegs "berühmte Persönlichkeit die bewusst in Zeiten mögliche Medikationen auf diese verzichtete" (siehe The Coming Crisis in Psychiatry und The Thanatos Syndrome). Don DeLillos Roman White Noise behandelt ebenfalls diese Thematik, ist aber wesentlich spaßiger. --Edith Wahr (Diskussion) 16:48, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Zum Thema bipolare Störungen bei Künstlern gibt es das Buch Celebrities von Borwin Bandelow; eine Antwort auf Deine Frage ist aber meiner Erinnerung nach nicht in dem Buch enthalten. -- Aspiriniks (Diskussion) 13:26, 9. Jun. 2014 (CEST)
- ADHS ist nicht bipolare Störung. Zweiteres ist eine sehr ernste Krankheit, die das eigene Leben und vor allem das der unmittelbaren Mitmenschen (Eltern, Partner, Wohnungskollegen, Arbeitskollegen, etc.) zur Hölle machen kann. Wer mit dieser Krankheit eindeutig diagnostiziert ist und eine medikamentöse Therapie ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt absetzt, handelt grob fahrlässig, sich und seiner Umwelt gegenüber. In der manischen Phase können auch ganz leicht andere Menschen physisch zu Schaden kommen, da die Person dann überhaupt kein Risikobewusstsein mehr hat (Autounfall, etc.) --El bes (Diskussion) 13:16, 9. Jun. 2014 (CEST)
- hört! hört! *kicher* zusätzlich scheint es mir so, dass die Psychiater die guten alten Diagnosen/Therapien (z. B. Folie à deux/sich allein beschäftigen, Kontakte zu Menschen reduzieren) „vergessen“... *grmpf* --Heimschützenzentrum (?) 13:14, 9. Jun. 2014 (CEST)
Google-Suche: wie viele der Ergebnisse werden tatsächlich angeschaut?
Wenn ich etwas google, dann schaue ich mir sehr häufig nur die ersten paar Ergebnisse an, auf die zweite Seite schaue ich fast nie. Das wird ja wahrscheinlich den meisten so gehen. Da kam bei mir die Frage auf, wieviele der ersten paar Ergebnisse im Schnitt wirklich angeschaut werden. Weiß das jemand? Dafür gibt es ja sicherlich auch Untersuchungen, möglicherweise nicht nur bezogen auf Google, sondern generell bei Suchvorgängen im Internet. Unter welchen Begriffen findet man denn etwas dazu bei Google? --79.240.235.152 14:17, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Google prüft, ob Du oder andere einen Suchtreffer anklickst. Der Klick ist eine Weiterleitung auf das Ziel, darüber wird geprüft. Deine Suchbegriffe sind bereits vorab aus indexierten (erfassten) Seiten zusammengestellt, sonst wäre Google nicht so schnell. Das Abfallprodukt davon: Die Suchvorschläge, gegen die viele klagen wollen. Google's Durchbruch lag in der Sortierung nach Relevanz: Da niemand auf Schrottseiten verlinkt, werden die URLs als Wort sortiert, wieviele davon auf ein Ziel zeigen. Die Folge davon war, dass viel Mülldomains angelegt wurden, um auf selbstpropagierte Ziele zu verlinken. --Hans Haase (有问题吗) 14:44, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Danke für die Hinweise, aber das hat doch nichts mit der Frage zu tun, oder? --79.240.235.152 15:09, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist eine Antwort von Hans Haase - das sagt doch schon alles. --88.130.91.32 15:15, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, das ist richtig. Auf Seite 2 schauen nur noch wenige Prozent der Suchenden. SEO befasst sich damit, Suchergebnisse für die zu optimierende Seite auf die erste Ergebnisseite, möglichst weit oben, zu hieven. Als ich mich vor zwei Jahren viel damit beschäftigt habe, sind mir etliche Zahlen begegnet, die waren aber sehr veränderlich. Wie auch immer, in Literatur bzw. Werbung zum Thema SEO wirst Du die Zahlen finden. Gr., redNoise (Diskussion) 15:29, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist eine Antwort von Hans Haase - das sagt doch schon alles. --88.130.91.32 15:15, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Danke für die Hinweise, aber das hat doch nichts mit der Frage zu tun, oder? --79.240.235.152 15:09, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Bitte (ggf. für sich selbst) definieren: soll "Ergebnisse angeschaut" meinen: a) die vierzeilige Zusammenfassung des Treffers, bestehend aus Titel, URL, und zwei Zeilen Snippets überflogen (und ggf. als vorab nicht weiter verfolgenswert eingestuft)? Oder soll "Ergebnisse angeschaut" meinen: b) nach Ansicht dieser Mini-Zusammenfassung den dezugehörigen Link angeklickt? --Neitram ✉ 17:45, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Das macht einerseits zwar einen Unterschied, aber die Kernaussage bleibt andererseits bestehen: Seite zwei der Suchergebnisse ist eigentlich egal. Weder wird einem Link gefolgt, noch die vierzeilige Zusammenfassung beachtet - die Seite existiert schlichtweg nicht. Bei intensivem Suchen, gar Recherchieren ist das anders, aber die Aufmerksamkeit der meisten Suchenden geht nicht mal bis zum Ende der ersten Seite. Da kann man ja jetzt mal anfangen, über Googles Macht nachzudenken... Gr., redNoise (Diskussion) 21:36, 10. Jun. 2014 (CEST)
Tageszeit
Hallo! Jetzt über Pfingsten fällt mir wieder bei der Hitze auf, daß nicht nur die Spanier mit ihrer Siesta eine Pause einlegen, sondern auch hierzulande eine besondere Zeit üblich ist. Gibt es international für die Zeit zwischen dem Verzehr der Mittagsmahlzeit und der Wiederaufnahme der Arbeit (mit und ohne Schlaf) Begriffe und Traditionen? Denke da an heiße Regionen wie Afrika, Indien oder Südamerika, aber auch in Griechenland oder Arabien ackerte man ja nicht bei Sonnenhöchststand.Oliver S.Y. (Diskussion) 14:39, 9. Jun. 2014 (CEST)
- → Siesta --Hans Haase (有问题吗) 14:45, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ein Hinweis ohne Quellen ergibt sich im arabischen Artikel. lasse ihn Dir von Google übersetzen: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9 --Hans Haase (有问题吗) 15:56, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Eine neuere, in die bisherige Lebenskultur eingreifende Variante ist der Umgang mit dem Ozonloch und der verstärkten Belastung durch UV-Strahlung in Südchile, Neuseeland und Australien. Nicht nur Kampagnen wie "SLIP, SLOP, SLAP" (en.wp hat einen Artikel) in Australien scheinen nötig. Die Pharmazeutische Zeitung weiß auch: "So lassen Eltern in der im südlichen Chile gelegenen Stadt Punta Arenas ihre Kinder zwischen 10 und 15 Uhr im Hause, und das Fußballtraining ist vom Nachmittag auf den frühen Abend verlegt worden. In Neuseeland werden die Schulkinder dazu angehalten, Hüte zu tragen und ihr Schulbrot im Schatten der Bäume zu essen. Die australische Regierung bringt Warnungen heraus, wenn die von der Sonne ausgehenden UV-Strahlen besonders hohe Werte erklimmen. Wenn möglich werden dort Arbeiten im Freien nur in den frühen Morgen- und späten Nachmittagsstunden ausgeführt." --87.151.175.97 18:14, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Auch in der Südsee scheint die Siesta traditionell üblich (gewesen?) zu sein. Ich lese: "Bald begegneten wir niemand mehr und schienen eine Totenstadt zu durchforschen. Wir konnten nur zwischen den Pfosten der offenen Häuser die Bewohner bei ihrer Siesta sehen. Bald war eine ganze Familie in ein Moskitonetz gehüllt, bald lag ein einzelner Schläfer auf einer Plattform wie ein Toter auf der Bahre." (Robert Louis Stevenson, In der Südsee). --87.151.175.97 19:58, 9. Jun. 2014 (CEST)
- In der Zeit macht im September 2012 ein Leserartikel auf die Abschaffung der Siesta in Spanien aufmerksam. --87.151.175.97 20:04, 9. Jun. 2014 (CEST) Hier stellt sich das allerdings völlig anders dar. --87.151.175.97 20:07, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hier gibt es einen Hinweis auf Siesta in Skandinavien und Japan. --87.151.175.97 20:10, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hier begegnet uns die Schlafforschung (Zitat: "Tätsächlich wäre es besser, den Schlaf über den Tag zu verteilen. „Siesta-Kultur“, nennt der Regensburger Schlafforscher Jürgen Zulley den Hang zum Mittagsnickerchen. Bis zu Beginn der Industrialisierung habe diese in ganz Mitteleuropa existiert.") und die Stichworte Chronobiologie und „Biphasischer Schlaf“. --87.151.175.97 20:19, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ui, der französische Philosoph Thierry Paquot (Artikel in fr.wp, Autor des Buches "Die Kunst des Mittagsschlafes") als "Siesta-Aktivist". Ich lese zum Thema "Dämonen des Mittags": "Das ist jetzt nicht wirklich die erotische Dimension. Nein, was ich eigentlich meine, ist, dass man sich einfach gehen lassen kann, dass man den Körper sich erholen lassen kann in dieser Zeit, und wenn es da vielleicht einen Ruf der Sexualität gibt, dann ist das ein bisschen etwas anderes, weil das ist ja ein Zustand … im Französischen sagt man das manchmal, dass diese Mittagszeit so eine gewisse erotische Aufgeladenheit hat. Aber das geschieht ja dann zu zweit, das macht man ja dann nicht alleine (...) Aber es gibt einen Grund, und der liegt in der griechischen Mythologie, wo der Gott Pan, der unter anderem auch der Gott der Masturbation war, die jungen Hirten aufgesucht hat in dieser Mittagszeit, und deswegen gibt es diese Assoziation Mittagsschlaf und Erotik, die stammt von diesem Gott Pan." --87.151.175.97 20:38, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hab' Mal gehört, daß Angestellte in Italien (Bürojobs) in den Sommermonaten 3 bis 4 Std. Pause machen --217.189.220.214 20:48, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Sie gehen zum Mittagessen nach Hause, halten ein Nickerchen und dann wieder ins Büro. Faktisch verkürzt die Siesta nicht die Arbeitszeit, weil abends länger gearbeitet wird. (Hab ich mal gehört.) --87.151.175.97 21:00, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Über Siesta-Kultur bei Brigitte Steger: (Keine) Zeit zum Schlafen?: kulturhistorische und sozialanthropologische Erkundungen japanischer Schlafgewohnheiten., LIT Verlag Münster, 2004, 486 Seiten --87.151.175.97 20:57, 9. Jun. 2014 (CEST)
- @217.189.220.214: Du findest in Italien auch Architekturen, die helle Wohnungen macht, und dennoch sonnengeschützt sind. --Hans Haase (有问题吗) 21:03, 9. Jun. 2014 (CEST)
Abschnitt mit Tempolimit von 150 km/h zwischen Braunschweig und Magdeburg auf der Bundesautobahn 2?!
Hey,
ich meine mich erinnern zu können, dass sich in einem Abschnitt der BAB 2 zwischen Braunschweig und Magdeburg (Fahrtrichtung Berlin) in irgendeinem Abschnitt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 150 km/h befindet. Damit meine ich ein Zeichen 274-56 (Roter Kreis auf weißem Hintergrund), in dem die Zahl 150 steht - eben ein normales Richtzeichen für die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Eigentlich sind Tempolimits jenseits der 130 km/h, soweit ich weiß, in Deutschland aber nicht standardisiert. Dennoch bin ich mir aber sicher, vor einigen Jahren ein solches Zeichen im besagtem Abschnitt gesehen zu haben. Kann auch nicht garantieren, dass das heute noch da steht. Kann das jemand bestätigen oder liege ich da falsch? Es kann aber auch sein, dass ich mich irre und sich dieses Schild doch woanders befand oder befindet. Weiß da jemand genaueres? --Waver8500 (Diskussion) 14:49, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Grds. kann jede mögliche Geschwindigkeit als Höchstgeschwindigkeit festgelegt werden. Auf Autobahnen muss dein Auto ja nur mindestens 80 fahren können, damit du drauf darfst und 130 km/h auf der Autobahn sind ja nur eine Richtgeschwindigkeit. Da ist der Spritverbrauch noch halbwegs OK, du bist nicht super langsam, aber auch nicht allzu gefährlich schnell - aber eine Höchstgeschwindigkeit im Sinne eines Verbots schneller zu fahren sind die nicht. Die 150, die du gesehen hast (keine Ahnung, ob die da stehen), sind also tatsächlich sinnvoll, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit begrenzen. Ähnliches wird auch in anderen Ländern gemacht: Zulässige Höchstgeschwindigkeit weiß, dass in Italien 2013 auf einigen dreispurigen Autobahnen mit Seitenstreifen das Tempolimit per Beschilderung von 130 auf 150 km/h erhöht wurde - sonst gilt landesweit 130 km/h auf den Autobahnen. --88.130.91.32 15:26, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Abschnitt irgendwo ab kurz hinter Hannover bis irgendwo kurz hinter Braunschweig. Da waren 140 km/h erlaubt und auch entsprechend beschildert. Das war aber, glaub ich zumindest, noch bevor da diese elektronischen Schilderbrücken aufgestellt wurden. Heutzutage ist da meines Wissens tagsüber 130, nachts idR freigegeben, wenn nicht grad mal wieder gebaut wird...--JonBs (Diskussion) 16:00, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es sind sogar nur mindestens 60 km/h - sonst dürften die Stadtbusse nicht auf die Autobahn... -- Liliana • 16:07, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Auch Stadtbusse dürfen 80 fahren. --Rôtkæppchen₆₈ 16:24, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Auch ich kenne die Antwort auf die Frage nicht, weise aber darauf hin, dass in Deutschland eine derartige Beschilderung mit dem Begriff und der Rechtsprechung zum Thema "Richtgeschwindigkeit" kollidieren würde, weil diese ja (sage ich mal als Laie) darauf beruht, dass der Autofahrer für Folgen der Überschreitung der 130 in gewisser Weise verantwortlich sein kann; eine Höchstgeschwindigkeit von 150 würde diese Verantwortung wieder aufheben, wenigstens für den Bereich zwischen 130 und 150. Hummelhum (Diskussion) 16:37, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das kann irgendwie nicht so ganz sein: Der Autofahrer ist in jedem Fall für sein Fahren und für das, was dabei passiert selbst verantwortlich. Wenn er in einer Zone 30 nur 15 gefahren ist und dann ein Kind angefahren hat, kann er nicht sagen, da hafte jetzt auf einmal die Stadt dafür, weil man ja sogar 30 hätte fahren dürfen und er sei ja sogar noch langsamer gewesen. Etwas anderes wäre es nur, wenn man auf dem fraglichen Stück Strecke wirklich nur 130 fahren kann, etwa weil es Autos gibt, die bei dem Streckenverlauf, den Kurven, den Seitenwinden und was es sonst noch alles geben kann, bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr sicher kontrollierbar bleiben. Wenn dann ein "höchstens 150km/h"-Schild aufgestellt wird, dann sieht das mit der Haftung vielleicht anders aus, aber solange die Strecke auch mit 150 problemlos befahrbar ist, sehe ich da kein Problem. Andererseits begrenzt ein 150km/h-Schild anders als "gar kein Schild" die zulässige Höchstgeschwindigkeit und legt dem Autofahrer insofern sogar mehr Schranken auf als es die Richtgeschwindigkeit täte. --88.130.91.32 16:53, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Schau dir nochmal an, wie in Prozessen nach Unfällen das Thema Richtgeschwindigkeit berücksichtigt wird... Hummelhum (Diskussion) 16:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- So, dass sie - anders als ein die Höchstgeschwindigkeit begrenzendes Schild - die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht begrenzt. --88.130.91.32 17:15, 9. Jun. 2014 (CEST)
- "...in Prozessen nach Unfällen..." zitier ich mich ungern selbst. Hummelhum (Diskussion) 20:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Richtgeschwindigkeit begrenzt nicht die Höchstgeschwindigkeit. Wenn du auf was anderes hinauswillst, dann schreib es oder schweig. --88.130.91.32 20:15, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hat irgendjemand gesagt, dass die Richtgeschwindigkeit die Höchstgeschwindigkeit "begrenze"? Ich jedenfalls nicht. Worauf ich hinauswill, habe ich geschrieben und es wurde auch von Anderen erklärt. Mach dich kundig... Hummelhum (Diskussion) 21:39, 9. Jun. 2014 (CEST)
- So, dass sie - anders als ein die Höchstgeschwindigkeit begrenzendes Schild - die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht begrenzt. --88.130.91.32 17:15, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Schau dir nochmal an, wie in Prozessen nach Unfällen das Thema Richtgeschwindigkeit berücksichtigt wird... Hummelhum (Diskussion) 16:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das kann irgendwie nicht so ganz sein: Der Autofahrer ist in jedem Fall für sein Fahren und für das, was dabei passiert selbst verantwortlich. Wenn er in einer Zone 30 nur 15 gefahren ist und dann ein Kind angefahren hat, kann er nicht sagen, da hafte jetzt auf einmal die Stadt dafür, weil man ja sogar 30 hätte fahren dürfen und er sei ja sogar noch langsamer gewesen. Etwas anderes wäre es nur, wenn man auf dem fraglichen Stück Strecke wirklich nur 130 fahren kann, etwa weil es Autos gibt, die bei dem Streckenverlauf, den Kurven, den Seitenwinden und was es sonst noch alles geben kann, bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr sicher kontrollierbar bleiben. Wenn dann ein "höchstens 150km/h"-Schild aufgestellt wird, dann sieht das mit der Haftung vielleicht anders aus, aber solange die Strecke auch mit 150 problemlos befahrbar ist, sehe ich da kein Problem. Andererseits begrenzt ein 150km/h-Schild anders als "gar kein Schild" die zulässige Höchstgeschwindigkeit und legt dem Autofahrer insofern sogar mehr Schranken auf als es die Richtgeschwindigkeit täte. --88.130.91.32 16:53, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Auch ich kenne die Antwort auf die Frage nicht, weise aber darauf hin, dass in Deutschland eine derartige Beschilderung mit dem Begriff und der Rechtsprechung zum Thema "Richtgeschwindigkeit" kollidieren würde, weil diese ja (sage ich mal als Laie) darauf beruht, dass der Autofahrer für Folgen der Überschreitung der 130 in gewisser Weise verantwortlich sein kann; eine Höchstgeschwindigkeit von 150 würde diese Verantwortung wieder aufheben, wenigstens für den Bereich zwischen 130 und 150. Hummelhum (Diskussion) 16:37, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Wer welche Probleme sieht, scheint mir in der Beantwortung von Fragen zur Rechtslage unerheblich zu sein. Eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von mehr als 130 km/h anzuordnen, ist unzulässig: VwV zu Zeichen 274 VI. --BlackEyedLion (Diskussion) 16:57, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Überschreitung der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h führt nach der Rechtsprechung nicht automatisch zu einem Verschulden, aber zu einer Erhöhung der Betriebsgefahr. Die Betriebsgefahr ist der verschuldensunabhängige Teil der Haftung an einem Schaden - ähnlich wie bei der Haftung für Schäden, die durch Tiere entstehen und die auch kein Verschulden des Tierhalters voraussetzen.
- BlackEyedLion hat Recht: Ein Schild zur Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 150 km/h widerspricht Ziffer VI. der VwV-StVO zu Zeichen 274 ("Auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen dürfen nicht mehr als 130 km/h angeordnet werden."). Das korrespondiert mit dem Verkehrszeichenkatalog, in dem als höchstes Schild Nr. 274-63 ("zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 km/h") enthalten ist. Naheliegend ist daher, da ein solches Schild gar nicht einfach so bestellt und aufgestellt werden könnte, eine fehlerhafte Erinnerung des Fragestellers.
- Es kommt allerdings auch ein Scherz in Frage: In Heidelberg gab's auch mal so ein ähnliches Schild, das mal hier und mal da auftauchte und manchen Temposünder durch seine blosse, aber nachweisbare Existenz vor misslichen Folgen ihrer Raserei bewahrte. Nach meiner Erinnerung wurde nie aufgeklärt, wer das Schild angefertigt und immer mal wieder aufgehängt hatte. --Snevern 17:10, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Zweifelsfrei gab es diese Schilder auf der A2 (anders als in meiner Erinnerung allerdings wohl nur "digital" auf den Schilderbrücken) und somit eindeutig von "offizieller Seite" festgelegt. Gabs in der lokalen Presse auch Berichte zu. Ein (zugegebenermaßen nicht WP:WEB-konformer Beleg ;-)) für die Existenz: Klick.--JonBs (Diskussion) 18:28, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Danke für den Link! Man lernt bekanntlich niemals aus. --Snevern 19:23, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Zweifelsfrei gab es diese Schilder auf der A2 (anders als in meiner Erinnerung allerdings wohl nur "digital" auf den Schilderbrücken) und somit eindeutig von "offizieller Seite" festgelegt. Gabs in der lokalen Presse auch Berichte zu. Ein (zugegebenermaßen nicht WP:WEB-konformer Beleg ;-)) für die Existenz: Klick.--JonBs (Diskussion) 18:28, 9. Jun. 2014 (CEST)
Schuhe aus Netzgewebe
Bei der Hitze sind mir Schuhe wieder eingefallen, die mal in den 80er Jahren verbreitet waren: schlank geschnittene Halbschuhe, normal geschnürt mit einer dünnen Gummisohle. Statt aus Leder eben aus festem Netzgewebe. Gabs ein paar Jahre lang in allen möglichen Farben. Beim Googeln stoße ich nur auf irgendwelche Sportschuhe mit Anteilen von Netzgewebe. Weiß jemand, ob die Dinger noch oder wieder hergestellt werden und wo sie zu haben sind? Die Dinger sind enorm angenehm zu tragen und sehen nicht so dämlich aus wie Sandalen. Rainer Z ... 16:07, 9. Jun. 2014 (CEST)
Wissenschaftlicher Artikel
Hallo Wikipedia-Team. Könnt ihr mich über das Thema "Supercaps und Energiespeicherung" aufklären?
Danke im voraus.
--2A02:810C:8200:600:11E1:9C8D:10BD:C831 16:13, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Lies erst einmal den Artikel Superkondensator. Falls Du dann noch Fragen hast, kannst Du sie gerne hier stellen. --Rôtkæppchen₆₈ 16:22, 9. Jun. 2014 (CEST)
Bei welchem Wetter reißt der Zahnriemen schneller?
Der Zahnriemen meines Autos Fiats hat das Ende der vorgesehenen Lebensspanne erreicht, nicht in Kilometern (da wären noch 50.000 drin) sondern nach Jahren (5). Ein neuer kostet den Gegenwert eines alten Gebrauchtwagens, weil der ganze Motor ausgebaut werden muss. Nun frage ich mich: Sind 35° Außentemperatur eher ein Grund zur Sorge oder zur Hoffnung? Was meinen die Ingenieure hier? --PM3 17:56, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Vmtl. (hoffentlich) muss nicht der Motor ausgebaut, sondern nur aufgemacht werden, da der Zahnriehmen direkt am Motor steckt. Deshalb sollte auch die Außentemperatur keine Rolle spielen, weil es da ohnehin gemütliche 50-60 Grad warm wird.
- Aber alle 5 Jahre den Zahnriehmen austauschen ist schon iwie ein recht kurzes Austauschintervall?! Bei den deutschen Herstellern sind es glaube ich meist so um die 8-12 Jahre.--Plankton314 (Diskussion) 18:08, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ne die 5 Jahre ist das was die Hersteller an Garantie übernehmen. Auch bei meinen Dajhatsu sagte das Wartungsbuch spätestens nach 8 Jahre. Und ja, es ist je nach Modell eine teure Sache, denn auch bei meinem Cuore mussten sie auch ziemlich viel abmontieren, damit sie ran kamen. Aber bei den heutigen Autos heisst in der Regel ein gerissener Zahnriemen, auch ein kapitaler Motorschaden. Und dann wird es garantiert teuer. Klar kann man damit länger als die 5 oder 8 oder wie viel Jahre der Hersteller auch immer angibt herumfahren. Du solltet dir dann aber ein neues (anderes) Auto leisten können. Denn die Reparatur der Schäden die ein gerissen Zahnriemen hinter löst, rentiert sich in den seltensten Fällen. Das ist in der Regel ein wirtschaftlicher Totalschaden, gerade wenn eben wegen zulangen Wartungsinterwall nicht der Hersteller haftbar gemacht werden kann.--Bobo11 (Diskussion) 18:35, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Aufmachen is' nicht, das Teil ist eigentlich zu groß für den Motorraum und wurde links und rechts zentimetergenau eingepasst. Die Betriebstemperatur schwankt mit der Außentemperatur, schön zu beobachten auf dem serienmäßig vorhandenen Ölthermometer. 65 Grad im Winter vs. 95 im Sommer müssten schon nen Unterschied machen. Dass es ein Totalschaden wäre ist mir klar, nen neuer Motor würde das dreifache von dem kosten was die Karre noch wert ist.
- Die Frage war aber: Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Reißfestigkeit von Zahnriemenmaterial und der Temperatur? --PM3 18:38, 9. Jun. 2014 (CEST)
- (BK)Die Wassertemperatur, auf die es beim wassergekühlten Motoe eher ankommt, ist normalerweise thermostatisch geregelt und sollte daher nicht so stark von der Außentemperatur abhängen – außer natürlich im Kurzstreckenbetrieb, wenn der Motor seine Betriebstemperatur nicht erreicht. --Rôtkæppchen₆₈ 18:40, 9. Jun. 2014 (CEST)
- BK Bei kaltem Wetter ist der Riemen härter und auch gespannter, bis er warm und elastischer wird, vergeht eine Zeit, in der das Material stärker belastet ist. Würde also behaupten, dass ihm das schönere Wetter besser gefällt. Mit der Begrenzung der Laufleistung ist eine Garantie des Herstellers verbunden. Sollte der Zahnriemen vor den Ablaufdaten reißen, wird der Folgeschaden in Kulanz abgewickelt. Reißt er später, ist der Halter dann der Gelackmeierte. Und diese Folgeschäden kosten ein mehrfaches der üblichen 600,-- bis 700,-- Euro für einen Riemenwechsel. Weiterfahren bis er reißt kann man nicht empfehlen, wie es der Teufel will, reißt der Riemen bei Überholen und der Sachverständige wird dann zu allem vorhandenen Ungemach eines Unfalles noch feststellen, dass der Keilriemen abgelaufen war. Also, auch als Armer muss man Verantwortung zeigen.--87.162.248.248 18:41, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Kosten in der Vertragswerkstatt sind hier doppelt so hoch, das sind 13 Arbeitsstunden plus Material. Wegen der Kulanz bin ich mir hier nicht so sicher, werd's mal abklären. Mit der Verantwortung hast du natürlich recht. --PM3 18:47, 9. Jun. 2014 (CEST)
- BK Bei kaltem Wetter ist der Riemen härter und auch gespannter, bis er warm und elastischer wird, vergeht eine Zeit, in der das Material stärker belastet ist. Würde also behaupten, dass ihm das schönere Wetter besser gefällt. Mit der Begrenzung der Laufleistung ist eine Garantie des Herstellers verbunden. Sollte der Zahnriemen vor den Ablaufdaten reißen, wird der Folgeschaden in Kulanz abgewickelt. Reißt er später, ist der Halter dann der Gelackmeierte. Und diese Folgeschäden kosten ein mehrfaches der üblichen 600,-- bis 700,-- Euro für einen Riemenwechsel. Weiterfahren bis er reißt kann man nicht empfehlen, wie es der Teufel will, reißt der Riemen bei Überholen und der Sachverständige wird dann zu allem vorhandenen Ungemach eines Unfalles noch feststellen, dass der Keilriemen abgelaufen war. Also, auch als Armer muss man Verantwortung zeigen.--87.162.248.248 18:41, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ist halt ein bißchen wie Lotto. In den allermeisten Fällen passiert lange nichts, aber wenn du zufällig der eine bist...
- Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die mechanische Belastung (während laufendem Motor oder hohe Drehzahl) ungleich größer ist, als die thermische Belastung mit 20 Grad mehr oder weniger. Über die Außentemperatur würde ich mir deswegen keine Gedanken machen.--Plankton314 (Diskussion) 18:53, 9. Jun. 2014 (CEST)
- (BK)Wegen der Temperatur. Ich würde mal sagen je kälter desto problematischer. So ein Teil sollte ja weich sein, je kälter desto steifer, und je älter desto brüchiger. Wenn es also um das Wann geht, jetzt eilt es noch nicht, aber spätestens im Herbst sollte es gemacht werden. Gerade wenn das Auto draussen abgestellt wird (in Garagen gefriert es doch ein bisschen weniger schnell, und die dämpfen auch die negativen Extremwerte gut). --Bobo11 (Diskussion) 18:42, 9. Jun. 2014 (CEST)
- @ 87.162.248.248: Eine Garantie des Herstellers, wonach der Folgeschaden in Kulanz abgewickelt wird, ist ein Widerspruch in sich. Auf eine Garantieleistung hat man bei Vorliegen der Voraussetzungen immer einen einklagbaren Anspruch, auf eine Kulanzleistung nie. --Snevern 19:36, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hast ja so was von Recht. Nur der Motorenlieferant aus Frankreich (ja, der bei Red Bull) hat uns beim Megane Cabrio trotzdem anteilig Geld alt für neu abgenommen. Das wollte ich damit ausdrücken.--87.162.248.248 19:55, 9. Jun. 2014 (CEST)
- @ 87.162.248.248: Eine Garantie des Herstellers, wonach der Folgeschaden in Kulanz abgewickelt wird, ist ein Widerspruch in sich. Auf eine Garantieleistung hat man bei Vorliegen der Voraussetzungen immer einen einklagbaren Anspruch, auf eine Kulanzleistung nie. --Snevern 19:36, 9. Jun. 2014 (CEST)
- (BK)Wegen der Temperatur. Ich würde mal sagen je kälter desto problematischer. So ein Teil sollte ja weich sein, je kälter desto steifer, und je älter desto brüchiger. Wenn es also um das Wann geht, jetzt eilt es noch nicht, aber spätestens im Herbst sollte es gemacht werden. Gerade wenn das Auto draussen abgestellt wird (in Garagen gefriert es doch ein bisschen weniger schnell, und die dämpfen auch die negativen Extremwerte gut). --Bobo11 (Diskussion) 18:42, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Bei Kälte, insbesondere bei Minusgraden ist die Rissgefahr größer: Der Riemen hat seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht und ist daher noch nicht so geschmeidig und, was viel mehr reinspielt, alles was der Riemen antreiben soll hat ebenfalls noch keine Betriebsteperatur erreicht. Wenn Zahnriemen reissen, dann gerne beim Motorstart und nach langem Stillstand.
- Die Herstellervorgaben für das Wechselintervall liegen meist weit auf der sicheren Seite, Beispiel der ES9 J4: Laut Fahrzeughersteller 120.000 km (oder 10 Jahre, je nachdem was früher eintritt), der Lieferant des Zahnriemens schreibt in den Unterlagen zu seinem Bauteil 145.000 km. Beim später herausgekommenen ES9 J4S (+ variable Einlassnockenwellen) sieht der Fahrzeughersteller 180.000 km vor (gleicher Zahnriemen). Vermutliche Ursache des verlängerten Intervalls ist eine erweiterte Erfahrungsbasis mit eigenen Fahrzeugen und gesicherte Erkenntnisse, warum bei einem anderen Hersteller (De), der vor etwa 15 Jahren auffällig geworden war, die Zahnriemen an dessen PKW-Dieselmotoren so häufig gerissen sind.
- Wenn Riemen altern können sich, wie bei Reifen, kleine Risse in der Oberfläche bilden. In dem Fall ist ein zügiger Austausch ratsam. Wenn dem nicht so ist und wenn es mein FIAT wäre, hätte ich ihn eher moderat bewegt und würde in der dargestellten Situation das km-Guthaben ausnutzen.--87.163.69.24 20:25, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Außentemperatur ist nur beim Start relevant. Der Motor wird schnell wärmer als jegliches Wetter und er sitzt am Thermostat bei ca. 90 °C. Ältere Benzinmotoren sind teilweise Freiläufer. Mit denen bleibst Du liegen und der neue richtig getimet (auf oberen Totpunkt) aufgezogene Riemen tut gute Dienste. Bei Dieseln oder neueren und höher verdichtenden Motoren ragen die Ventile in den den Weg des Kolbenhubs hinein. Dazu findest Du im Internet schöne Bilder von Abdrücken auf den Kolben, abgerissenen Ventilen und gerissenen Zylinderköpfen. Das wird richtig teuer. Die Kurbelwelle kann auch etwas abbekommen und die Zylinderkopfschrauben können schon mal reißen. Die sind nach Aufschrauben Schrott, da sie Dehnschrauben sind. Es ist also Blödsinn so weiterzufahren. Da kostet im schlimmsten Fall das Bergen mehr als ein altes Auto oder der Restwert wäre, wenn nicht verzerrt dargestellt höher als der Motorschaden. Zwar bekommst Du alte Autos billig, nur haben sie ihre Wartung noch vor sich oder die Karosse hält nicht mehr lange, oder sie haben (teils auch sporadische) Fehler, die die Werkstatt nicht gefunden hat. An der Uni Bremen läuft gerade ein Projekt über ein geschlossenes Forum, in dem sich „Experten“ austauschen über unerklärliche und ungelöste Fehler. Einige Fehler findet man in etablierten Foren, wobei auch viel Fehlvermutungen darunter sind. Für mich ist dieses Fehlermanagement Stand heute Grund Nummer eins kein deutsches Auto zu kaufen. --Hans Haase (有问题吗) 20:27, 9. Jun. 2014 (CEST)
- „Die Außentemperatur ist nur beim Start relevant“: Richtig, aber siehe eins darüber: „Wenn Zahnriemen reissen, dann gerne beim Motorstart und nach langem Stillstand“. - Aber ich hatte mich eh' schon gefragt, wo Du bleibst :-)
- @PM3: Du könntest in FIAT-Foren mal nach Erfahrungswerten für genau Dein Auto suchen. Damit hättest Du eine solidere Entscheidungsbasis als eine Meinung von jemand, der solche Beiträge schreibt. --87.163.69.24 20:53, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Erstmal danke soweit für eure Beiträge. Es ist also anzunehmen, dass der Riemen bei wärmeren Temperaturen stabiler ist, insbesondere weil er in nicht in so kaltem Zustand anläuft. Dem Tip mit den Fiat-Foren gehe ich mal nach, für dieses Modell gibt es auch Spezialforen. Nach Rissen mag ich nur ungern schauen, weil die Zahnriemenabdeckung, wenn man sie einmal mit Gewalt beiseite biegt, sich erfahrungsgemäß nicht mehr komplett schließt - ist dann schwer wieder dichtzukriegen. Abschrauben geht ja nicht wegen der Enge.
- Die Aussagen zur Betriebstemperatur des Motors hier sind definitiv falsch. Ich habe die Öl- und Wassertemperatur im Auge, und beide sind zumindest bei höheren Fahrgeschwindigkeiten stark abhängig von der Außentemperatur. Der Motor hat übrigens neben dem Wasserkühler einen separaten Ölkühler. --PM3 21:04, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Die Wassertemperatur (typischer Wert für Benziner ist 90 °C) sollte sich, nach warmgefahrener Maschine, nur um wenige °C ändern, andernfalls könnte der Thermostat defekt oder ein Kühler verdreckt sein.
- Die Öltemperatur pendelt sich bei vergleichbarer Fahrerweise bei Werten ein, die sich im Betrag um ziemlich genau die Aussentemperatur unterscheiden: Wenn also bei bekannter, ebener Strecke im Winter bei 5 Grad Aussentemperatur 65 Grad Öltemperatur angezeigt werden, dann sind auf dieser Strecke im Sommer bei 35 Aussentempeartur 95 Grad Öltemperatur okay. Bei andauernder Volllast auf freier Autobahn können es schnell auch 50 °C mehr werden, flott und länger bergauf (Schwarzwald, Schweiz, Alpen) auch trotz zusätzlichem Ölkühler.
- Die Zahriemenabdeckungen lassen manchmal den Einblick von unten zu (Hebebühne). Oben sind sie vor allem deswegen geschlossen dass beim nachfüllen von Motoröl nichts davon auf den Riemen kommt. --87.163.69.24 21:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
Der Zahnriemen ist das langlebigste Teil des ganzen Ventiltriebs. Bevor das Ding reißt, sind alle Laufrollenlager Schrott, der Riemen springt eine Zahn über und der Motor ist hin. Guck nach, ob das Spannrollenlager nicht eiert, ebenso das Wasserpumpenlager, falls die Wasserpumpe über den Zahnriemen angetrieben wird. Lichtmaschine widr selten über den Zahnriemen angetrieben, wenn ja, ebenfalls kontrollieren. Wenn kaputt, Rollen tauschen, kosten neu so 30 Euro pro Stück plus Einbau. Der Riemen kann draufbleiben, die halten 50..100% länger als spezifiziert. Um die Restlaufzeit des Riemens zu beurteilen, alle Zähne angucken, ob irgendwo einer angebrochen ist. Wenn ja -> tauschen. Wenn nein -> weiterlaufen lassen. Ist übrigens vermutlich Unsinn, dass der Motor zum Zahnriementausch rausgehoben werden müsste, es sei denn, du hast einen Ferrari. Meistens muss die seitliche Motorlagerung abgebaut werden, obwohl es z.B. bei Opel intelligente Ingenieure gab, die den Riemen um das Lager herumgeführt haben. -- Janka (Diskussion) 01:37, 10. Jun. 2014 (CEST)

- Ist nicht wirklich ein Ferrari. Die Lichtmaschine hängt mit Klimakompressor und Bremsservo an einen eigenen Riemen, siehe links unten im Bild. Der Zahnriemen sitzt unter der dunkelgrauen Abdeckung darüber, links daneben ist 1 cm Platz zum vertikalen Blech (Radkasten?). Rechts isses auch eng und der Motor ist nicht der kleinste, der muss zumindest ein gutes Stück angehoben werden um ihn weit genug nach rechts zu kippen. Der Hersteller sieht aber vor ihn komplett rauszuheben. Ohne den Motor zu bewegen kommt man nicht an den Riemen (und die Lager?) ran, um sie zu inspizieren. --PM3 02:48, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Aber warum sollten die Lager denn verschlissen sein, wenn sie erst gut die Hälfte der vorgesehenen Kilometerleistung runterhaben? Die verschleißen doch nicht durch rumstehen. --PM3 04:35, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Aha, der schnellste FIAT aller Zeiten. Die Platzverhältnisse sind so nicht unüblich, auch bei Autos mit dem oben von mir erwähnten Motor ist das nicht anders. Gegenüber der Steuerseite ist es ebenso beengt, denn dort hängt das Getriebe dran (sieht man nicht gleich so deutlich, weil es tiefer liegt).
- Manchmal finden sich, meist kleine, Werkstätten die behaupten, den Zahnriemen genauso gut bei eingebautem Motor wechseln zu können: Das Gewurschtel für den Monteur ist vorstellbar? Kann man nur vor warnen, hab' mal zufällig beobachtet wie dabei mit einer anderthalb Meter langen Stange als Hebel der Motor mitsamt Getriebe beiseite gedrückt wurden, um ein paar zusätzliche Zentimeter Patz zu haben. So 'ne Aktion bedeutet oft das Aus für eines der Motorlager. Manchmal lassen sich dabei nicht alle Rollen wechseln. Wenn der Motor aber schon mal draussen ist, fallen für den Wechsel der Motorlager (was gerne übersehen wird) eigentlich nur noch Teilekosten an - neben denen für Umlenkrollen und Spannrolle (was unbedingt gemacht werden sollte). Falls die Wasserpumpe schwer zugänglich ist gilt auch hier: Es ist die Gelegenheit. --87.163.69.24 05:08, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Argh, 2.0ie Turbo. Ich musste mal beim Zahnriemenwechsel bei einem Lancia 1.6ie Turbo mithelfen, das ging da schon *wirklich* nur mit Rausheben des Motors. War sehr interessant und wir haben auch alles wieder zusammengekriegt, hat aber Tage gedauert. Warum wir das selbst gemacht haben? Die Lancia-Vertragswerkstatt war zu doof dazu und hat wie oben schon angedeutet das linke Motorlager kaputtgemacht. Und beim Ausbauen haben wir bemerkt, dass die die Spannrolle nicht wie behauptet getauscht hatten. Gab ein Riesenbohei. -- Janka (Diskussion) 13:47, 10. Jun. 2014 (CEST)
- @87.163.69.24: Ist es auch eine Gelegenheit für die Kupplung, oder bekommt man die genauso einfach bei eingebautem Motor raus? Die hat jetzt 150.000 km hinter sich. --PM3 16:15, 10. Jun. 2014 (CEST)
Deutsche in Dänemark
Wieviele Deutsche leben in (a) Dänemark und (b) Kopenhagen? Leider habe ich keine verlässlichen Daten recherchieren können. Ich bin bei meiner Frage nicht an der Anzahl der Mitglieder der deutschen Minderheit interessiert. Mir geht es bei meiner Frage konkrekt um Bundesbürger in Dänemark und Kopenhagen. 87.51.169.180 18:10, 9. Jun. 2014 (CEST)
- 2014 leben schon einmal 21278 Ausländer mit deutschem Ursprung in Dänemark.[29] --Rôtkæppchen₆₈ 18:22, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Im zweiten Quartal 2014 leben 3826 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit in Kopenhagen.[30] --Rôtkæppchen₆₈ 18:26, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Im zweiten Quartal 2014 leben 22648 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit in ganz Dänemark.[selbe Quelle] --Rôtkæppchen₆₈ 18:28, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Super, danke! 87.51.169.180 18:38, 9. Jun. 2014 (CEST)
Ob und wer hätte Oswald begnadigen dürfen?
Wäre es eigentlich theoretisch nach Rechtslage, nicht moralisch, denn das wäre politischer Selbstmord, möglich gewesen den mutmaßlichen Mörder Kennedys Lee Harvey Oswald zu begnadigen, wäre er nicht selbst erschossen worden? Unabhängig davon, ob er JFK nun ermordet hat, oder nicht (er wäre ja sicher angeklagt worden). Und welche Behörde hätte diesen Gnadenakt autorisieren können? Ich nehme an die texanischen, da ja das Strafrecht in den USA nicht landesweit einheitlich geregelt ist. MFG
--78.51.150.174 19:21, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Es gibt in den USA auch Bundesstrafrecht, und in diesen Bundesstrafsachen ist ausschließlich der Präsident gnadenbefugt - sogar schon vor einer Verurteilung. --Snevern 19:34, 9. Jun. 2014 (CEST)
- In den einzelnen Bundesstaaten wären es wohl die jeweiligen Gouverneure, die begnadigen könnten. Je nach Rechtslage das Bundesstaates. Die Frage ist auch deshalb sehr theoretisch, weil O. gar nicht erst verurteilt wurde. --Pyrometer (Diskussion) 19:43, 9. Jun. 2014 (CEST)
- BK Oswald blieb aber unter Investigation der Texaner, ob sie ihm auch den Prozess hätten machen können, ist von der Geschichte überrollt. Kann mir vorstellen, dass der stolze Staat Texas den Fall ungerne an die Administration in DC abgegeben hätte. In Texas wäre es dann der Gouverneur gewesen. --87.162.248.248 19:46, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Hat eine gewisse Ironie, wenn der Präsident der einzige wäre, der ihn begnadigen könnte, und der erschossen wurde. Sicher, der Vizepräsident rückt dann auf das Amt nach... Texas hätte das wohl ungern abgegeben, aber der Bund hätte den Fall wohl auch gerne gehabt. --mfb (Diskussion) 19:54, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Präsidentenmord ist nach Chapter 84, Sec. 1751, des United States Code eine nach Bundesrecht zu verfolgende Straftat. Für diese Straftaten hat ausschließlich der Präsident der Vereinigten Staaten das Recht, eine Begnadigung auszusprechen, und das ist nicht davon abhängig, dass es zuvor eine Verurteilung gab. Prominentes Beispiel einer Begnadigung durch einen Präsidenten (auch wenn's dabei nicht um Präsidentenmord ging, aber um Straftaten ohne Verurteilung) ist die Begnadigung Nixons durch Ford für alle von jenem im Amt begangenen Straftaten 1974. --Snevern 19:56, 9. Jun. 2014 (CEST)
Entwicklungshilfe: Adoption
Meinem Partner und mir waren zwar keine eigenen Kinder vergönnt, aber durch zwei Adoptivkinder haben wir unser Familienglück gefunden. Wir haben uns gedacht, dass es in Entwicklungsländern bestimmt auch kinderlose Paare gibt, denen aber die Mittel für eine Adoption fehlen. Aus diesem Grund haben wir nach Entwicklungshilfe-Organisationen gesucht, die sich unter anderem in diesem Bereich betätigen. Leider haben wir nur Spendenaufrufe für eine Patenschaft von Kindern oder zur Unterstützung von Familien (mit eigenen Kindern) gefunden. Auch wenn dies natürlich ebenfalls unterstützenswert wäre, möchten wir kinderlosen Paaren helfen, damit diese Waisenkindern oder Kindern aus Heimen Eltern sein können. Kann uns hier jemand weiterhelfen? Danke! --178.83.122.77 20:32, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Knallhart: Erst ethnozentrische Brille abnehmen, dann weiter Infos suchen. Ist nicht böse gemeint, aber in Staaten, in denen die Leute halbwegs ihr Auskommen haben, können Adoptionen ohne euer Zutun funktionieren. In Staaten, in denen es den Leuten sehr schlecht geht, ist ihnen mit Geld von euch so nicht geholfen. In vielen Ländern gibt es bürokratische Hemmschwellen und illegitime Interessen an Adoptionen - dagegen könnt ihr von hier aus nichts tun. Wer in einem ärmeren Land Kinder adoptieren will und kann, der tut das. Wer es nicht kann, kann es auch mit eurer Hilfe nicht: Nehmen wir an, das dortige Paar adoptiert nun ein Kind in der Gewissheit, jeden Monat von euch Unterhalt für das Kind zu bekommen - wie kann es sicher sein, dass dieser Unterhalt 15 Jahre lang aus der fernen Schweiz kommt?
- Daher (weiterhin meine persönliche Meinung) entweder etwas tun, was über echte persönliche Kontakte läuft oder an eine euch bekannte und zuverlässige Organisation wenden, eventuell eine kirchliche oder Rotary o.ä. Geld, das einem Kind den Schulbesuch und eventuell einen Oberschul- (oder wie es dort strukturiert ist) - Besuch ermöglicht, ist gut angelegt, wenn es wirklich dort ankommt (ja, ich kenne Fälle). Hummelhum (Diskussion) 21:35, 9. Jun. 2014 (CEST)
- (BK) Das ist ein schwieriges Thema. In Entwicklungsländern gibt es vor allem Eltern, denen die Mittel für die Versorgung ihrer Kinder fehlen, weshalb sie diese dann verkaufen. In der Entwicklungshilfebranche gilt daneben vielfach das Gewinnmaximierungskonzept, die Spendengelder landen über einen Umweg durch Afrika zu großen Teilen wieder im Westen. Am ehesten hilfreich ist der Kauf von fairgehandelten Produkten. Weniger Ausbeutung = weniger Familiendramen. Da würde ich ansetzen. --88.68.87.252 21:54, 9. Jun. 2014 (CEST)
Nun, es gibt schon Länder, z.B. in Afrika, wo durch AIDS die mittlere Generation dramatisch weggebrochen ist. Natürlich gibt es da auch viele Waisenkinder.
Die Frage, die allerdings bei allen Überlegungen immer über allem stehen sollte, ist die nach dem Kindeswohl. Nicht die nach unerfülltem Kinderwunsch - so tragisch dieser im Einzelfall auch empfunden werden mag.
Also, die Frage: Was ist das Beste für diese Kinder? Dass sie, die ohnehin schon einen schweren Verlust erlitten haben, möglichst nicht noch weitere Verluste erleiden. Dass sie soweit wie möglich in der vertrauten Umgebung und bei vertrauten Menschen bleiben können. Das sind in diesen Ländern oft Verwandte, Großeltern oder Tanten, die dann plötzlich für eine ganze Kinderschar da sein müssen. Wenn man also diesen Kindern wirklich helfen will, dann am besten, indem man z.B. diese Verwandten unterstützt, die sich um die Kinder kümmern. Indem man den Kindern den Schulbesuch ermöglicht. Etc.
Und das von der IP angesprochene Thema ist natürlich auch nochmal ein ganz fürchterliches. Verhindern, dass es überhaupt zu so einer ausbeuterischen Adoptionspraxis kommt, wäre da sicher sowohl dem Kindes- als auch dem Elternwohl am angemessensten. Und auch hier hilft man den Kindern am besten, indem man den Eltern hilft. Fairer Handel ist da schon eine sehr gute Idee.
Seriöse und von offizieller Seite überprüfte Spendenorganisationen jeglicher Couleur kannst Du hier finden. Gruß, --Anna (Diskussion) 22:25, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn Sie unkompliziert etwas gutes für wirklich sehr arme Kinder tun möchten, empfehle ich Ihnen eine regelmässige Spende an das Projekt Kinderbauernhof Rusciori in Rumänien. Dieses Projekt kümmert sich um Roma-Kinder in einem katastrophal miesen Roma-Dorf in Siebenbürgen, wo die Leute teilweise in nicht winterfesten Hütten hausen, die Analphabetenrate erschreckend hoch ist, ebenso wie die Geburtenrate. Die vielen Kinder dort, wachsen in ganz heruntergekommenen Bedingungen auf und dieses Projekt versucht wirklich sehr engagiert, diesen Armutsteufelskreis zu durchbrechen und der nächsten Generation der Dorfbewohner Bildung beizubringen und sie mit Kleidung, täglichem warmen Mittagessen und Schulsachen unterstützt. Das Projekt steht jedoch ständig auf der Kippe, weil nur sporadisch Spenden aus dem Ausland kommen und leider nicht regelmässig. Fehlt es an Finanzen, muss wieder für ein halbes Jahr die Nachhilfelehrerin entlassen werden, oder die Mittagsmahlzeit für 50 Kinder fällt ein paar Wochen aus. Sollte das Projekt einmal ganz kippen, verfällt das Dorf wieder komplett zum Slum und die Folgen werden wir in Europa alle spüren. Denn wer die Schule abbricht, oder nach ein paar Jahren Schule immer noch Analphabet ist, der findet keinen Job und dann bleibt nur mehr Betteln (auch im Ausland), Kleinkriminalität und Prostitution. Bei Interesse, hier Kontaktdaten (http://www.kinderbauernhof.org/kontakt.html Kinderbauernhof) und zusätzlich noch ein paar Berichte: Bericht eines Freiwilligen, noch ein Bericht, Neue Osnabrücker Zeitung. --El bes (Diskussion) 23:27, 9. Jun. 2014 (CEST)
Danke für die vielen gut gemeinten Tipps. Wir engagieren uns bereits in anderen Bereichen karitativ, beispielsweise bezüglich der Verbesserung der medizinischen Versorgung in einer bestimmten Region Afrikas. Wir möchten uns aber zusätzlich spezifisch in der Unterstützung von adoptionswilligen Paaren engagieren, wobei natürlich das Kindeswohl selbstverständlich berücksichtigt werden muss. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sowas nicht möglich sein soll! Grüße, 178.83.122.77 09:59, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Moeglich ja, aber sehr anfaellig. Schon bei der Adoption an sich muss man gewaltig aufpassen, dass das Kind nicht den Eltern quasi abgekauft wurde, um damit ein Geschaeft zu machen. Nun kommt noch eine zweite Partei hinzu (von den Zwischenhaendlern mal ganz abgesehen) - das "arme Ehepaar ohne Kind", das moeglicherweise das Kind nur adoptiert, um dank der Spenden aus der Schweiz damit Geld zu verdienen. Wenn ich an China denke (ja, ich pflege auch manchmal Klischees), dann kann ich mir eine Menge Leute denken, die eher aus finanziellen Motiven alle moeglichen Situation vortaeuschen. Im schlimmsten Falle koennte dann auch noch das eigene Kind versteckt oder gar abgetrieben werden, um das Bild des kinderlosen Ehepaars zu pflegen, und eine gefaelschte amtliche Urkunde oder aerztliches Attest kann man mit nicht allzu viel Geld auch irgendwie heranschaffen. Um solch ein System hinreichend zuverlaessig zu machen, muesste also ein gewaltiger Kontrollaufwand getrieben werden, der dann einen guten Teil der Spendengelder aufbraucht. Als Hilfsorganisation kann man es 99Mal richtig hinkriegen und genau kontrollieren, wenn man beim 100sten Mal an einen Betrueger geraet und die Oeffentlichkeit es erfaehrt, kann man den eigenen Ruf vergessen. -- 160.62.10.13 10:44, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn Ihr wirklich absolut sicher sein wollt, daß Euer Geld nicht in falsche Hände gerät, spendet es am besten der Wikimedia Foundation... --93.137.166.94 12:06, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Etwas umformuliert lautet die Frage: Welche Organisation(en), helfen adoptierwilligen Paaren in Entwicklungsländern mit (finanziellen) Mitteln bei deren Adoptionswunsch? Und nicht: Was haltet Ihr von unserem Vorhaben... (was im Übrigen auch keine allgemeine Wissenfrage wäre). Beantwortet wird die Frage von keinem (wenn man mal von 160.62.10.13 absieht, wo die Antwort zwar behauptet, das so etwas möglich wäre, aber keine Organisation nennt). Statt dessen kommen kluge Ratschläge, was denn wohl besser sei und wohin der Fragsteller sein Geld besser überweisen solle, dies selbst dann, wenn seitens der Fragesteller noch einmal klar gemacht wird, was gewollt ist und man sich durchaus seine Gedanken gemacht hat. Beschämend, irgendwie. Nicht, dass niemand eine Antwort weiß, sondern mit anderen, überhaupt nicht erbetenen "Auskünften" auf die Frage nicht einmal eingegangen wird. Ist es so schwer, einfach mal nicht zu antworten, wenn man die Antwort nicht kennt? Und wenn man schon seine persönliche Meinung zum Thema kundtun will (wozu die Auskunft eigtl. nicht da ist), warum dann nicht wenigstens in kleiner Schrift, womit deutlich würde, dass es diese Meinung gänzlich Off topic ist? -- Ian Dury Hit me 12:38, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Besteht nicht der weit überwiegende Teil der Antworten hier in der Auskunft aus ergoogeltem Halbwissen und persönlichen Ansichten, nach denen nie gefragt wurde...? Nur zur Klarstellung: mein Kommentar weiter oben mit der Spende an die Foundation war bitter ironisch gemeint! --93.137.166.94 12:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
- @Ian Dury: Dass Du die Antworten nicht gutheißt, kann ich nicht ändern, und da es Antworten zur Sache waren, sehe ich auch keinen Grund - auch jetzt nicht - auf kleine Schrift zu wechseln.
- Wenn mich jemand fragt "Weißt du, in welchem Restaurant ich XY essen kann?" und ich habe zuverlässige Informationen darüber, dass XY extrem gesundheitsschädlich ist, dann würde ich mir allerdings die Freiheit nehmen, nicht mit dem Namen des Restaurants, sondern mit einem Hinweis auf die Gesundheitsschädlichkeit zu antworten. In Deinem Sinne dann auch eine "nicht erbetene Auskunft".
- In diesem Sinne auch hier. Wie kommt es denn, dass Organisationen, die Projekte für ungewollt kinderlose Ehepaare in Entwicklungsländern zum Familienglück verhelfen, offenbar schwer zu finden sind? Das hat doch Gründe.
- Mir fallen sofort zwei sehr naheliegende Gründe ein: 1. Das dürfte nicht das größte Problem sein, das es in diesen Ländern anzugehen gilt. 2. Diese Lösung fördert das Kindeswohl offenbar nicht annähernd so effektiv wie andere Ansätze.
- Ich finde es ganz fantastisch, wenn Leute bereit sind, etwas für andere zu spenden. Nur sollte das dann primär an deren Bedürfnissen orientiert sein und nicht an den eigenen Wünschen. Sorry, aber diese Wahrheit kann ich hier keinem ersparen, auch wenn's eine unerbetene Auskunft ist. --Anna (Diskussion) 16:21, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Du solltest dann aber wenigstens schlüssig darlegen, inwiefern Adoption zwangsläufig dem Kindeswohl abträglicher ist, als wenn sich ein Verwandter gezwungenermaßen um das Waisenkind kümmert. --93.137.166.94 16:53, 10. Jun. 2014 (CEST)
- "Zwangsläufig" ist ein großes Wort. Oft aber bedeutete die Adoption, dass das Kind, das gerade seine Eltern verloren hat, nun auch noch aus seinem sonstigen Umfeld gerissen würde.
- Wie schon mehrfach von Mehreren gesagt, sollte das Kindeswohl wirklich zentral sein. Ich meine sogar, dass es das einzige Kriterium sein sollte. Man lese dagegen aber mal den ersten Satz der Frage: Meinem Partner und mir waren zwar keine eigenen Kinder vergönnt, aber durch zwei Adoptivkinder haben wir unser Familienglück gefunden. Hier ist nicht auch vom Glück der Adoptiveltern die Rede, sondern ausschließlich von diesem. Und nein, ich will damit nicht gesagt haben, dass die Fragesteller nicht ausgezeichnete (Adoptiv-)Eltern wären. Nur geht eben heute der Diskurs ganz weitgehend vom Wollen und Wünschen der potentiellen Adoptiveltern aus, siehe auch aktuelle Diskussionen in vielen westlichen Ländern zu Adoptionen seitens untypischer Adoptiveltern wie Alleinstehenden oder gleichgeschlechtlichen Paaren - auch hier keine Äußerung zur Eignung dieser Leute, aber es geht eben fast immer um ein "Recht" auf Adoption seitens der adoptionswilligen Erwachsenen... Hummelhum (Diskussion) 19:04, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Auch wenn Dir die Vorstellung idyllisch erscheinen mag, von wirtschaftlich schwachen Verwandten mit durchgefüttert zu werden, denen es schon Schwierigkeiten bereitet, nur den eigenen Nachwuchs satt zu bekommen, ist dies in der Realität keineswegs oft der Fall. Inwiefern es dem Kindeswohl zuträglicher sein soll, in einer solchen Umgebung großgezogen zu werden, anstatt von motivierten und liebevollen Adoptiveltern (ganz gleich welcher Couleur), wäre eben erst noch darzulegen. Wer schon kategorisch behauptet, über zuverlässige Informationen darüber zu verfügen, daß dies extrem schädlich sei, sollte auch in der Lage sein, diese konkret zu benennen. --93.137.166.94 20:48, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Du solltest dann aber wenigstens schlüssig darlegen, inwiefern Adoption zwangsläufig dem Kindeswohl abträglicher ist, als wenn sich ein Verwandter gezwungenermaßen um das Waisenkind kümmert. --93.137.166.94 16:53, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Etwas umformuliert lautet die Frage: Welche Organisation(en), helfen adoptierwilligen Paaren in Entwicklungsländern mit (finanziellen) Mitteln bei deren Adoptionswunsch? Und nicht: Was haltet Ihr von unserem Vorhaben... (was im Übrigen auch keine allgemeine Wissenfrage wäre). Beantwortet wird die Frage von keinem (wenn man mal von 160.62.10.13 absieht, wo die Antwort zwar behauptet, das so etwas möglich wäre, aber keine Organisation nennt). Statt dessen kommen kluge Ratschläge, was denn wohl besser sei und wohin der Fragsteller sein Geld besser überweisen solle, dies selbst dann, wenn seitens der Fragesteller noch einmal klar gemacht wird, was gewollt ist und man sich durchaus seine Gedanken gemacht hat. Beschämend, irgendwie. Nicht, dass niemand eine Antwort weiß, sondern mit anderen, überhaupt nicht erbetenen "Auskünften" auf die Frage nicht einmal eingegangen wird. Ist es so schwer, einfach mal nicht zu antworten, wenn man die Antwort nicht kennt? Und wenn man schon seine persönliche Meinung zum Thema kundtun will (wozu die Auskunft eigtl. nicht da ist), warum dann nicht wenigstens in kleiner Schrift, womit deutlich würde, dass es diese Meinung gänzlich Off topic ist? -- Ian Dury Hit me 12:38, 10. Jun. 2014 (CEST)
Also dann so: Die Kinder sollen "nach Möglichkeit" aus einem Kinderheim stammen oder zumindest Vollwaisen sein, aber nicht der Verwandtschaft oder gar den Eltern entrissen werden. Wir möchten eine Verbesserung auch für die Kinder. Ich hoffe, dass es damit nun klar ist, was wir suchen. Grüße, 178.83.122.77 20:24, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Dann einmal ganz deutlich: Es wird wohl kaum eine seriöse Organisation geben, die das anbietet. Die Gründe dafür wurden hier bereits genannt, besonders klar zusammengefasst von 160.62.10.13. Anders ausgedrückt müsstet Ihr selber nach den von Euch gewünschten Waisenkindern suchen bzw. eine entsprechende Organisation, besser noch Stiftung, gründen, wenn Ihr Euer Anliegen umsetzen wollt. --84.58.126.222 21:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Für alle Merkbefreiten, die es bis hier noch nicht kapiert haben nochmal ganz deutlich: die IP sucht keine Waisenkinder, sondern adoptionswillige und gleichzeitig hilfebedürftige Adoptiveltern! --78.1.88.189 23:30, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn der Fragesteller kein radikaler Atheist ist, würde ich sagen, geh einfach zum nächsten Pfarrer und trag dein Anliegen vor. Die haben Kontakte, oder können solche herstellen zu solchen Projekten, in Lateinamerika, Afrika, Südostasien. --El bes (Diskussion) 23:36, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Für alle Merkbefreiten, die es bis hier noch nicht kapiert haben nochmal ganz deutlich: die IP sucht keine Waisenkinder, sondern adoptionswillige und gleichzeitig hilfebedürftige Adoptiveltern! --78.1.88.189 23:30, 10. Jun. 2014 (CEST)
Mutationen mit Chromsomemzahländerung
Gibt es Mutationen, bei denen sich die Anzahl der Chromosomen ändert, und die Lebensform auch lebensfähig ist. Prinzipiell müsste es die ja geben, wenn die Evolution schlüssig sein soll. Sind solche Fälle dokumentiert?--Verhungerter Mexikaner (Diskussion) 21:48, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Irgendwann muss es mal passiert sein, den es gibt diverse Lebewesen mit unterschiedlicher Zahl an Chromosomen. Nur ist das passiert, bevor es erforscht wurde. Alternativ käme theoretisch nur in Frage, dass das Leben mehrfach entstanden wäre und Viren DNA transportiert hätten, aber das ist unwissenschaftlich. Als nicht reproduzierbar gelten Maultier oder Trisomie. --Hans Haase (有问题吗) 22:27, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, gibt es. Z. B. Trisomie 21 aka Down-Syndrom--Antemister (Diskussion) 23:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist nicht auf Mutationen zurückzuführen, siehe Beitrag über dir. --Cubefox (Diskussion) 00:00, 10. Jun. 2014 (CEST) Korrektur: Laut Down-Syndrom#Ursachen könnten Genmutationen durchaus eine Ursache sein, genau weiß man es offenbar noch nicht. --Cubefox (Diskussion) 00:07, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ja, gibt es. Z. B. Trisomie 21 aka Down-Syndrom--Antemister (Diskussion) 23:02, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Aneuploidie --84.58.126.222 03:13, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Es gibt einige Gruende fuer Veraenderungen an der Struktur von Chromosomen, zum Beispiel ionisierende Strahlung. Chromosomenaberration, Polyploidie. --BlackEyedLion (Diskussion) 06:47, 10. Jun. 2014 (CEST)
So funktioniert Evolution nicht. Lies Genduplikation und Deletionsmutagenese. Also immer erst Verdopplung, dann genetische Drift und zuletzt Verlust der unbrauchbaren, zuviel erzeugten Gene. --SCIdude (Diskussion) 10:48, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wo steht, dass Evolution nur so funktioniert? Wieso kann nicht auch beispielsweise das Fragment, das bei einer Chromosomenaberration entsteht, ein neues Chromosom bilden? Chromosomenaberrationen fuehren wohl schon zu Evolution: en:Dicentric chromosome, en:Robertsonian translocation, en:Acrocentric und dort vor allem der Unterschied zwischen Hauspferd und Przewalskipferd. --BlackEyedLion (Diskussion) 13:19, 10. Jun. 2014 (CEST)
Hohe Luftfeuchtigkeit - woher?
Hier in Tübingen hat es aktuell eine relative Luftfeuchtigkeit von 44%. Woher kommt die? Es brennt seit Tagen die Sonne, der letzte Regen ist Wochen her. --95.112.212.151 22:16, 9. Jun. 2014 (CEST)
--95.112.212.151 22:16, 9. Jun. 2014 (CEST)
44 % ist jetzt nicht richtig hoch. 70% und höher wären hoch. Gruß--217.251.200.151 22:23, 9. Jun. 2014 (CEST)
- 44 % um 22.00 Uhr ist eher so mittel. Vermutlich ist die Luftfeuchte dort nicht hoch, weil seit Tagen die Sonne brennt und der letzte Regen Wochen her ist. Hummelhum (Diskussion) 22:26, 9. Jun. 2014 (CEST)
- Beim Abkühlen kann die Luft zunehmend weniger Feuchtigkeit halten, folglich steigt sie abends. Was verdampft Tag und Nacht alles? Pflanzen holen Dir viel aus dem Boden. Tübingen ist schön grün natürlich wie politisch und da man dort Stocherkahn fahren kann, ist obendrein klar, dass es dort nie Wüstenklima haben kann. --Hans Haase (有问题吗) 22:34, 9. Jun. 2014 (CEST)
- "Woher kommt die?" ist die falsche Frage. Die Feuchtigkeit ist irgendwann durch Verdunstung da reingekommen. Du musst Dich umgekehrt fragen: "Warum geht sie nicht wieder?" Das Wasser in der Luft, also die absolute Feuchtigkeit, kann ja nicht einfach verschwinden. Damit die absolute Feuchtigkeit sinkt, müßte die Feuchtigkeit austauen, d.h. es müßte Nebel/Tau/Regen/Wolken geben. Gerade das passiert aber bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit nicht, da die Temperatur der Luft weit über dem Taupunkt liegt. Deshalb bleibt die (absolute) Feuchtigkeit in der Luft. Was sich ändert ist nur die relative Feuchtigkeit, weil die Aufnahmefähigkeit sich mit der Temperatur ändert. --TETRIS L 00:04, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ts,ts. Dass hier die Fragesteller aber auch nie die richtigen Fragen stellen... --Optimum (Diskussion) 09:37, 10. Jun. 2014 (CEST)
- „Woher kommt die“ ist aber so einfach zu beantworten. Es sind verdunstende Gewässer und transpirierende Pflanzen und Tiere. --Rôtkæppchen₆₈ 12:04, 10. Jun. 2014 (CEST)
- ... die transpirierenden menschlichen Wesen der Erde nicht vergessen.--79.232.209.19 14:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
- P. sapiens subsumiere ich unter Tiere
 . Am allermeisten transpirieren sowoeso die Pflanzen, allen voraun die Bäume. --Rôtkæppchen₆₈ 15:36, 10. Jun. 2014 (CEST)
. Am allermeisten transpirieren sowoeso die Pflanzen, allen voraun die Bäume. --Rôtkæppchen₆₈ 15:36, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Aah, klar, deshalb gehst Du auch zum Tierarzt mit Deinen Wehwehchen....--79.232.209.19 17:32, 10. Jun. 2014 (CEST)
- P. sapiens subsumiere ich unter Tiere
- ... die transpirierenden menschlichen Wesen der Erde nicht vergessen.--79.232.209.19 14:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
Kendo Fernsehgeräte
Hallo, bei dem Händlerverbund EXPERT werden Fernsehgeräte der Marke KENDO angeboten. Eine mir und im IT-Bereich angesiedelte Freunde ein völlig unbekannter Hersteller. Weiß jemand , welcher "Großer" hinter dieser Marke steckt? Vermutlich ein japan. Konzern? Sony?
--79.237.162.178 23:33, 9. Jun. 2014 (CEST)
10. Juni 2014
auf ewig Jungfrau...
Wie hoch liegt der Anteil derjeniger der Bevölkerung Deutschlands, die ihr Leben lang Jungfrau bleiben, also nie Sex haben. Im Frage kämen Mönche, Nonnen, die meisten katholischen Geistlichen, schwer geistig Behinderte und Asexuelle. Nicht gemeint sind hingegen Kinder, die im Alter von 7 Jahre oder so sterben und damit auch ihr gesamtes Leben lang (hoffentlich) nie Sex hatten. --217.225.105.232 11:51, 10. Jun. 2014 (CEST)
Genaue Zahlen gibt es nicht, dafür schämen sich die Betroffenen entweder zu sehr oder werden in wissenschaftlichen Studien schlichtweg nicht danach gefragt. Das lässt sich also nur sehr grob schätzen und entsprehend unsichere Zahlen wird man bekommen. --Proofreader (Diskussion) 11:57, 10. Jun. 2014 (CEST)
Ist übrigens bei weitem nicht auf "offensichtliche Problem- oder Randgruppen" wie geistig Behinderte oder Asexuelle beschränkt, siehe Absolute Beginners; die allermeisten sind in ihrem Verhalten unauffällig, da liegen schlicht Schüchternheit, Kontakthemmungen, Minderwertigkeitsgefühle u.ä. vor, ohne dass man es solchen Leuten ohne weiters anmerken würde. Deswegen dürfte die "Dunkelziffer" auch erheblich sein. --Proofreader (Diskussion) 12:04, 10. Jun. 2014 (CEST)
- +1 zu Dunkelziffer und Zahlenunsicherheit. Zu Mönche, Nonnen, Geistliche ist anzumerken, dass diese Personen sich nicht unbedingt bereits mit der Pubertät zu einer abstinenten Lebensform berufen fühlen und dass es ebenso auch Spätberufene gibt, die bereits eine Partnerschaft absolviert haben. Eine generelle Unterstellung von Jungfräulichkeit dürfte deshalb zu hoch greifen. --Zerolevel (Diskussion) 12:22, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Auf Basis derartiger Presseberichte ein eigener (OR) Versuch das abzuschätzen: Ich komme auf gut zwei Prozent. Umfragen darüber werden eher bei Jüngeren (bis gut 30) gemacht, wo die Zahlen fast zehn Prozent erreichen können, dort sind dann aber auch Leute drin wie sexuell ziemlich desinteressierte aber nicht asexuelle Nerds oder streng Religiöse, die bis zur Hochzeit warten. Die Zahl der Geistlichen dürfte zu niedrig sein, das sie ausschlaggebend wäre (sind das mehr als 100.000 in D?), und der Anteil der zumindest zeitweisen Zölibatsbrecher soll bei an die 40 % liegen. Dann weiß ich noch von einer Umfrage, wo 60jährige befragt wurden, und 95 % angaben länger als 5 Jahre in Beziehungen gelebt zu haben. Der Anteil Asexueller liegt etwa beim Anteil Homosexueller, also zwischen 1 und 2 % (wobei sicher einige davon dennoch hin und wieder sexuell aktiv sind, weil sie den Begriff "Asexualität" nicht kennen, oder weil der Partner drängt), dann nimm noch etwa 1 % besonders Schüchterner dazu. Schwerstbehinderte bleiben hier aber außen vor, die nehemn ja nicht an Umfragen/Studien teil.--Antemister (Diskussion) 13:27, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Gruppe der sog. Absolute Beginners ist jedenfalls statistisch deutlich relevanter als die der Asexuellen, zumal einige (wenn nicht sogar viele) Asexuelle "es" im Laufe des Lebens wenigstens einmal "ausprobieren", sei es nun aus Neugier, oder weil es "einfach passiert". Es gibt eine interessante (für mich als Betroffenen leider eher deprimierende) Studie zur Persönlichkeitsstruktur und Kommunikationsverhalten von (männlichen) Absoulten Beginners von Robin Sprenger, die im Prinzip sagt, dass es bei diesem Phänomen vor allem um Erfahrungslosigkeit geht. Sprich: Wer bis zu einem bestimmten Alter (~25 Jahre) keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat, macht sie auch später nicht mehr, weil er schlicht nicht mehr dazu in der Lage ist. Aus eigener Tätigkeit in Selbsthilfegruppen u.Ä. in dem Bereich kann ich auch sagen, dass die allermeisten Absolute Beginners, sowohl männlich als auch weiblich, "ganz normale Leute" sind, denen man es weder ansieht noch anmerken würde (also nix mit "schwer geistig Behinderte"). Man merkt der Frage an, dass sie von einem Nicht-Absolute-Beginner stammt, der sich gar nicht vorstellen kann, dass "normale" Leute (also keine religiösen Fanatiker oder sonstige geistige Behinderte ;)…) nie Sex haben, aber davon gibt es sehr viele. Interesant wäre es aber schon, da mal einen statistischen Wert zu erfahren, aus meinem eigenen Bekanntenkreis (die Betroffenenforen nicht mitgerechnet) komme ich geschätzt auf mindestens 5% in meiner Alterklasse (ca. 27–32 Jahre, Studenten). Gibt es da statistisches Material?--141.20.106.180 14:14, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Auf Basis derartiger Presseberichte ein eigener (OR) Versuch das abzuschätzen: Ich komme auf gut zwei Prozent. Umfragen darüber werden eher bei Jüngeren (bis gut 30) gemacht, wo die Zahlen fast zehn Prozent erreichen können, dort sind dann aber auch Leute drin wie sexuell ziemlich desinteressierte aber nicht asexuelle Nerds oder streng Religiöse, die bis zur Hochzeit warten. Die Zahl der Geistlichen dürfte zu niedrig sein, das sie ausschlaggebend wäre (sind das mehr als 100.000 in D?), und der Anteil der zumindest zeitweisen Zölibatsbrecher soll bei an die 40 % liegen. Dann weiß ich noch von einer Umfrage, wo 60jährige befragt wurden, und 95 % angaben länger als 5 Jahre in Beziehungen gelebt zu haben. Der Anteil Asexueller liegt etwa beim Anteil Homosexueller, also zwischen 1 und 2 % (wobei sicher einige davon dennoch hin und wieder sexuell aktiv sind, weil sie den Begriff "Asexualität" nicht kennen, oder weil der Partner drängt), dann nimm noch etwa 1 % besonders Schüchterner dazu. Schwerstbehinderte bleiben hier aber außen vor, die nehemn ja nicht an Umfragen/Studien teil.--Antemister (Diskussion) 13:27, 10. Jun. 2014 (CEST)
- BK
- Geistliche: Gemeint sind offenbar die katholischen Priester. Es gibt Schätzungen, nach denen die Hälfte dieser Männer in Deutschland mit einer Frau zusammen (ja, meist nicht -leben, weil das ja auffiele, aber doch -)sind. In etlichen Fällen kommt es auch zu Kindern... Jedenfalls wird in der genannten Hälfte die Anzahl der rein platonischen Verhältnisse sehr gering sein. Wenn man auch berücksichtigt (alles böse Vermutungen, klar), dass unter den Priestern allgemein der Anteil der Homosexuellen nicht gering ist und vermutlich auch die nicht alle keusch sind, wird die Anzahl der "Jungfrauen" unter den Priester wohl eher unter 6.000 liegen. Hummelhum (Diskussion) 14:09, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Gerade noch mal bei Robin Sprenger, Männliche Absolute Beginner. Ein kommunikationswissenschaftlicher Ansatz zur Erklärung von Partnerlosigkeit, Wiesbaden 2014, S. 35–38 nachgelesen, dort: "In einer vom Meinungsforschungsinstitut Mindline Media für die Zeitschrift „Neon“ durchgeführten Umfrage fällt die Zahl der Absoluten Beginner hingegen doppelt bis dreimal so hoch aus: Von tausend Personen zwischen 20 und 35 Jahren geben 4% der Frauen und 6% der Männer an, noch keinerlei Sexpraktiken ausprobiert zu haben. Unter Studenten scheint dieser Prozentsatz nochmals höher auszufallen: Nach einer im Jahr 2000 publizierten Studie des Sexualwissenschaftlers Kurt Starke hatte jeder zehnte Student (Männer und Frauen) zwischen 18 und 30 Jahren noch keinen Geschlechtsverkehr." Wenn man die Studie liest und glaubt, dann kann man mit einiger Berechtigung davon ausgehen, dass sich das für die Betroffenen bis zum Lebensende auch über 30 Jahre nicht mehr ändert, ich würde sie also durchaus auch als gesamtgesellschaftliche Richtwerte anlegen. Selbst da gibt es aber vermutlich noch eine Dunkelziffer. Wenn dann noch die anderen genannten Personengruppen dazu kommen, würde ich mindestens 10% veranschlagen.--141.20.106.180 14:18, 10. Jun. 2014 (CEST)
- "auf ewig Jungfrau" Warum so eine umständliche Fragestellung. Soll die Frage heißen "Wieviele Menschen haben in ihrem Leben keinen Geschlechtsverkehr"? oder "Wieviele Menschen haben keine Sexualität"? Sexualität kann auch ohne Geschlechtsverkehr stattfinden, bspw. Onanie und gleichgeschlechtlicher Sex.--Wikiseidank (Diskussion) 14:49, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Das ab 25 der Zug abgefahren ist halte ich für ein Gerücht. Da kenne ich durchaus Gegenbeispiele, wo das erst später geklappt hat. Immerhin sagt der Volksmund auch (zu recht): Zu jeden Topf findet sich ein passender Deckel. Das unter Studenten der Anteil höher ist, ist auch keine Überraschung. Schon Kinsey hat darauf hingewiesen, dass mit höheren Bildungsgrad geringere sexuelle Aktivität einher geht. Warum auch immer, Dumm f.... zwar nicht zwangsläufig gut, aber fast immer häufiger. Keine Ahnung warum das so ist, vielleicht macht man sich im unteren Segment wohl weniger Gedanken darüber sondern tut es einfach. Benutzerkennung: 43067 21:13, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn im Studentenheim zu später Stunde im Partyraum im Keller die Boxen dröhnen und halbnackte Alkleichen übereinander liegen, gibt es immer ein paar Brave, die oben im Zimmer über ihren Büchern sitzen. Die fallen den anderen gar nicht sonderlich auf, außer wenn sie sich einmal wegen Ruhestörung bei der Heimleitung beschweren. Auch nach mehreren Semestern merken sich die anderen immer noch nicht deren Namen. Studieren sie ein anonymes Massenstudium, können sich nicht einmal die Professoren ein paar Jahre später an die Namen dieser Studenten erinnern. Manche von denen haben eine Inselbegabung, warum sie in ihrem Fach auch sehr gute Studenten sind. Wer übrigens als Teenager schon sehr promiskuitiv ist und womöglich jung Mutter oder Vater wird, geht signifikant seltener studieren. Daher kommt die höhere Zahl bei den Studenten. --El bes (Diskussion) 22:35, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ich (männlich, 27, gerade in den letzten Zügen meiner Masterarbeit in Geschichte – ungeküsst) halte das mit 25 schon für eine nicht ganz unrealistische Schätzung. Einzelfälle mag es immer geben, die kenne ich auch, aber die sind nicht statistisch relevant und sind meiner Erfahrung nach auf jeden Fall nur ein sehr kleiner Fall der Betroffenen. Die Studie von Sprenger, die oben zitiert wird, habe ich nur in Auszügen gelesen, die legt das ebenfalls nahe. Er bezieht sich ja scheinbar nur auf Männer, ich kenne aber persönlich auch zwei Frauen (27, Historikerin, & 33, Zahnärtzin, beide sehr attraktiv ;)), die auch keine besseren Chancen für sich sehen. Ein Psychiater, bei dem ich war, meinte, seiner Berufserfahrung nach wird das in dem Alter nichts mehr, und er hat mir Antidepressiva verschrieben, damit ich bis zum (natürlichen) Lebensende durchhalte. Das war mir zu resignierend, also habe ich mir jemanden ohne Rezeptblock gesucht ;) Eine (ältere) Psychotherapeutin, bei der ich danach war, meinte, ihrer (langjährigen) Berufserfahrung beginnt sie bei männlichen Patienten ab Ende 30/Anfang 40 mit der gezielten Therapie in Richtung Akzeptanz der Partnerlosigkeit, sie habe aber noch niemanden erlebt, der eher zu ihr gekommen sei und es geschafft habe. Meine soziale Kompetenz und Sympathiewirkung schätzte sie aber als vergleichweise hoch ein, was mir auf den ersten Blick widersprüchlich vorkam, also habe ich dem nicht ganz geglaubt und bin gewechselt. Meine aktuelle, zweite (jüngere) Psychotherapeutin behandelt jetzt nur meine Depressionen, weil sie meint, therapeutisch könne man da nichts mehr machen. Auch ihrer professionellen Meinung nach habe ich eine sehr hohe soziale Kompetenz, das Problem mit der Partnersuche sei aber so spezifisch und vor allem so sehr von eigener praktischer Lebenserfahrung abhängig, dass es keine Therapiemöglichkeiten gäbe. Sie meinte, dass das Problem ihrer Erfahrung nach allein in der Kennenlern- und Beziehungsaufbauphase liege, da brauche man dann eben eine Extraportion Glück. Was sie sagte, klang jetzt durchaus sinnvoll, und inzwischen verstehe ich, dass wohl auch die erste Therapeutin genau damit Recht hatte. Die zweite jedenfalls hält mich für zwar eindeutig beziehungsfähig, aber nicht „kennenlernfähig“. Zusammengenommen ist ihr Plan, mich für die nächsten paar Jahre depressionsfrei und damit funktional zu halten, damit ich noch ein bisschen „mein Glück versuchen kann“, aber sie hat mich auch darauf vorbereitet, dass es schwierig wird, wenn man diesem „Glück“ nicht wie „normale“ Menschen auf die Sprünge helfen kann. Ein dritter Psychologe, den ich aufgesucht habe, weil er ein Übungsgruppe für soziale Kompetenz anbietet, meinte nach den Vorgesprächen, dass ihm ein therapeutischer Ansatz für das Problem der Partnerlosigkeit nicht bekannt sei, er könne nur das konventionelle Sozialkompetenztraining als Versuch empfehlen. Allerdings meinte er ebenfalls, dass seiner eigenen Berufserfahrung nach soziale Kompetenz damit nicht viel zu tun hat, hier gehe es um spezielle Fähigkeiten, die sich aus Lebenserfahrung ergeben und schwerlich auf seriösem Wege zu trainieren seien. Zu mir persönlich war sein Urteil ebenfalls, mein Problem läge sicher nicht an meiner sozialen Kompetenz, beurteilt nach den klassischen Maßstäben wäre ich da auf einem sehr guten bis leicht überdurchschnittlichen Niveau. Er hat mich nur als stabilisierendes Element für die anderen in die Gruppe aufgenommen, und falls ich doch ganz allgemein etwas für mich mitnehmen kann. Dann war ich noch in einer wissenschaftlichen Studie zu sozialen Phobien (dachte mal eine Zeit, das wäre das Problem), da wurde ich nach den Voruntersuchungen aussortiert. Mein Problem sei nicht auf den Umgang mit Menschen bezogen, und es sei offensichtlich, dass ich keinerlei Probleme damit habe, Beziehungen (bekanntschaftlich, freundschaftlich und potentiell auch partnerscahftlich) zu führen, es wäre nur durch meine Persönlichkeitsstruktur schwer, als potentieller Partner aufzutreten und zu wirken, also passe ich nicht in den Fokus der Studie. Dazu muss man allerdings sagen, dass ich selbst nie wirklich geglaubt habe, eine soziale Phobie zu haben, ich habe eine normalgroßen Freundeskreis, bin an der Universität ganz normal aktiv und liebe es, Vorträge zu halten usw., und die allermeisten meiner Freundschaften unterhalte ich zu Frauen. Wie gesagt, ja, ich kenne aus verschiedenen Kontakten zu anderen Betroffenen inzwischen auch Erzählungen von Einzelnen jenseits der 25, die doch noch Glück hatten, aber die Psychologen, mit denen ich gesprochen habe (und das sind inzwischen einige…) meinten alle, dass ihrer Berufserfahrung nach allgemein gesprochen die Chancen verschwindend gering sind, und auf jeden Fall nicht durch den Betroffenen beeinflussbar. Der Grund, warum ich jetzt bei meiner aktuellen Therapeutin geblieben bin, ist, dass sie mir in einer [Zitat] „persönlichen, bewusst unprofessionellen Einschätzung“ [/Zitat] ;) mehr Chancen eingeräumt hat, als ihren anderen Patienten, besonders gemessen an meinem Auftreten und meinen Äußeren, und auch wenn ich weiß, dass das nur geschmeichelt war, glaube ich es (manchmal wenigstens) gerne :)--85.179.35.202 22:52, 10. Jun. 2014 (CEST) Nachtrag: Immerhin, zwei Männer waren schon mal an mir interessiert, und sowas soll man ja als Kompliment nehmen ;)--85.179.35.202 23:19, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ganz ehrlich, diese Ergebnisse von Robin Sprenger halte ich für unbrauchbar. Das wieder mal so ein Werk deutscher Billig-Sozialwissenschaft, wo mehr darum geht ein Päper äh Buch auszustoßen anstatt wirklich wissenschaftlichen Fortschritt zu liefern. Es geht doch nicht, die Altersspanne zwischen 20 und 35 Jahren abzufragen in so einem Thema (ebenso sinnvoll die berufliche Tätigkeit in der Zeit von 15 bis 25 oder von 55 bis 65). Deswegen muss die Zahl stark überhöht sein (das Medianalter beim ersten Sexualkontakt liegt in D bei etwas unter 18 (eines der niedrigsten im OECD-Raum), da kann man nicht Zwanzigjährige für so eine Studie befragen. Unter Studenten (bzw. Männer, technischer Bereich) freilich weit höher als in der Gesamtbevölkerung. Jetzt habe ich auch irgendsoeine weitere Zahl (halt aus irgendsoeiner Kurzmeldung aus SpOn, Welt online etc.) im Hinterkopf nachdem es bei Studienanfängern schon an die 40 % sein können. Aber Studenten sind immer noch nicht die Masse der Bevölkerung.--Antemister (Diskussion) 23:25, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Richtig, die untersuchte Gruppe ist mit 15 Personen viel zu klein, um eine statistische Aussage machen zu können. War aber soweit ich das verstanden habe auch gar nicht der Sinn der Sache, es sollte vielmehr erstmal herausgefunden werden, wo man genauer nachforschen müsste. Ein Buch darüber zu schreiben ist natürlich eine Frechheit. -- Janka (Diskussion) 00:03, 11. Jun. 2014 (CEST)
- Ganz ehrlich, diese Ergebnisse von Robin Sprenger halte ich für unbrauchbar. Das wieder mal so ein Werk deutscher Billig-Sozialwissenschaft, wo mehr darum geht ein Päper äh Buch auszustoßen anstatt wirklich wissenschaftlichen Fortschritt zu liefern. Es geht doch nicht, die Altersspanne zwischen 20 und 35 Jahren abzufragen in so einem Thema (ebenso sinnvoll die berufliche Tätigkeit in der Zeit von 15 bis 25 oder von 55 bis 65). Deswegen muss die Zahl stark überhöht sein (das Medianalter beim ersten Sexualkontakt liegt in D bei etwas unter 18 (eines der niedrigsten im OECD-Raum), da kann man nicht Zwanzigjährige für so eine Studie befragen. Unter Studenten (bzw. Männer, technischer Bereich) freilich weit höher als in der Gesamtbevölkerung. Jetzt habe ich auch irgendsoeine weitere Zahl (halt aus irgendsoeiner Kurzmeldung aus SpOn, Welt online etc.) im Hinterkopf nachdem es bei Studienanfängern schon an die 40 % sein können. Aber Studenten sind immer noch nicht die Masse der Bevölkerung.--Antemister (Diskussion) 23:25, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ich (männlich, 27, gerade in den letzten Zügen meiner Masterarbeit in Geschichte – ungeküsst) halte das mit 25 schon für eine nicht ganz unrealistische Schätzung. Einzelfälle mag es immer geben, die kenne ich auch, aber die sind nicht statistisch relevant und sind meiner Erfahrung nach auf jeden Fall nur ein sehr kleiner Fall der Betroffenen. Die Studie von Sprenger, die oben zitiert wird, habe ich nur in Auszügen gelesen, die legt das ebenfalls nahe. Er bezieht sich ja scheinbar nur auf Männer, ich kenne aber persönlich auch zwei Frauen (27, Historikerin, & 33, Zahnärtzin, beide sehr attraktiv ;)), die auch keine besseren Chancen für sich sehen. Ein Psychiater, bei dem ich war, meinte, seiner Berufserfahrung nach wird das in dem Alter nichts mehr, und er hat mir Antidepressiva verschrieben, damit ich bis zum (natürlichen) Lebensende durchhalte. Das war mir zu resignierend, also habe ich mir jemanden ohne Rezeptblock gesucht ;) Eine (ältere) Psychotherapeutin, bei der ich danach war, meinte, ihrer (langjährigen) Berufserfahrung beginnt sie bei männlichen Patienten ab Ende 30/Anfang 40 mit der gezielten Therapie in Richtung Akzeptanz der Partnerlosigkeit, sie habe aber noch niemanden erlebt, der eher zu ihr gekommen sei und es geschafft habe. Meine soziale Kompetenz und Sympathiewirkung schätzte sie aber als vergleichweise hoch ein, was mir auf den ersten Blick widersprüchlich vorkam, also habe ich dem nicht ganz geglaubt und bin gewechselt. Meine aktuelle, zweite (jüngere) Psychotherapeutin behandelt jetzt nur meine Depressionen, weil sie meint, therapeutisch könne man da nichts mehr machen. Auch ihrer professionellen Meinung nach habe ich eine sehr hohe soziale Kompetenz, das Problem mit der Partnersuche sei aber so spezifisch und vor allem so sehr von eigener praktischer Lebenserfahrung abhängig, dass es keine Therapiemöglichkeiten gäbe. Sie meinte, dass das Problem ihrer Erfahrung nach allein in der Kennenlern- und Beziehungsaufbauphase liege, da brauche man dann eben eine Extraportion Glück. Was sie sagte, klang jetzt durchaus sinnvoll, und inzwischen verstehe ich, dass wohl auch die erste Therapeutin genau damit Recht hatte. Die zweite jedenfalls hält mich für zwar eindeutig beziehungsfähig, aber nicht „kennenlernfähig“. Zusammengenommen ist ihr Plan, mich für die nächsten paar Jahre depressionsfrei und damit funktional zu halten, damit ich noch ein bisschen „mein Glück versuchen kann“, aber sie hat mich auch darauf vorbereitet, dass es schwierig wird, wenn man diesem „Glück“ nicht wie „normale“ Menschen auf die Sprünge helfen kann. Ein dritter Psychologe, den ich aufgesucht habe, weil er ein Übungsgruppe für soziale Kompetenz anbietet, meinte nach den Vorgesprächen, dass ihm ein therapeutischer Ansatz für das Problem der Partnerlosigkeit nicht bekannt sei, er könne nur das konventionelle Sozialkompetenztraining als Versuch empfehlen. Allerdings meinte er ebenfalls, dass seiner eigenen Berufserfahrung nach soziale Kompetenz damit nicht viel zu tun hat, hier gehe es um spezielle Fähigkeiten, die sich aus Lebenserfahrung ergeben und schwerlich auf seriösem Wege zu trainieren seien. Zu mir persönlich war sein Urteil ebenfalls, mein Problem läge sicher nicht an meiner sozialen Kompetenz, beurteilt nach den klassischen Maßstäben wäre ich da auf einem sehr guten bis leicht überdurchschnittlichen Niveau. Er hat mich nur als stabilisierendes Element für die anderen in die Gruppe aufgenommen, und falls ich doch ganz allgemein etwas für mich mitnehmen kann. Dann war ich noch in einer wissenschaftlichen Studie zu sozialen Phobien (dachte mal eine Zeit, das wäre das Problem), da wurde ich nach den Voruntersuchungen aussortiert. Mein Problem sei nicht auf den Umgang mit Menschen bezogen, und es sei offensichtlich, dass ich keinerlei Probleme damit habe, Beziehungen (bekanntschaftlich, freundschaftlich und potentiell auch partnerscahftlich) zu führen, es wäre nur durch meine Persönlichkeitsstruktur schwer, als potentieller Partner aufzutreten und zu wirken, also passe ich nicht in den Fokus der Studie. Dazu muss man allerdings sagen, dass ich selbst nie wirklich geglaubt habe, eine soziale Phobie zu haben, ich habe eine normalgroßen Freundeskreis, bin an der Universität ganz normal aktiv und liebe es, Vorträge zu halten usw., und die allermeisten meiner Freundschaften unterhalte ich zu Frauen. Wie gesagt, ja, ich kenne aus verschiedenen Kontakten zu anderen Betroffenen inzwischen auch Erzählungen von Einzelnen jenseits der 25, die doch noch Glück hatten, aber die Psychologen, mit denen ich gesprochen habe (und das sind inzwischen einige…) meinten alle, dass ihrer Berufserfahrung nach allgemein gesprochen die Chancen verschwindend gering sind, und auf jeden Fall nicht durch den Betroffenen beeinflussbar. Der Grund, warum ich jetzt bei meiner aktuellen Therapeutin geblieben bin, ist, dass sie mir in einer [Zitat] „persönlichen, bewusst unprofessionellen Einschätzung“ [/Zitat] ;) mehr Chancen eingeräumt hat, als ihren anderen Patienten, besonders gemessen an meinem Auftreten und meinen Äußeren, und auch wenn ich weiß, dass das nur geschmeichelt war, glaube ich es (manchmal wenigstens) gerne :)--85.179.35.202 22:52, 10. Jun. 2014 (CEST) Nachtrag: Immerhin, zwei Männer waren schon mal an mir interessiert, und sowas soll man ja als Kompliment nehmen ;)--85.179.35.202 23:19, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn im Studentenheim zu später Stunde im Partyraum im Keller die Boxen dröhnen und halbnackte Alkleichen übereinander liegen, gibt es immer ein paar Brave, die oben im Zimmer über ihren Büchern sitzen. Die fallen den anderen gar nicht sonderlich auf, außer wenn sie sich einmal wegen Ruhestörung bei der Heimleitung beschweren. Auch nach mehreren Semestern merken sich die anderen immer noch nicht deren Namen. Studieren sie ein anonymes Massenstudium, können sich nicht einmal die Professoren ein paar Jahre später an die Namen dieser Studenten erinnern. Manche von denen haben eine Inselbegabung, warum sie in ihrem Fach auch sehr gute Studenten sind. Wer übrigens als Teenager schon sehr promiskuitiv ist und womöglich jung Mutter oder Vater wird, geht signifikant seltener studieren. Daher kommt die höhere Zahl bei den Studenten. --El bes (Diskussion) 22:35, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Das ab 25 der Zug abgefahren ist halte ich für ein Gerücht. Da kenne ich durchaus Gegenbeispiele, wo das erst später geklappt hat. Immerhin sagt der Volksmund auch (zu recht): Zu jeden Topf findet sich ein passender Deckel. Das unter Studenten der Anteil höher ist, ist auch keine Überraschung. Schon Kinsey hat darauf hingewiesen, dass mit höheren Bildungsgrad geringere sexuelle Aktivität einher geht. Warum auch immer, Dumm f.... zwar nicht zwangsläufig gut, aber fast immer häufiger. Keine Ahnung warum das so ist, vielleicht macht man sich im unteren Segment wohl weniger Gedanken darüber sondern tut es einfach. Benutzerkennung: 43067 21:13, 10. Jun. 2014 (CEST)
- "auf ewig Jungfrau" Warum so eine umständliche Fragestellung. Soll die Frage heißen "Wieviele Menschen haben in ihrem Leben keinen Geschlechtsverkehr"? oder "Wieviele Menschen haben keine Sexualität"? Sexualität kann auch ohne Geschlechtsverkehr stattfinden, bspw. Onanie und gleichgeschlechtlicher Sex.--Wikiseidank (Diskussion) 14:49, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die für die Ursprungsfrage interessante Anschlussfrage wäre ja jetzt, wie viele von den 40% „Jungfrauen“ beiderlei Geschlechts im Laufe der „wilden“ Studienzeit Erfahrungen sammeln, und wie viele auch zu Studienende mit Ende 20 noch keine Erfahrungen gemacht haben. Für Letztere dürften die Chancen, dann außerhalb des doch eher lockeren Studienumfelds noch jemanden kennenzulernen, ganz radikal abfallen. Für englische Universitäten siehe hier ;), auch wenn das sicher nicht ganz ernst zu nehmen ist gab es auf SPON erst kürzlich mal eine Studie zu lesen, dass 2 von 3 engen Freundschaften zwischen britischen (mal wieder!) Studenten unterschiedlichen Geschlechts im Bett landen. Wenn man das so ließt, dann müsste man das Studium kaum als Jungfrau überstehen können! Ich dagegen habe 8 Jahre studiert, bei meinen engen und besten Freundschaften liegt das Verhältnis Frauen:Männer bei circa 5:2, und als angehender Historiker bin ich auch ganz gewiss nicht der übliche Klischee-Computer-Nerd… Am Äußerlichen wird es wohl auch nicht liegen, die beiden Männer, die ich oben erwähnt habe, waren beide ziemlich gutaussehend ;)--85.179.35.202 00:02, 11. Jun. 2014 (CEST)
Pottwal
So ein Pottwal kann riesige Druckunterschiede ausgleichen, zwei Stunden die Luft anhalten und besitzt tonnenweise isolierende Fettschicht. Hat sich mal jemand Gedanken darüber gemacht wie lange so ein Wal theoretisch im All überleben könnte? (nicht signierter Beitrag von 85.181.219.146 (Diskussion) 12:02, 10. Jun. 2014 (CEST))
Hier gibt's eine englischsprachige Diskussion dazu. Tenor, das Tierchen stirbt "pretty soon" bzw. nicht wesentlich länger als 2-5 Minuten. Immerhin. --Proofreader (Diskussion) 12:09, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Das ist ja länger als in der Atmosphäre des Planeten Magrathea. --Asdert (Diskussion) 15:29, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Und ein Orca? Free Willzyx :-( --AMGA (d) 16:26, 10. Jun. 2014 (CEST)
Unter allen Viechern haben Bakterien immer noch die besten Chancen, siehe Panspermie#Überlebensfähigkeit im Weltraum. Der begrenzende Faktor scheint die Strahlung zu sein. Wenn man gegen die eine Abschirmung hat, fühlen sich manche Bakterien auch bei Vakuum und Extremtemperaturen offensichtlich wohl genug, um längere Zeiträume zu überleben. --Proofreader (Diskussion) 17:22, 10. Jun. 2014 (CEST)
NPD-Klage gegen Bundespräsidentenwahlen
Das BVG hat geurteilt, dass die Bundespräsidentenwahlen 2009 und 2010 rechtens warren. Was wäre denn passiert, wenn der Kalge stattgegeben worden wäre? Schließlich sin die 2009 bzw. 2010 gewählten nicht mehr Bundespräsident.--93.228.177.16 12:47, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Das BVerfG hat auch das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2009 für verfassungswidrig erklärt, weil die hohe Zahl an Überhangmandaten das Ergebnis stark verzerrt hat (auch für 2013 gibt jetzt wieder Leute, die die Legitimität des Ergebnisses in Frage stellen, weil die 15 % verfallenen Stimmen das Ergebnis wieder verzerren.). Aber passiert ist nichts, es gab keine Neuwahl, nur eine Änderung des Wahlgesetzes.--Antemister (Diskussion) 13:04, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wann soll das BVerfG die Wahl für verfassungswidrig erklärt haben? 2008 wurde das Bundeswahlgesetz für verfassungswidrig erklärt, das stimmt, aber das BVerfG hatte eine Übergangsfrist von 3 Jahren gesetzt, in der die alte Fassung trotzdem weiter gelten sollte. Die galt dann auch für die Bundestagswahl 2009 noch. --Tokikake (Diskussion) 13:58, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Also, Irrtum. Im Netz wurde viel gespottet dass einfach so ein verfassungswidriger Bundestag gewählt wurde.--Antemister (Diskussion) 20:00, 10. Jun. 2014 (CEST)
- (BK)Die NPD hat auch nicht gegen das Ergebnis geklagt, sondern gegen die Geschäftsordnung der Bundesversammlung. Sie wollte sich eine Aussprachemöglichkeit vor der Wahl erklagen. --Rôtkæppchen₆₈ 13:59, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Amtszeiten von Wulff und Köhler sind ja außerplanmäßig beendet worden, und die NPD-Klage ging doch gegen Gauck ob er NPD-Politiker als Spinner bezeichnen darf.--Otto Otto Otto 1991 (Diskussion) 15:39, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Waren zwei Klagen, einmal gegen das „Spinner“, einmal gegen die Geschäftsordnung bei der Budnespräsidentenwahl. --BHC (Disk.) 15:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Es waren sogar drei Klagen, jeweils gegen die Bundesversammlungen 2009 (AZ: 2 BvE 2/09) und 2010 (AZ: 2 BvE 2/10) und die dritte Klage gegen Gauck (Az: 2 BvE 4/13). --Rôtkæppchen₆₈ 16:24, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Waren zwei Klagen, einmal gegen das „Spinner“, einmal gegen die Geschäftsordnung bei der Budnespräsidentenwahl. --BHC (Disk.) 15:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Amtszeiten von Wulff und Köhler sind ja außerplanmäßig beendet worden, und die NPD-Klage ging doch gegen Gauck ob er NPD-Politiker als Spinner bezeichnen darf.--Otto Otto Otto 1991 (Diskussion) 15:39, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Passiert wäre, dass es nächstes Mal anderes gemacht werden würde. --Eike (Diskussion) 17:55, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Hätte das Bundesverfassungsgericht wirklich Artikel 54 des Grundgesetzes („Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. […]“, Fettung von mir) für grundgesetzwidrig eklären können? Ich habe das Ansinnen der NPD von vorneherein für aussichtlos erachtet. Und das dritte Urteil finde ich auch gut so. --Rôtkæppchen₆₈ 21:52, 10. Jun. 2014 (CEST)
Farben durch Polarisation
Ich war beim Optiker wegen einer Sport Sonnenbrille für Bergsteigen und Laufsport. Der Optiker zeigte mir ein Bild. Mit einer "normalen" Brille war es gleichmäßig grau und man konnte nur unscharfe Umrisse erkennen. Mit der Sportbrille (mit Polarisationsfilter) sah man ein scharfes Bild mit mehreren verschiedenen Farben. Wie geht das?
Ich weis, was Polarisation und Polarisationsfilter sind und wie dadurch hell/dunkel Unterschiede entstehen. Aber wie können durch einen Filter unterschiedliche Farben erzeugt werden?
--Madscientist3 (Diskussion) 14:50, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Man kann durch geschicktes Ausnutzen der Frequenzen sogar auf einem Schwarz-Weiß-Fernsehapparat dem Betrachter den Eindruck vermitteln, er sähe dort bunte Farben – es gibt einen witzigen Versuch mit einer schnell rotierenden Scheibe dazu, die nur schwarz und weiß ist, aber Farben darzustellen scheint. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das zumindest verwandt mit dem Moiré-Effekt. —[ˈjøːˌmaˑ] 16:31, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ich nehme an, dass das Bild präpariert war. Du teilst das Bild rasterweise in abwechselnd polarisierte Bereiche (entweder H/V oder L/R) ein und gibt der einen Polarisationsrichtung die zu sehenden Farben, der anderen die Komplementärfarben mit. Unpolarisiert heben sich Farbe und Komplementärfarbe auf und man sieht graue Matsche. Polarisiert werden die Komplementärfarben ausgeblendet und man sieht die beabsichtigten Farben. --Rôtkæppchen₆₈ 17:28, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Polarisationsfilter arbeiten mit Wellenlängen. Ist eine Lichtart (Farbe der Lichtwellenlänge) in Resonanz, wird sie bedingt der Verlagerung verstärkt oder ausgelöscht, daher der mögliche Farbeindruck. Wusste ich auch nicht. --Hans Haase (有问题吗) 17:45, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Verstärkt nicht aber unterschiedich stark ausgelöscht. --Rôtkæppchen₆₈ 18:07, 10. Jun. 2014 (CEST)
Arbeitsvermittler als Arbeitnehmer beauftragen?
Guten Tag, ich schreibe derzeit meine BA und bin privat sehr eingespannt so das für die Jobsuche wenig Zeit bleibt, kann ich eigentlich auch als potenzieller Arbeitnehmer einen Arbeitsvermittler beauftragen? Logisch ist, dass ich ihn bezahlen muss, das soll nicht das Problem sein nur gibt es Arbeitsvermittler die überhaupt mit Arbeitnehmern zusammenarbeiten? Eine erste kurze Google suche war nicht sehr erfolgreich vielleicht weiß hier ja jemand Rat?--Otto Otto Otto 1991 (Diskussion) 15:36, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Logisch kannst Du, ein seriöser Vermittler wird von Dir dafür noch nicht einmal Geld verlangen. Der erhält sein Honorar (üblicherweise mehrere Deiner Monatsgehälter) nämlich vom Arbeitgeber, im Falle einer erfolgreichen Vermittlung. --93.137.166.94 16:42, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Selbstverständlich kannst du einen beauftragen - die Arbeitnehmer, die von Personalvermittlern in neue Jobs vermittelt werden, bestehen vorzugsweise aus abgeworbenem Personal und aus Absolventen. Nicht jeder, der aufgrund seiner Qualifikation für Arbeitgeber interessant ist, ist aber auch für Personalvermittler interessant, denn die vermitteln natürlich am liebsten hochbezahlte Führungskräfte - an denen verdienen sie nämlich am meisten (aus dem von der IP über mir bereits genannten Ǵrund). Suche nach Headhuntern und biete ihnen deine Arbeitskraft zur Vermittlung an. --Snevern 17:42, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Im Moment sollte es nicht schwer sein etwas zu finden. Vorstellen musst Du Dich schon selbst. --Hans Haase (有问题吗) 17:43, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn es sich um einen Job handelt, für den Fachkräfte gesucht werden, reicht es mitunter auch, in XING oder LinkedIn einfach auf die baldige Verfügbarkeit hinzuweisen - die Anfragen der Headhunter, ob sie Dich kennenlernen und dann ggf. bei ihren Kunden vorstellen dürfen, kommen dann von ganz alleine. Auch für manche "Indianer" werden ordentliche Gehälter und somit gute Vermittlungsprämien gezahlt, nicht nur für "Häuptlinge". --93.137.166.94 20:25, 10. Jun. 2014 (CEST)
Was ist das hier für ein Automodell?
Was ist das für einer?
--88.130.69.173 17:44, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Honda CR-V. Grüße •
 • hugarheimur 18:05, 10. Jun. 2014 (CEST)
• hugarheimur 18:05, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Danke dir! Der scheint ja einiges auszuhalten. :-) --88.130.69.173 18:24, 10. Jun. 2014 (CEST)
Freihandelsabkommen - warum nicht nur unumstrittene Themen behandeln?
Hallo, warum werden beim geplanten Freihandelsabkommen zwischen der USA und der EU nicht einfach mal die unumstrittenen Dinge umgesetzt. Bspw. wird es ja niemanden stören, wenn irgendwelche Kabel in irgendwelchen Maschinen die gleiche Farbe haben. Ganz im Gegensatz bspw. zu Verbraucherschutz-Themen. Was für Gründe werden genannt diese gemeinsam behandeln zu müssen. --178.5.127.41 18:11, 10. Jun. 2014 (CEST)
- (Ohne spezifische Details zu kennen:) Weil es Politik ist. Was da am Ende beschlossen wird, ist immer irgendein Kompromiss. Da werden die unterschiedlichsten Aspekte aneinander gekoppelt und Staaten stimmen nur zu, wenn sie x kriegen, wenn sie schon mit Bauchweh bei y zustimmen. Und so gibt es am Ende kaum irgendeinen Punkt, der unumstritten und einzeln verabschiedbar ist... --88.130.69.173 18:27, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Man könnte bösartig sagen, dass es eine geschickte Mogelpackung ist - wenn da ein unüberschaubar großes Bündel von Themen zusammen verhandelt wird, und dann auch in einem Abwasch im Parlament darüber abgestimmt wird, ist die Chance viel höher, unpopuläre Aspekte mit durch zu bekommen. Was wäre wenn zB nur Verbraucherschutzthemen, also inkl. Gentechnik und Chlorhühnchen, getrennt behandelt würden? Dann würde die Öffentlichekit sturmlaufen gegen diesen Einzelaspekt und es fiele schwer, ihn seitens der Befürworter zu verargumentieren. Bündelt man alles, kann man im Parlament zustimmen und dann sagen "Tut uns leid, die tollen Handelserleichterungen gabs nur im Paket mit den Chlorhühnchen, wir mussten also zustimmen". (Wobei die tollen Handelserleichterungen ohnehin überschätzt werden und auch nicht wirklich der Fokus sind, siehe Artikel TTIP). Im Übrigen sollte sich jeder mal ansehen welch erbärmliches Bild unsere Politik dabei abgibt, meiner Meinung nach kann man ohne weiteres sagen, dass das TTIP praktisch nur den Großkonzernen nutzt und für die Bürger eine Fülle von riesigen zu schluckenden Kröten bereithält. Das wird noch Heulen und Zähneklappern geben wenn es 2015 so wie bisher bekannt in Kraft treten sollte, woran ich nicht glaube. Solaris3 (Diskussion) 18:38, 10. Jun. 2014 (CEST)
- +1 zu Solaris3. Die Bezeichnung Mogelpackung für dieses sogenannte „Freihandelsabkommen“ ist dabei noch zurückhaltend. Grüße •
 • hugarheimur 18:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
• hugarheimur 18:46, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ganz ehrlich, ich halte das was hier gerade passiert für eine Inszenierung mit der sich die EU-Eliten gegen den US-Imperialismus stellen will. Ich mein, warum soll etwas was den Amerikanern völlig normal ist plötzlich den Europäern ganz schlecht bekommen? Auch den den USA gibt es solche Widerstände, und auch in Zukunft ist niemand ist gezwungen US-Produkte zu kaufen. Zur Frage: Über unumstrittenes muss nicht groß verhandelt werden (Verhandlungen, aus denen des Frieden Willen die Kontroversen Punkte nicht besprochen, haben bekanntlich nicht viel nutzen).--Antemister (Diskussion) 20:12, 10. Jun. 2014 (CEST)
- +1 zu Solaris3. Die Bezeichnung Mogelpackung für dieses sogenannte „Freihandelsabkommen“ ist dabei noch zurückhaltend. Grüße •
- Unter der Annahme, dass du weißt, was "Elite" bedeutet: Wo siehst du in Europa Angehörige einer Elite in Positionen (also vor allem politischen, vielleicht auch wirtschaftlichen), in denen sie an dem in Rede stehenden Abkommen mitverhandeln? Eliten gibt es vielleicht immer weniger, aber wenn dann im Elfenbeinturm oder im Konzertsaal oder so... Selbst gute Politiker - und die werden doch immer mehr zur Bückware - gehören (zumal in Deutschland) längst nicht mehr zur Elite. Na gut, vielleicht noch der baden-württembergische Ministerpräsident. Hummelhum (Diskussion) 20:31, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Zur Kopplung von Abstimmungen gab es mal eine Folge bei den Simpsons, wenn ich mich nicht irre, in der Lisa dazu einen Abgeordneten überreden konnte. Da wird das ganz gut erklärt. --84.58.126.222 21:21, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Bündelung von Gesetzen (und damit unstrittige mit eher unpopulären Inhalten zu verbinden) ist schon uralt, siehe lex satura, über deren Verbot (98 v. Chr.) Livius Drusus bei seinen Reformversuchen 91 v. Chr. gestolpert ist.--IP-Los (Diskussion) 22:09, 10. Jun. 2014 (CEST)
- @Hummelhum, das weiß ich schon (ich habe ja extra Eliten geschrieben, da ist es klarer), aber ich habe heute schon mir einen Revert wegen abfälliger Bezeichnung dieser Personengruppe eingefangen, weshalb ich hier Begriffe wie Herrscherclique, Machthaber, Establishment vermeiden wollte. Wobei der mächtigste GroßkonzernTM von jeder Regierung die es wirklich will gestoppt werden kann.--Antemister (Diskussion) 22:48, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ist es nicht viel eher so, dass die Großkonzerne die Regierungen stoppen? --Rôtkæppchen₆₈ 22:52, 10. Jun. 2014 (CEST)
- ... vor sich hertreiben wäre die bessere Formulierung. --El bes (Diskussion) 23:02, 10. Jun. 2014 (CEST)
- die es wirklich will ist der relevante Satzteil. Wenn der Ärger zu groß wird, dann gibt es kein Fracking, Gentechnik, oder auch keine Chlorhühnchen. Notfalls findet man ein Schlupfloch (momentan aber wohl nicht er Fall).--Antemister (Diskussion) 23:09, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wie sagen die Kubaner: un pueblo unido jamás será vencido. Wenn wir alle keine Chlorhühner wollen, keine Genmais-Stärke-Limonaden und auch kein Fracking-Gas oder LNG aus Katar und kein US-Patentrecht, kein Investitionsschutzabkommen auf kosten der Steuerzahler, dann können sich die Konzerne die Zähne ausbeissen. Aber die werden schon Mittel und Wege finden, das Volk (el pueblo) auseinanderzudividieren und mit Schattenboxen zu Randthemen zu beschäftigen. --El bes (Diskussion) 23:26, 10. Jun. 2014 (CEST)
- die es wirklich will ist der relevante Satzteil. Wenn der Ärger zu groß wird, dann gibt es kein Fracking, Gentechnik, oder auch keine Chlorhühnchen. Notfalls findet man ein Schlupfloch (momentan aber wohl nicht er Fall).--Antemister (Diskussion) 23:09, 10. Jun. 2014 (CEST)
- ... vor sich hertreiben wäre die bessere Formulierung. --El bes (Diskussion) 23:02, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ist es nicht viel eher so, dass die Großkonzerne die Regierungen stoppen? --Rôtkæppchen₆₈ 22:52, 10. Jun. 2014 (CEST)
- @Hummelhum, das weiß ich schon (ich habe ja extra Eliten geschrieben, da ist es klarer), aber ich habe heute schon mir einen Revert wegen abfälliger Bezeichnung dieser Personengruppe eingefangen, weshalb ich hier Begriffe wie Herrscherclique, Machthaber, Establishment vermeiden wollte. Wobei der mächtigste GroßkonzernTM von jeder Regierung die es wirklich will gestoppt werden kann.--Antemister (Diskussion) 22:48, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Bündelung von Gesetzen (und damit unstrittige mit eher unpopulären Inhalten zu verbinden) ist schon uralt, siehe lex satura, über deren Verbot (98 v. Chr.) Livius Drusus bei seinen Reformversuchen 91 v. Chr. gestolpert ist.--IP-Los (Diskussion) 22:09, 10. Jun. 2014 (CEST)
Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn): Straßenbahn oder Nebenbahn nach Eisenbahnrecht 1938 bis 1951
Die Wiener Lokalbahnen(Badener Bahn) scheinen nicht in der Liste der von der Deutschen Bahn 1938 übernommenen österreichischen Privatbahnen auf. Was war sie dann 1938 nach deutschem Recht? Die Straßenbahnen wurden nach deutschem Recht übernommen. Waren darunter auch die Wiener Lokalbahnen? Wie lange galt das deutsche Eisenbahnrecht in Österreich? Was geschah 1951? Seit dann soll sie Nebenbahn gewesen sein. Wie lange galt in Deutschland das 1938 geltende Eisenbahngesetz? Wann und wie wurden die übernommenen ehemaligen österreichischen Bahnen wieder an Österreich übergeben? Sind da die Wiener Lokalbahnen darunter? Mit welchen Gesetzen? Mit bestem Dank für Ihre Auskunft. Es geht um die Verifizierung der Behauptung der Wiener Lokalbahnen seit jeher eine Nebenbahn gewesen zu sein. Dr. Heide Keller
In der Liste der österreichischen Privatbahnen, die 1938 übernommen wurden, scheinen die Wiener Lokalbahnen in der Wikipedia-Liste nicht auf. Es wurden auch gesetzlich die österreichischen Straßenbahnen übernommen. War sie unter den Straßenbahnen? Die Bahnen wurden nach dem Krieg wieder zurückgegeben, wann war das und mit welcher Rechtsgrundlage? Wie lange hat deutsches Eisenbahnrecht in Österreich gegolten und wo finde ich dieses Recht? Danke! Die Wiener Lokalbahnen behaupten von Anfang an Nebenbahn gewesen zu sein, was für die Anrainer ein Bauverbot etc. eine praktische Enteignung nach sich ziehen würde. Bitte, helfen Sie! Dr. Heide Keller (nicht signierter Beitrag von 194.118.57.61 (Diskussion) 18:30, 10. Jun. 2014 (CEST))
- Die Deutsche Reichsbahn wurde am 1. April 1920 per Staatsvertrag zur Gründung der Deutschen Reichseisenbahnen (RGBl. 1920 I, S. 773) gegründet.[32] Am 30. August 1924 wurde das „Gesetz über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Reichsbahngesetz)“ (RGBl. II S. 272) erlassen. Es wurde ab 1945 durch besatzungsrechtliche Vorschriften und am 29. März 1951 durch das Allgemeine Eisenbahngesetz (BGBl. I S. 225, ber. S. 438) ersetzt. --Rôtkæppchen₆₈ 20:12, 10. Jun. 2014 (CEST)
Anschnallzeichen beim Sinkflug
Wieviele Kilometer vor dem Zielflughafen (der sich Einfachheit halber auf Meeresspiegelhöhe befinde) beginnt ein handelsüblicher Airbus A 319/320 oder eine Boeing 737-800 o. ä. unter Normalbedingungen (schönes Wetter) aus einer Reiseflughöhe von ca. 11.000 m mit dem Sinkflug (=Anschnallzeichen leuchten auf)? Ich weiß, dass das erheblich schwanken kann, es geht mir nur um einen groben Durchschnittswert bzw. eine Bandbreite.
--92.226.33.52 19:04, 10. Jun. 2014 (CEST)
- In Sinkflug steht das der Standardsinkflug ca. 3° beträgt was ein Verhältnis von 1:19 macht. Damit sollte man es problemlos ausrechnen können. --Mauerquadrant (Diskussion) 20:09, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Damit komme ich auf ca. 210 km. Kann jemand der sich damit auskennt, bestätigen dass das realistisch ist? --92.226.33.52 20:34, 10. Jun. 2014 (CEST)
- (BK) Es hat vor allem mit den erwarteten Lufttubelenzen zu tun, wann das Anschnallzeichen erscheint. Das heisst im Sommer mit thermischen Luftturbulenzen früher, als im Winter mit stabiler Luftschichtung. Und das entscheidet eigentlich der Pilot, und das kann unter Umständen heissen dass er es schon auf Reiseflughöhe einschaltet. Für mich logisch erscheint, dass er es vor erreichen der Peplosphäre einschaltet, weil spätestens ab da wird es ruckelig im Flugzeug. Er muss es auch zu einem Zeitpunkt einschalten bevor er durch das Anflugprozedere abgelenkt werden könnte (und es vergessen würde). Er wird es also spätestens zu Beginn des Landeanflug einschalten. Weil danach wird es allgemein unangenehmer im Flugzeuge wenn Fahrwerk und Klappen ausgefahren werden. Es ist also auch eine Frage welches Anflugverfahren angewendet wird, wann der Landeanflug beginnt und somit das Anschnallzeichen leuchten muss (davor kann es natürlich auch schon leuchten). --Bobo11 (Diskussion) 20:44, 10. Jun. 2014 (CEST)
- @IP ich kenne den Spruch, „der Sinkflug wird rund 100 nautische Meilen vor dem Zielflughafen eingeleitet“. Das wären dann rund 185 Km. Aber der Spruch geht nicht von 11.000m Reiseflughöhe aus. --Bobo11 (Diskussion) 20:57, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wann und wie der Sinkflug eingeleitet wird, bestimmt nicht der Pilot, sondern die Lotsen am Flughafen. Eine Regelmäßigkeit gibt es da nicht, das hängt davon ab, wie viel Flugzeuge aus welchen Höhenstaffelungen in den Anflugbereich eingereiht werden müssen. Das wird heutzutage mit Rechnerunterstützung gemacht. Geh einfach mal auf Flightradar24 und verfolge mal einige Flugzeuge. Die wirst sehen, dass die Sinkgeschwindigkeiten öfters und stark variieren. Im ganzen Anflug erhalten die Piloten Anweisungen und vor allen Dingen Freigaben in die nächste Ebene zu sinken, dabei wird ihnen die Geschwindigkeit und die Sinkrate vorgegeben.--79.232.209.19 21:47, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Richtig, da will ich dir auch nicht wieder sprechen. Es ist durchaus üblich, vor dem eigentlichen Sinkflug, das Flugzeug noch ein paar Flugebene runter zu holen. Aber man kann eben auch nicht darauf gehen, dass wenn das Anschnallzeichen aufleuchtet, dass der Sinkflug beginnt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. --Bobo11 (Diskussion) 21:53, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Piloten beginnen mit der Landecheckliste in dem Moment, wo der Tower bestätigt, dass sie zur Landung angenommen sind. Das Anschalten der Anschnallzeichen steht ziemlich am Anfang der Checkliste, in der Regel beginnt dann kurz darauf ein eher Treppenartiger Sinkflug.--79.232.209.19 22:03, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Da musst du aufpassen, der Sinkflug von der Reiseflughöhe hat durchaus schon vorher begonnen. Das was du beschriebst ist der Landeanflug. Und eben spätestens dann leuchtet dann das Anschnallzeichen auf, weil es so in der Checkliste steht. Die Abarbeitung der Lande-Chekliste beginnt aber nicht auf 11'000 Meter. --Bobo11 (Diskussion) 22:34, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Das Anschnallzeichen war von mir eher symbolisch als merklicher Beginn des Sinkflugs gemeint. Bei meinen letzten Flügen erschien es immer sehr früh, zugleich mit einem für mich als Laien merklichen Sinkflug ca. 20-30 min vor der Landung. --92.226.33.52 23:52, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Da musst du aufpassen, der Sinkflug von der Reiseflughöhe hat durchaus schon vorher begonnen. Das was du beschriebst ist der Landeanflug. Und eben spätestens dann leuchtet dann das Anschnallzeichen auf, weil es so in der Checkliste steht. Die Abarbeitung der Lande-Chekliste beginnt aber nicht auf 11'000 Meter. --Bobo11 (Diskussion) 22:34, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Die Piloten beginnen mit der Landecheckliste in dem Moment, wo der Tower bestätigt, dass sie zur Landung angenommen sind. Das Anschalten der Anschnallzeichen steht ziemlich am Anfang der Checkliste, in der Regel beginnt dann kurz darauf ein eher Treppenartiger Sinkflug.--79.232.209.19 22:03, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Richtig, da will ich dir auch nicht wieder sprechen. Es ist durchaus üblich, vor dem eigentlichen Sinkflug, das Flugzeug noch ein paar Flugebene runter zu holen. Aber man kann eben auch nicht darauf gehen, dass wenn das Anschnallzeichen aufleuchtet, dass der Sinkflug beginnt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. --Bobo11 (Diskussion) 21:53, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Wann und wie der Sinkflug eingeleitet wird, bestimmt nicht der Pilot, sondern die Lotsen am Flughafen. Eine Regelmäßigkeit gibt es da nicht, das hängt davon ab, wie viel Flugzeuge aus welchen Höhenstaffelungen in den Anflugbereich eingereiht werden müssen. Das wird heutzutage mit Rechnerunterstützung gemacht. Geh einfach mal auf Flightradar24 und verfolge mal einige Flugzeuge. Die wirst sehen, dass die Sinkgeschwindigkeiten öfters und stark variieren. Im ganzen Anflug erhalten die Piloten Anweisungen und vor allen Dingen Freigaben in die nächste Ebene zu sinken, dabei wird ihnen die Geschwindigkeit und die Sinkrate vorgegeben.--79.232.209.19 21:47, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Damit komme ich auf ca. 210 km. Kann jemand der sich damit auskennt, bestätigen dass das realistisch ist? --92.226.33.52 20:34, 10. Jun. 2014 (CEST)
Polizeisprecher der SPD-Landtagsfraktion
Hallo!
Was bedeutet in diesem http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaos_Sakellariou
Zusammenhang (vorletzter Absatz, etwa in der Mitte) Polizeisprecher der SPD-Landtagsfraktion?--79.224.206.184 21:00, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Sprecher für politische Fragen und Themen rund um die Polizei. Die Landtagsfraktion und er selbst verwenden den Begriff "Polizeisprecher". --Snevern 22:15, 10. Jun. 2014 (CEST)
- (BK) Das bedeutet, dass er in der fraktionsinternen Aufgabenverteilung das Thema Polizei betreut und dann auch bevorzugt zu diesen Themen Stellung nimmt. Haben wir in Bayern auch und es ist in der SPD-Landespolitik nicht so ungewöhnlich, der Polizei einen eigenen Politiker zu widmen, der dann auch etwas konservativer als die anderen Innenpolitiker sein (und reden) darf. --Rudolph Buch (Diskussion) 22:22, 10. Jun. 2014 (CEST)
Gebrauchsgeschichte des Wortes "Cerealien" in den 1970er/1980er Jahren
Wann wurde das Wort Cerealien (für Frühstücksflocken) von der westdeutschen Werbung wiederentdeckt und reaktiviert? Google Ngram legt den Zeitraum um 1977/78 plus/minus ein paar Jahre nahe. In der ersten Hälfte der 1970er muß es noch ungewöhnlich gewesen sein und es wurde, soweit ich das sehen kann, noch nach Cornflakes, Haferflocken und sehr selten Müsli (im Sinne von Birchernmüsli) unterschieden. Allerdings beginnt wohl auch erst Mitte der 1970er mit der entstehenden städtischen Breitenwirkung der aufgekommenen Bio- bzw. Ökoläden die eigentliche Müsli-Zeit. (Siehe dazu auch den Hinweis in der die Ngram-Suche nach "Bioladen und "Ökoladen", die eine Hypothese hinsichtlich des Sprachgebrauchs - Bio zuerst und früher - und möglicherweise der Ausdifferenzierung des Warenangebots der Läden über Nahrungsmittel hinaus nahelegt). Den Satz im Artikel Müsli: "In der 68er-Bewegung gehörte das Müsli zum alternativen, ökologischen Lebensstil." halte ich für inkompetenten, verantwortungslos behaupteten und unbelegten Vorurteils-Quatsch. Auch kann man - gleicher Artikel - für "Ende der 1960er-Jahre" mitnichten von einer Umweltbewegung reden. (Wir haben zwar keine Ahnung von der Geschichte des Widerstands, aber wir schreiben sie...) Egal, die Arbeitshypothese ist jedenfalls, daß "Cerealien" im alltäglichen Sprachgebrauch in der ersten Hälfte der 1970er weitgehend ungebräuchlich war und über eine Werbekampagne wieder gebräuchlicher wurde. Möglicherweise verbunden mit einer Produkteinführung. Einige Zeitzeugen erinnern sich dunkel, aber übereinstimmend an eine Fernsehwerbung für ein Produkt mit mehreren Cerealien, auch an die Reaktion "Cerealien - was ist das?", aber leider ebenso übereinstimmend dank der Müsli-Zeit nicht genauer. Sowas kaufte man nicht. Gesucht wird daher alles, was die Arbeitshypothese verifiziert, und konkretes belegbares Fleisch an die Knochen macht, bevorzugt auch die Marke, die damals erstmals mit "Cerealien" beworben wurde und das entsprechende Jahr. Dank für die Mühe und die Antworten im Voraus. --87.149.161.135 23:53, 10. Jun. 2014 (CEST)
- das ist überhaupt gar kein deutsches Wort und nur durch schlecht übersetzte US-Werbespots in die Gehirne mancher Medienopfer gekommen. --El bes (Diskussion) 23:55, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Exakt. Ich war Anfang der 70er in den USA und da hießen Cornflakes (das sagten wir hier) Cereals.--Geometretos (Diskussion) 23:58, 10. Jun. 2014 (CEST)
- Ich kann den Beginn meines Müslikonsums, damals noch selbergemischt, sicher auf Mai 1974 datieren. Den Begriff Cerealien kannte ich damals nur von der Rückseite der Kellogg’s-Packungen. --Rôtkæppchen₆₈ 00:02, 11. Jun. 2014 (CEST)





